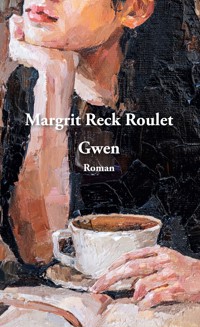9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Steinemacherin erzählt von Steinen spezieller Art. Von jenen, die sich aus den Erlebnissen ihres Lebens mit Ralf gebildet haben und die sie mit sich herumträgt, unbeachtet und verschwiegen. Aber auch von jenen, die sie bearbeitet und ausstellt. Als sie am Bett ihres im Koma liegenden Mannes Ralf zu erzählen beginnt, was sich in ihr abgelagert hat, löst sie eine Lawine von Geschehnissen aus, die keinen Stein mehr auf dem anderen lassen. Was mit einem Suchen nach Worten für ihre Geschichte, ihre Empfindungen beginnt, wandelt sich in ein Zeugnis ihres eigenen Erlebens. Die Steinemacherin formt nicht nur Skulpturen, sondern nach und nach auch den eigenen Weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elisabeth Ruch-Reck
Stephan Ruch
Alain Roulet
Vielen Dank für eure wertvollen Hinweise und die
Unterstützung
«Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt.»
Johann Wolfgang von Goethe – Faust
«Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.»
Johann Wolfgang von Goethe,
dt. Dichter und Naturforscher, 1749-1832
»Words are form
Form can be debated
Behind and beyond words understanding starts.»
Wisdom, unknown
Ringel, Ringel rum. Lirum, Larum Löffelstiel, wer das nicht kann, der kann nicht viel … Ich habe nicht viel gekonnt, als Einzige.
Im Kreis der Kinder wird die Rassel im Rhythmus geschüttelt und der Spruch gesagt, danach wird das Instrument weitergegeben. Wer ‚es‘ richtig macht, wird von der Lehrerin aufgefordert, zu ihr zu kommen, um ‚es‘ mit ihr zu wiederholen, als Zeichen, dass man ‚es‘ kann, dass ‚es‘ kein Zufall gewesen ist. Vor ihr stehend, wird der Kinderreim im Rhythmus erneut geschüttelt, der Spruch aufgesagt, die Rassel ihr übergeben. Es ist der ultimative Test. Wer ihn mit ihr besteht, gehört zum Club der Gescheiten, zu jenen, die wissen, wie ‚es‘ geht.
Einmal habe ich es fast geschafft. Ich habe ‚es‘ im Kreis richtig gemacht und bin dann zu ihr nach vorn gegangen. Konzentriert habe ich den Rhythmus wiederholt und ihr die Rassel übergeben. Habe ich den Test bestanden? Bin ich dabei? Nein. Sie gibt mir die Rassel zurück, verlangt eine Wiederholung. Ich verstehe nicht. Was erwartet sie von mir? Ich schwitze, beginne zu zweifeln. Und wenn ich mich nicht richtig erinnere? Wie ist der Rhythmus exakt gewesen? Bin ich fähig, ihn zu wiederholen? Ich bin mir sicher, dass ich eben so gescheit bin, wie die anderen und das will ich jetzt, hier vor ihr, zeigen. Wird es mir in diesem wichtigen Moment gelingen? Noch konzentrierter als vorher wiederhole ich das Schütteln und den Spruch, übergebe ihr die Rassel erneut, schaue sie erwartungsfroh und stolz an. Ich habe denselben Rhythmus geschüttelt, ich weiß es genau. Doch sie schüttelt den Kopf, erklärt mir nichts, zeigt mit dem Finger auf mein Stühlchen. Was habe ich falsch gemacht? In diesem Spiel sind Tränen nicht erlaubt, ich muss zurück in den Kreis. Einige, die den Trick schon lange kennen, unterdrücken ein Lachen. Niemand hilft mir, niemand verrät mir das Geheimnis. Worum geht ‚es‘? Sie schütteln alle denselben Rhythmus, zum Teil ungenauer als ich, das höre ich wohl. Warum gilt nicht, was ich mache? Unverständlich, ich verstehe ‚es‘ nicht.
Schlussendlich sitze ich als Letzte im Kreis und kann nicht viel. Die Lehrerin hat alle Hoffnung auf meine Fähigkeit, ‚es‘ zu verstehen, aufgegeben und erklärt ‚es‘ mir nun, vor allen anderen. Der Rhythmus, auf den ich mich konzentriert habe, den ich präzise wiederzugeben versucht habe, spielt keine Rolle! Darum geht ‚es‘ nicht. Ich bin erstaunt. Bei einer Rassel muss es doch darum gehen! Für was sonst werden Rasseln verwendet? Sie dienen dem Rhythmus einer Musik, unterstreichen, heben hervor, betonen. Nein, offenbar nicht hier. Bei diesem Spiel ist unwichtig, wie die Rassel geschüttelt wird, nicht die Musik, die sie macht, ist das Entscheidende. Der Trick liegt darin, sie von der rechten in die linke Hand zu geben, bevor sie weitergereicht wird!
Ich bin mir verraten vorgekommen. Die Lehrerin hat auf etwas geschaut, das nichts mit der Rassel, der Musik, die sie macht, zu tun hat. Etwas, das ich nicht beachtet habe, dem ich keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Seither bin ich mir bewusst, dass ich anders bin, dass ich suche, eine Suchende bin. Ich versuche zu verstehen, worauf andere schauen. Oft fokussieren sie auf Kleinigkeiten, die mir unwichtig sind und doch bestimmen, ob ich dazugehöre oder nicht. Finden geschieht anders, aber das habe ich erst Jahre später gelernt.
Inhaltsverzeichnis
Zweiter Sonntag
Zweiter Montag
Zweiter Dienstag
Zweiter Mittwoch
Zweiter Donnerstag
Zweiter Freitag
Dritter Sonntag
Dritter Montag
Dritter Dienstag
Dritter Mittwoch
Dritter Donnerstag
Dritter Freitag
Dritter Samstag
Vierter Sonntag
Vierter Dienstag
Vierter Mittwoch
Vierter Freitag
Achter Montag, Juni
Achter Freitag, Juni
Neunter Mittwoch, Juni: Umzug
Vierzehnte Woche, Juli, hundert Tage
Achtzehnte Woche, August
Einundzwanzigste Woche, September, dreieinhalb
Dreiundzwanzigste Woche, September
Tag vor der Vernissage, Oktober
Tag nach der Vernissage, Oktober
Ein Monat nach der Vernissage, Mitte November
Jahreswechsel
März, zu Hause
April, Ostern
April, Ostermontag
Ende April / Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober und November
Dezember
Wieder Januar
Frühling im März
Zuversicht im April
Erfolg im Mai
Aufbruch im Juni
Ein Juli zu Hause
Normale Temperaturen für August & September &
Ein neuer November
Zweiter Sonntag
Ich sitze an deinem Krankenbett, versuche zu verstehen, was geschehen ist und was ich tun kann. Was ich sehe, macht mich hilflos. Worum geht es? «Vorwärtsschauen», haben sie gesagt. Wohin? Was soll ich sehen? Schaue ich auf dasselbe? Was machen meine Kindheitserinnerungen in einem Spitalzimmer? Seit einer Woche wache ich an deinem Bett. Du weißt nichts davon. Doch was sonst soll ich tun?
Das Telefon hat normal geläutet. Nicht lauter, nicht schriller und schon gar nicht dringlicher als sonst. Ich habe abgenommen, obwohl ich die Nummer nicht gekannt habe. Zum Glück bin ich guter Laune gewesen. Bei einer mir unbekannten Nummer nehme ich nur ab, wenn mir fröhlich zu Mut ist, wenn ich Lust dazu habe und neugierig bin. Keine unmögliche Kombination, aber auch nicht jederzeit der Fall.
«Spreche ich mit Frau Schlesig?»
«Ja.»
«Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Mann einen gravierenden Unfall hatte.»
«Was?»
«Einen Unfall. Er liegt im städtischen Krankenhaus auf der Unfallabteilung. Können Sie vorbeikommen?»
Natürlich! Ich habe meine Handtasche ergriffen und die Türe hinter mir abgeschlossen. Nach wenigen Metern bin ich nochmals umgekehrt, um sicherzugehen, dass die Kochplatte abgestellt ist. Dann bin ich los. Keine Ahnung, wie ich ins Spital gekommen bin. Seither sitze ich hier auf verschiedenen Stühlen, warte und wiederhole die Sätze des Telefonanrufes in meinen Gedanken. Eine ungewollte Endlosschleife, angetrieben von dem Versuch, mich an etwas Konkretes zu halten, mich an dem festzuhalten, was mir Orientierung gibt. Auf keinen Fall darf ich verändern, was gesagt wurde! « … Unfall, er liegt …» repetiere ich erneut. Und doch bin ich mittlerweile verunsichert, ob die Wiederholung des Satzfragmentes noch richtig ist. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Er ist in diesem Spital, Opfer eines gravierenden Unfalls. Das bleibt. Der Rest passt sich an, den Minuten, Stunden und Tagen, den Ärzten und Ärztinnen, dem Personal. Ich muss mich an die Unmessbarkeit des Wartens gewöhnen.
Die Zeit dehnt sich aus, fühlt sich länger an als sonst. Obwohl ich mich konzentriere, verflüchtigt sich ein Teil der Worte und Sätze, die ich festzuhalten versuche. Andere setzen sich ungefragt fest, türmen sich vor mir auf. Vor allem ein Wort erhält mehr Gewicht als alle anderen. Was bedeutet «gravierend»? Wie schlimm ist «gravierend»? Für mich hieß das erst einmal, in dieses Spital zu rennen und jemanden zu suchen, der mir überhaupt etwas sagt. Gleich am ersten Tag habe ich in deinem Büro angerufen, deine Partner und Kollegen informiert, ohne viel mehr zu wissen, als dass du hier liegst. Sie haben zusätzliche Fragen, andere als meine, die nun noch dazukommen. Auch für sie habe ich keine Antworten, verstärken ein Gefühl, dass ich mehr hätte herausfinden sollen. Sie täuschen sich. Es gibt vorerst nichts Weiteres zu erfahren, alles ist offen.
Es gilt, zu warten, die Geduld aufzubringen, an deinem Bett zu sitzen, Ruhe zu bewahren und vor allem, die vielen gut gemeinten Vorschläge über mich ergehen zu lassen, ohne mich aufzuregen. Was sollen sie sonst sagen? Wahrscheinlich wissen sie genauso wenig wie ich, was zu tun ist. Statt zu schweigen, ziehen sie vor, auf mich einzureden, um mit ihrer eigenen Rat- und Hilflosigkeit umzugehen. Was soll ich damit anfangen? Befremdend, um nicht zu sagen lächerlich – vielleicht passt das Wort hier nicht, aber mir kommt es am treffendsten vor –, dass sie mir Ratschläge geben, wenn sie selbst doch ratlos sind? Mehr als einmal kann ich ein schiefes Lächeln auf meinem Gesicht nicht verhindern. Sofort ziehen sie ihre Worte zurück, entschuldigen sich. Zumindest ein Anfang. Ein Anfang zu was?
Du, mein Ralf, sprichst nicht, liegst im Koma. «Bis auf Weiteres», haben sie gesagt. Ich weiß nicht, was «Weiteres» bedeutet. Ich sitze da und schaue dich an. Langsam wird mir bewusst: Wenn du nichts sagst, muss ich reden. Ausgerechnet ich, die seit Jahren aufgehört hat, sich sprachlich auszudrücken oder – zutreffender – die damit nie wirklich in Gang gekommen ist!
Hast du bemerkt, dass ich lieber zuhöre?
Ich bin nicht krank, auch nicht taub oder stumm. Meine Sprechmuskeln – Muskeln oder Bänder? – funktionieren bestens. Ich kann laut, ärgerlich, sanft oder klug reden, Sinnloses, Erstaunliches, Weises und vieles mehr aussprechen. Doch ich äußere mich selten und wenn, nur mit Vorsicht. Irgendwann, früh, habe ich aufgehört, etwas von mir über Worte preiszugeben. Ich bin Sprache gegenüber vorsichtig, zu erzählen hätte ich einiges. Und nun? Ich fühle ‚es‘ in mir aufsteigen, ‚es‘ holt mich an deinem Spitalbett ein, gegen meinen Willen. Ich sitze auf einem Stuhl, dessen Härte ich nicht mehr empfinde, bin gezwungen, Zeit verrinnen zu lassen. ‚Es‘ sind Erinnerungen, die endlich die Gelegenheit erhalten, über Sprache Form anzunehmen. Ohne Möglichkeit, sie abzuwehren, muss ich hinschauen.
Lirum, Larum Löffelstiel, wiederholt mein Kopf. Kann ich ‚es‘ diesmal? Verstehe ich, was von mir verlangt wird? Die Spitalumgebung verunsichert mich. Dein Zustand ist ungewiss und ich tappe im Dunkeln, was zu tun ist. … Wer das nicht kann, der kann nicht viel … Die Erinnerung an das Spiel hat auch etwas Tröstendes an sich. Die Erklärung einmal erhalten, verstanden worum ‚es‘ geht, dann wird das Kinderspiel einfach. Aber das hier ist kein Spiel. Wer wird mir des Rätsels Lösung sagen?
Ich muss mit dir reden, dir von mir erzählen, zwingend, unaufschiebbar. Geht ‚es‘ darum? Zahlreiche Gründe sprechen dagegen. Ich könnte ruhig abwarten, was weiter geschieht. Das würde zur Situation passen. Zuwarten kann ich gut, fast zu gut. Aber reden mit dir? Überraschenderweise fallen mir jetzt meine Schulaufsätze ein: eine Qual, in limitierter Zeit ein vorgegebenes Thema erörtern zu müssen. Wie viel Zeit habe ich hier mit dir, bis …? Schon eine Woche ist vorbei! Gut, einverstanden. Schlechte Erinnerungen an Schulaufsätze sind kein Argument. Immerhin kann ich die Themen, über die ich mit dir reden will, selbst wählen und der Zeitdruck fällt hier wohl weg. Soll ich dir jetzt von meiner Schulzeit erzählen? Geht ‚es‘ darum? Das erscheint kaum ein Thema für unsere Situation zu sein. Und doch …
Meine Aufsätze waren anfangs voller Fehler, in der Rechtschreibung, aber auch in grammatikalischer Art. Als Eindruck ist mir geblieben, dass in meinen Aufsatzheften mehr rote als blaue Schrift zu sehen war. Die Lehrerin hat meist unleserlich kommentiert, aber an die Bemerkung, dass ich mich bessern könne – mit Ausrufezeichen –, erinnere ich mich genau. Sie wird wissen, was für mich möglich ist, habe ich mir gedacht. Was sie nicht gewusst hat, ist, dass mir für vieles, was ich beschreiben wollte, die Worte gefehlt haben – nein, nicht nur gefehlt, die Worte haben schlicht nicht existiert! Also habe ich welche erfinden müssen. Kein Wunder, dass sie eine Menge angestrichen hat. Meine Aufsätze hatten viele, zu viele? , verschiedene Dimensionen, als dass sie sie hätte verstehen können.
Nach kurzer Zeit, habe ich den Dreh herausgefunden, um das Rot zu reduzieren, weniger Fehler zu machen. Ich habe mich sinnvollerweise den Normen der Rechtschreibung und Grammatik angepasst, weniger gerne die Dimensionen meiner Geschichten weggelassen, vereinfacht, für sie. Ein sinnvoller Entschluss, muss ich zugeben, meine Noten wurden besser.
Verstehst du …?
Was die Lehrerin zu den Inhalten gesagt hat? Sprunghaft, nicht durchdacht, könnte sich mehr Mühe geben, könnte mehr Zeit mit Nach- und Durchlesen verbringen … Verlorene Zeit für mich! Meine Worte sind mir immer passend erschienen, verständlich, wenn man sie nur verstehen will. Vielleicht nicht so, wie sie uns gelehrt wurden, nicht der Sprachnorm entsprechend angewendet, aber verständlich, wenn man nach dem Sinn dahinter sucht. Aufgeschrieben habe ich sie genauso, wie sie mir eingefallen sind. Ich habe sie immer schön und treffend gefunden, manchmal ungewohnt, manchmal neu, aber warum nicht mal andere Worte ausprobieren? Kaum ausgewählt, sind mir schon die nächsten eingefallen, ohne nachzudenken, sodass sich meine Geschichten immer vielschichtig entwickelt haben: Verschlungene Wege, weit ausholend in einer schillernden Welt, in der viele Winkel zu entdecken sind, wo Türen sich zu neuen, unerwarteten Zimmern öffnen. Durchlesen ist langweilig, Zeitverlust. Das Unerwartete, das Entdecken von Unbekanntem, das Verbinden von Ungewöhnlichem hat mich angezogen. Ich wollte mich überraschen lassen, anstatt nur zu beschreiben, was geschehen ist. Doch mein Erfindergeist ist nicht belohnt worden, die Inhaltsnote ist im roten Bereich geblieben. Meine Schlussfolgerung: Ich behalte meine fantastische, fantasiereiche, vernunftwidrige Welt für mich, so macht sich niemand darüber lustig und ich muss nicht erklären, was sie nicht verstehen können. Ja, auf diese Art habe ich lange gedacht, auch in Gesprächen mit dir, erst ein oder zwei Mal, danach öfters, bis ich auch dir nachgegeben habe. Und jetzt?
Als wir uns kennengelernt haben, war ich schon längst erwachsen geworden, Teil der Welt von geschultem, logischem und vor allem anerkanntem Wissen. Was mir oft als ödes, langweiliges Wiedergeben von Bekanntem erscheint, ist für die meisten ein Tummelplatz, auf dem sie sich unterhalten und davon überzeugt sind, sich zu verstehen. Ich höre zu, wundere mich nicht, dass Missverständnisse an der Tagesordnung sind. Streitereien darüber, wer Recht hat, finde ich uninteressant. Und manchmal geschieht auch Verständnis, eine Überraschung, dass jemand sieht, dass unter der Oberfläche eine Botschaft liegt. Und sie bewerten diese mehr als die fehlende Form.
Im Bericht zu meiner universitären Abschlussarbeit steht, dass sie zu viele Flüchtigkeitsfehler enthält. Das hat mich nicht weiter erstaunt. Allerdings hat mir der Professor in seinem Gutachten mangelhaften Quelleneinbezug angekreidet. Was er damit gemeint hat? Ich hätte mich von nur einem Ansatz begeistern und forttragen lassen, ohne diesen mit Hilfe anderer Theorien zu relativieren oder kritisch zu hinterfragen. Hat er sogar geschrieben, ich hätte noch andere Quellen einbeziehen ‚müssen‘? Das hingegen habe ich gar nicht im Sinn gehabt. Wenn ich ihm in Vorfeld bereits gesagt hätte, dass ich lediglich eine Sichtweise auswähle, hätte er sie womöglich nicht angenommen. Bewusst und etwas provozierend habe ich mich auf die damals aktuellste Publikation bezogen, die einen akademisch umstrittenen Ansatz verfolgt hat. Im Unterschied zu den anerkannten, uns in den Vorlesungen gelehrten Theorien, ist die Verfasserin das Wagnis eingegangen, eine teilweise populärwissenschaftliche Sichtweise in ihre Untersuchung zu integrieren. Etwas gefühlt Einleuchtendes, ohne empirisch ausgiebig gegengetestet zu sein. Das hat mir gefallen. Ich habe die Theorie zur akademisch vertretbaren Haupthypothese meiner Abschlussarbeit gemacht! Weshalb hätte ich sie hinterfragen, relativieren oder konkurrenzieren sollen? Sie hat das formuliert, was in diesen Tagen meinem Alltagsverständnis und -empfinden am nächsten gewesen ist. Nicht aber jenem unserer Professoren. Ich habe mir erlaubt, dasselbe zu tun, wie sie in ihren Vorlesungen: eine Theorie wählen und darum herum ihre Vorlesung aufbauen. Sie haben die traditionellen akademischen Erklärungsansätze bevorzugt und ich die innovative Sichtweise, um sie herauszufordern. Ich habe, trotz der als harsch empfundenen Kritik meines Professors, die zweitbeste Note erhalten! Ein bestätigender Lichtblick, an den ich mich erst jetzt wieder erinnere, nachdem er lange in meinen Erinnerungen vergraben gewesen ist. Unerwartet – und unlogisch für ein Spitalzimmer – hat er sich an die Oberfläche gedrängt. Was kommt als Nächstes?
Du bewegst dich nicht, die Maschinen atmen und du folgst ihnen. Die Erklärungen, die die Ärzte mir geben, sollen mich beruhigen, obgleich sie für Laien wie mich nicht verständlich sind. Mir bleibt nichts anderes, als ihnen zu glauben, dass sie das Richtige tun, um dir zu helfen. Ich verstehe nicht und doch folge ich ihren Anweisungen. Bei dir sitzen, anwesend sein, den Rest ihnen überlassen. Meine wenigen Ideen und Vorschläge, was dir helfen könnte, werden entgegengenommen, doch selten weiterverfolgt. Schnell habe ich eingesehen, dass sie hier lediglich medizinisch anerkannte Handlungen in Betracht ziehen. Allein stehe ich da, umgeben von versierten Einwänden. Ich bin in einer Welt gelandet, deren Sprache ich einmal mehr nicht spreche, die mich jedoch auf ein neues Terrain, das Terrain einer anderen Logik zwingt.
Ich kann dir zwar sagen, gib mir die Hand, aber nichts geschieht. Zögerlich greife ich nach ihr. Sie ist warm. Ich bin erleichtert. Ich habe mich gerne auf dein Terrain locken lassen. Bahnsteig Nummer 7 …
Erinnerst du dich?
Dort sind wir uns das erste Mal begegnet! 15 Jahre ist das her. Mit 26 habe ich schon lange nicht mehr an den Märchenprinzen geglaubt und getroffen haben wir uns nur, weil der Zug Verspätung gehabt hat. Du hättest ihn nämlich verpasst und damit auch mich. Alle Wartebänke auf dem Bahnsteig sind besetzt gewesen, die sporadischen Informationen aus den Lautsprechern unverständlich und verunsichernd. Niemand hat gewagt, wegzugehen, weil sich alle gefragt haben: Wann fährt der Zug endlich ab? Auch ich bin deshalb auf dem Bahnsteig geblieben, sonst wäre ich sicher in ein Restaurant gegangen. Noch lieber hätte ich die Fahrt gleich ganz verschoben, aber ich habe am nächsten Tag zu Hause einen Termin gehabt. Du bist mir gleich aufgefallen, weil du gehetzt und suchend um dich geblickt hast, während wir anderen bereits auf Warten und Ruhebewahren eingestellt waren. Suchend hast du dich umgeschaut und dich von allen Reisenden ausgerechnet an mich gewandt. Vielleicht, weil ich scheinbar gedankenverloren dagestanden habe? Dabei habe ich mit hellwachen Sinnen alles um mich herum, auch dich, wahrgenommen. Die Gleise habe ich angestarrt, um auf irgendetwas Neutrales zu schauen.
«Auf welchen Zug warten Sie?»
Verständnislos habe ich dich angesehen und mir gedacht: Was fragt er mich? Das steht doch auf der Abfahrtstafel geschrieben!
«Wo ist der Zug 721? Bereits weg?», hast du deine Frage variiert, wohl in der Hoffnung, dass ich jetzt verstehe.
«Nein, noch nicht angekommen.»
«Ich meine den Zug um 17 Uhr.»
«Ich auch. Noch nicht angekommen.»
«Dann bin ich ja gar nicht zu spät, das nenne ich Glück haben.»
Wenn ich mich in diesem Moment einfach abgewendet hätte, weitergegangen wäre, wären wir vielleicht nie ein Paar geworden. Dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, dann …
«Sie wissen immer noch nicht, wann er kommt. Kann gleich sein oder noch länger dauern. In den Durchsagen empfehlen sie, auf dem Bahnsteig zu bleiben», habe ich, etwas milder gestimmt als weitere Information hinzugefügt.
«Dann bleiben wir hier, danke. Ich habe mir noch die Zeit genommen, ein paar Pralinen für die Reise zu kaufen. Möchten Sie eine?»
So hat unsere Geschichte begonnen. Mit einem verspäteten Zug und Pralinen. Aus der angekündigten ersten Stunde wurden mindestens zwei und als der Zug endlich eintraf, waren alle Pralinen aufgegessen und wir ineinander verliebt. Ich würde dir jetzt gerne Pralinen anbieten, aber mit den Schläuchen im Gesicht könntest du sie nicht genießen. Ich greife erneut nach deiner Hand. Entschuldige meinen unpassenden Humor.
Damals hattest du mit deinen Partnern gerade euer eigenes Architekturbüro eröffnet. Das genaue Datum habe ich vergessen.
Tut mir leid.
Ich glaube, ein oder zwei Jahre bevor wir uns kennengelernt haben. Du bist voller Enthusiasmus gewesen, hast mich, aber auch deine Partner angesteckt mit deinen Ideen, jederzeit und überall. Ob mich eine Ausschreibung‚ eine Renovierung oder ein Ausbau interessieren, hat gar nicht zur Debatte gestanden. Sind wir zusammen durch die Stadt oder eine der umliegenden Gemeinden spaziert und an Bauprofilen vorbeigekommen, hast du sofort das Thema gewechselt. Du hast die Position und Dimensionen des geplanten Bauvorhabens kommentiert. Du hast mir beschrieben, was dir gelungen erscheint und was nicht. Im Gegensatz zu mir, hast du sofort visualisiert, wie das Gebäude aussehen wird und eigene Ideen dazu formuliert. Inspirierend und gedanklich leicht, dir zu folgen, dich zu verstehen. Bevor ich dich kennengelernt habe, hat mich Architektur wenig interessiert. Das Fachgebiet ist Neuland für mich gewesen, auf das du mich damals eingeladen hast. Neugierig bin ich dir auf dein Terrain gefolgt, begierig darauf, dich darin zu entdecken, immer mehr von dir zu erfahren. Du hast mich in deinen Bann gezogen – und du hast mir gefallen: groß, stattliche und doch schlanke Figur, blond, mit braunen, wachen Augen und feinen Händen. Schon am Bahnhof sind mir deine ausgesprochen langen Finger aufgefallen. Ich habe lange Finger immer sinnlich gefunden, sie sprechen für Feinfühligkeit und Tiefsinn. Das habe ich einmal gelesen. Wohl in einer Frauenzeitschrift, die erklärt, wie verschiedene Handtypen erkennen lassen, welcher Partner für sich am besten passt.
Ich schaue auf deine Hände. Sie sind unversehrt, immer noch schön, feingliedrig. Sie liegen scheinbar entspannt auf der Decke, nur die Kanülen stören das in sich friedliche Bild.
Du hast mir noch auf dem Bahnsteig viele Fragen gestellt. Woher ich komme, was ich tue, wo und wie ich wohne, alles sachlich-praktische Dinge, um dir von mir ein Bild machen zu können, nehme ich an. Du hast nichts gefragt, was ich nicht schnell und konkret beantworten konnte, keine indiskreten Fangfragen eingeflochten. Alles hat gepasst. Die Atmosphäre zwischen uns blieb entspannt und gleichzeitig lud sie sich auf. Glücklicherweise hast du alle Fragen, die du mir gestellt hast, auch gleich für dich beantwortet. Ich habe viel erfahren, ohne dich ein einziges Mal zu fragen. Wir sind den Bahnsteig rauf und runter spaziert, die Wartezeit wurde zur Nebensache. Bei jeder Ansage habe ich befürchtet, dass der Zug einfährt und wir uns trennen müssen. Erleichtert habe ich – haben wir, nehme ich immer noch an – bei dessen Einfahrt festgestellt, dass wir beide keinen Sitzplatz reserviert haben. Wir haben schnell zwei Plätze nebeneinander gefunden, sind nach Hause gefahren, in dieselbe Stadt und damals noch in zwei unterschiedliche Wohnungen. Nach zwei Monaten sind wir zusammengezogen, in meine größere Wohnung mit Platz genug für deine Möbel. Ich habe mich nur von einem Regal trennen müssen, alles andere hat deinen strengen Architekturdesign-Kriterien standgehalten. Mein Regal wegzugeben ist mir nicht leichtgefallen, aber die Freude darüber, mit dir unter einem Dach zu leben, hat mich mehr als entschädigt.
An deinem Krankenbett fällt nicht auf, dass meine Erinnerungen ohne jegliche Reihenfolge in mir hochsteigen, sich meine Gedanken zu überschlagen drohen. Die Aufmerksamkeit gilt dir, die Ärzte, Ärztinnen und Schwestern kümmern sich um dich. Ich bin froh darüber.
Ich hoffe und wünsche mir sehr, dass du bald wieder aufwachst, wieder sagen kannst, wie du behandelt werden möchtest. Du hast immer eine ziemlich präzise Vorstellung von allem. Ich fürchte mich ein wenig davor, entscheiden zu müssen, was für dich getan werden soll. Was weiß ich, was zu tun ist und was du möchtest? Ich frage mich, ob sich dein Schweigen, diese aufgezwungene Stille zwischen uns, allmählich zu einer Hülle entwickeln kann, in der ich mit dir in Sicherheit reden oder auch schweigen kann. Und in der du an dem, was ich zu erzählen habe, teilhast. Ich will dir meine Geschichte unseres Zusammenlebens darstellen.
Du musst verstehen, wovon ich rede. Ich werde meine Worte für dich suchen, einiges hervorgraben, damit das, was ich erlebt habe, für dich nachvollziehbar wird.
Die Türe geht auf. Eine der vielen mir noch unbekannten Krankenschwestern kommt herein, richtet ihre Augen sofort auf dich.
«Hat er sich bewegt?»
Ich schüttle den Kopf, bevor ich merke, dass sie mich gar nicht in ihrem Blickfeld hat.
«Nein, er liegt ruhig da», übersetze ich meine Bewegung in Worte.
«Gut. Sie können sich gerne ein wenig die Beine vertreten. Sie sehen sehr müde aus. Gehen Sie sich erholen, schlafen Sie einmal zu Hause ruhig durch.»
Ich schüttle wieder den Kopf, diesmal funktioniert die Kommunikation.
«Doch, Sie müssen. Gehen Sie sich duschen, ziehen Sie etwas Frisches an. Kommen Sie mit neuem Elan zurück.»
Ich schaue weg. Sie soll nicht sehen, dass ich mit den Tränen kämpfe.
«Ich kann nicht.»
Wie soll ich ihr erklären, dass, seit ich hier sitze, Erinnerung nach Erinnerung auftaucht, an mir vorbeizieht? Was bisher unausgesprochen geschlummert hat, beinahe schon vergessen gewesen ist, beginnt sich zu formulieren. Ich will nicht unterbrechen, was zwischen uns am Geschehen ist. Was, wenn morgen nicht mehr möglich ist, was heute gelingt? Undenkbar, ihr zu gestehen, dass du mir zuhörst, wie du mir noch nie zugehört hast. Das glaubt mir niemand! Jemand im Koma hört nicht zu, wird sie mir sagen. Falls ich Glück habe, wird sie mir zugestehen, dass du meine Anwesenheit mitbekommst. Sie wird mich daran erinnern, von zu Hause Gegenstände herzubringen, die dich an dein Leben erinnern, oder an unser gemeinsames. Was erinnert dich an uns? Erinnerst du dich an dieselben Dinge wie ich? Seit hier mein Nachdenken begonnen hat, tauchen fortwährend Dinge auf, die du nicht kennst, die du von mir nicht kennst. «Doch», wieder ihr fürsorgliches Insistieren. «Sie können, es wird Ihnen guttun. Höchst unwahrscheinlich, dass er in den nächsten Stunden aufwacht. Sie bewirken mehr, wenn Sie wieder erholt neben ihm sitzen. Ich werde die ganze Nacht hier sein und vorbeischauen. Machen Sie sich keine Sorgen.» Sie weiß ‚es‘. Sie spricht im Ton der selbstbewussten Medizin. Ein unbeschreiblicher Ton, der nicht vibriert, in dem keine Unsicherheit mitschwingt, dem man sich, wie von einem starken Magnet angezogen, nur anschließen kann. Er ist auch ohne Temperatur. Weder verbrennt man sich, noch erfriert man daran. Man folgt den Worten der Medizin, weil sie aufgeladen sind wie ein Elektrozaun, mit dem man nicht in Berührung kommen will, nachdem man einmal erfahren hat, wie schmerzhaft die Ladung ist, die man abbekommt.
Wie kann sie sicher sein, was dir guttut? Wie kann sie mit absoluter Überzeugung sprechen? Im Unterschied zu mir hegt die Krankenschwester keinen Zweifel daran, zu wissen, was du brauchst. Vielleicht liegt sie richtig, vielleicht auch nicht. Ich möchte ihr widersprechen, irgendetwas anderes behaupten. Sie und ich könnten anschließend darüber diskutieren, wer recht hat. Doch was ist ‚wahr‘? Ich streite nicht über den Wahrheitsgehalt von Ansichten und Meinungen.
Sie weiß auch, was für mich jetzt gut ist. Sie fragt mich nicht, sondern stellt klar, was zu tun ist. Ärgerlicherweise hat sie wahrscheinlich recht damit. Ich spüre nicht, ob ich eine Dusche brauche, aber ich brauche meine Zeit neben dir. Da ich weder Müdigkeit noch den Drang zu duschen empfinde, sieht sie, was ich in der jetzigen Situation nicht sehe. Achte ich wieder auf etwas anderes als auf das, was hier und jetzt angebracht ist? Um zu erfahren, ob sie Recht hat, werde ich tun, was sie vorschlägt. Ich stehe auf, gebe dir einen Kuss auf die Stirn und gehe zur Tür. Mein letzter Eindruck von diesem Tag ist, dass sie zufrieden ist.
Zweiter Montag
Seit 4 Uhr morgens bin ich wach. Meine Hand hat schlaftrunken auf die linke Seite gegriffen, ins Leere. Sofort bin ich hellwach gewesen und habe mich gefragt, wie es dir geht. Unruhe hat mich erfasst, ich habe aufstehen, mich zu dir auf den Weg machen müssen. Zum Glück gelten für mich die Rund-um-die-Uhr-Besuchszeiten. Sie hat übrigens recht gehabt. Ich fühle mich besser. Obwohl ich mich beeilen wollte, habe ich lange und warm geduscht. Der Wasserstrahl hat mich festgehalten, hat etwas Mildes versprochen, das ich unbedingt brauche, um die metallische Kälte und den medizinischen Duft in deinem Zimmer auszuhalten.
Ich habe die Straßenbahn bestiegen, wenn nicht die erste, so doch eine der ersten. Mehr Menschen als ich gedacht habe, sind zu derart früher Stunde bereits unterwegs. Für sie, im Unterschied zu mir, keine Ausnahmesituation. Jeden ihrer Arbeitstage kauern sie auf den Sitzen und fahren zur Arbeit. Noch verschlafen und ausdrucklos starren die meisten vor sich hin, beginnen einen weiteren Tag ihres Lebens. Woran sie wohl denken? Überlegen sie sich, was sie heute erwartet oder was gestern gewesen ist?
«Spital», tönt eine weibliche Stimme aus den Lautsprechern. Neutral, unbeteiligt, genauso wie sie ‚Bahnhof‘, oder ‚Strandbad‘ oder ‚Bibliothek‘ sagt. Für mich bedeutet ‚Spital‘ mehr. Die Ansage kündigt mein neues Leben an. Schon beim Aussteigen belastet mich erneut die Frage, nach deinem Gesundheitszustand. Noch zwei Stockwerke und ein langer Gang. Nichts hat sich verändert. Ist die Zeit hier auch weitergelaufen oder ist sie angehalten worden? Die Schläuche sind da, die Kanülen stecken, die Maschinen werfen Linien, Bilder und Zahlen in den Raum, egal ob sie jemand sieht oder nicht. Ich kämpfe mit einer Wut, die nicht weiß, gegen wen sie sich wenden soll. Ein sinnloses Auflehnen gegen etwas, das sich nicht darum kümmert, was ich dazu meine. Wie beim Weggehen küsse ich dich zur Begrüßung auf die Stirn und setze mich in meinen Stuhl. Wo sind wir verblieben?
Du gibst keine Antwort. Seit Tagen hilfst du mir nicht mehr, mich zurechtzufinden, überlässt mir weiterhin die Wahl, in welche Richtung unsere lautlosen Gespräche gehen. Wie oft habe ich mir gewünscht, meine Themen – die oft übergangenen – zu unseren zu machen. Doch nicht wie jetzt, nicht einseitig, nicht ohne die kleinste Resonanz.
«Hat er eine gute Nacht verbracht?»
Noch bevor sie die Türe ganz geöffnet hat, will ich beruhigt werden.
«Sie sind schon da? Haben Sie denn genügend geschlafen?»
«Ja.»
Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe nicht geträumt, keinen vieldeutigen, prophetischen Traum gehabt, der Trost und Zuversicht ausdrücken würde, sondern eine stille, dicht schwarze Nacht, ohne Erkenntnisse, ohne Gefühle, ohne Zeit. Wie könnte eine ausführlichere, längere und persönlichere Antwort dazu ausfallen? Was sagt sich über eine Nacht, die in einem Bett, allein und übermüdet, verbracht wurde? Mir ein Rätsel.
«Gut. Die Nacht ist ruhig verlaufen, wie erwartet. Heute werden wir nach Plan ein paar weitere Tests machen. Die Phy…»
Sie spricht.
Hörst du auch den Fluss von Fachausdrücken, die sie verwendet?
Sie fließen durch mich hindurch, nichts bleibt an mir haften. Was sie sagt, bleibt ein abstraktes Gebilde, unverständlich, löst in mir nichts aus, keine Bilder, keine Empfindungen, keine Regungen, nur eine Überlastung meines Intellekts, der diese Fremdsprache nicht gelernt hat. Und sie rufen ein Gefühl hervor: nicht zu genügen, nicht auf der erwarteten Höhe, nicht im selben Verständnisland zu sein. Müsste ich schnellstmöglich diese Sprache lernen, um einen Teil von Autonomie, Entscheidungskraft zurückzuerlangen?
Sie hantiert weiter an dir herum – entschuldige, dafür gibt keine besseren Worte. Noch während sie ihre Hände desinfiziert, um dann die Türe hinter sich zu schließen, wende ich mich erneut unserer Welt zu.
Fehle ich dir? Wie ist es dort, wo du bist?
Natürlich kann ich keine Antwort erhoffen, trotzdem. Seit wir uns kennen, bin ich neugierig, fast begierig darauf, zu erfahren, was dich beschäftigt. Deinen Reaktionen und Gedankengängen nahe zu sein, hilft meiner Orientierung. Doch du hast mir nicht immer Zugang zu dir gewährt, hast mich ausgeschlossen, verschwiegen, hast teilweise unwirsch reagiert, kurz, einsilbig. Umso mehr habe ich versucht, dir nahe zu bleiben. Erfolglos. Ich habe an mir gezweifelt, fühlte mich manchmal um meinen Beitrag zu deinem Leben betrogen.
Ganz am Anfang ist mir nicht aufgefallen, was damit einhergeht. Im Gegenteil, ich habe genossen, dass du mich in eine neue Welt entführt hast, habe zugehört und gestaunt. Du hast mir die Augen geöffnet für die Faszination der Technik, der Berechnungen, der Machbarkeit. Handfest, ohne Schnörkel, praktisch und logisch, immer lösungsorientiert, immer fokussiert auf das, was getan werden kann, keine Ambivalenzen, die sich nicht erklären lassen. Ihr Architekten stellt euch viele Fragen, ihr richtet sie immer an eine Sache, hinterfragt Dinge, um sie besser zu verstehen, besser zu machen. Den rein fachlichen Teil habe ich stets dir überlassen, er interessiert mich auch heute nicht. Hingegen bin ich regelrecht aufgeblüht, wenn die gestalterischen Aspekte diskutiert, der kreative Teil thematisiert wurde. Da habe ich mich zu Hause gefühlt.
Erinnerst du dich an unsere spannenden Gespräche über Ästhetik?
Bereichernd und offen, intensiv und vielseitig. Auch dein Freundeskreis hat mich aufgenommen, man hat mir zuhört, hat wissen wollen, was ich beizutragen habe. Begeistert war ich bereit, mich zu engagieren, mehr von euch zu erfahren, Ideen mit euch zu entwickeln. Weit über meinen Enthusiasmus hinaus sind wir gekommen. Wenn auch schleichend, lange sogar von mir unbemerkt und doch unaufhaltbar, bin ich von euch weggedriftet. Ich bin in einer Blase gelandet, in der man nur noch zuhört, verstummt. Ihr habt mich nicht aktiv ausgeschlossen oder gar beleidigt, das würdet ihr nie tun. Nach und nach ist passiert, was vielleicht vorhersehbar gewesen wäre: was ich gesagt habe, wurde nicht beachtet, nicht aufgenommen. Kommentarlos stehen gelassen, als sei gar nichts gesagt worden. Ausgewichen? Nein, das wäre ja eine Reaktion darauf gewesen! Ich fühlte mich ignoriert, als werfe ich einen Stein in einen See, der auf den Grund gesunken und verschwunden ist, ohne dass sich die Oberfläche bewegt hat. Der See ist glatt geblieben, als sei nichts geschehen. Das geht nicht? Doch, ihr habt nicht einmal bemerkt, dass ich versucht habe, eure Sprache, euer Vokabular zu benutzen, um eine Wirkung zu erzielen. Von euch beachtet zu werden, ist misslungen. Trotz aller Bemühungen haben mir ‚die intellektuellen Fußnoten‘ gefehlt. Meine Äußerungen sind nicht konform mit der Terminologie im Land der Architektur oder des Designs. Ich komme aus der künstlerischen Ecke, mit einem anderen Verständnis und eigener Sprache …
Du verstehst nicht, was intellektuelle Fußnoten sind, nicht wahr?
Ich nenne sie so, weil sie mich an Fußnoten in Texten erinnern, die auf Quellen, Bezugswerke, Theorien, kurz Fachwissen verweisen. Das Kleingedruckte zum besseren Verständnis, zur Angabe der Quelle, als Beweis der korrekten Wiedergabe, aber auch zur Absicherung und als Bezug zu bereits anerkannten Werken. Notwendig und wichtig für euch, für das Verständnis eines Textes oder eines theoretischen Beitrages, eine Vernetzung zu bereits Existierendem, Referenz an jemanden oder etwas. Meine Leidenschaft hingegen ist das Erschaffen von etwas Neuem, Kreieren aus dem Moment. Von mir kommen keine verbalen Fußnoten, die zeigen, dass ich mich intellektuell und wissenschaftlich fundiert in eurem Fach äußere. Das hat nicht gepasst und ich habe mich nicht angepasst, nicht anpassen können. Ich bin damit aufgefallen – und abgefallen …
Lustige Wortkombination, zwei unterschiedliche Vorsilben ergeben eine total andere und doch stimmige Bedeutung, sie fällt mir zum ersten Mal auf!
Obwohl ich generell Angst davor habe, aufzufallen, hat mich geschmerzt, ausgegrenzt zu werden, weit mehr noch das Überhört als das Nicht-verstanden-Werden. Mein Verstummen war in diesem Fall kein Aufgeben, sondern eine logische Reaktion.
Ist Dir aufgefallen, dass ich weniger und weniger mitdiskutiert habe?
Ich habe mich zurückgezogen, erst von den Gesprächen und dann von Euren Treffen.
Hast du überhaupt bemerkt, wie meine Beiträge von Euch übergangen wurden? Sind sie tatsächlich unangebracht oder sogar wertlos für Euch gewesen?
Umsonst hatte ich mich bemüht, meine Sichtweise beizutragen. Dabei wollte ich Dir helfen, unkonventionelle Lösungen zu finden. Mit meinem Wunsch, dir mit meinem Wissen zu helfen, gescheitert. Und wieder sitze ich da und trage nichts bei, wenn man von der Tatsache absieht, dass ich hier bin. Ob das genügt? Ob ich mir damit genüge?
Erlebst du in deinem Koma-Land dasselbe wie ich? Hast du gerade auch keine passenden Ausdrücke für das, was dich beschäftigt? Wenn du mir nur antworten könntest! Ich habe Fragen, die ich dir schon häufig stellen wollte, aber nie die treffenden Worte dafür gefunden habe.
Siehst du, jetzt sind sie da!
Und wenn du, wie so oft, ausweichen würdest? Nein, diesmal nicht. Oder doch? Was ist mit Worten zwischen uns möglich? Verstehen wir uns oder filtern wir nach unserem Geschmack, was wir hören? Zwei unterschiedliche Arten Gesprochenes aufzunehmen, ganz und gar nicht dasselbe, das habe ich in schmerzhafter Erinnerung …
Erfassest du, was ich damit sagen will? Erschrecke nicht gleich. Lass mich weiter erklären.
Wie sehr habe ich mir gewünscht, dass wir - wie jetzt - miteinander über alles gelassen und umfassend reden können. Wir gehören zusammen, daran zweifle ich nicht, grundsätzlich lieben wir uns. Aber ich denke nicht, dass wir das Beste daraus gemacht haben.
Das ist kein Vorwurf an dich, ich sage ‚wir‘.
Ich höre geradezu den ungehaltenen Tonfall in deiner Stimme, so als würdest du mit unwirschen Bewegungen ein paar Brosamen vom Tisch in deine hohle Hand wischen. Oder als würdest du genervt einige lose herumliegende Blätter auf deinem Pult einsammeln, sie locker in der Hand haltend zusammenschütteln, um sie diesmal schön ausgerichtet wieder hinzulegen, mit leicht verärgertem Gesicht.
Weshalb ich sage, dass wir nicht das Beste daraus gemacht haben?
Weil das mein Gefühl ist, wäre meine spontane Antwort. Aber ich gebe sie dir nicht. Dafür würde ich nur einen Blick erhalten, der mich in die schlüpfrigen Täler der Unsicherheit stürzen ließe, ohne Chance, die Wände hochzukommen, um auf sicherer Erde eine Erklärung zu geben.
Wie ich darauf komme? Möchtest du heute mehr darüber erfahren? Frag mich doch, was ich empfinde. Entschuldige, ich drehe mich im Kreis.