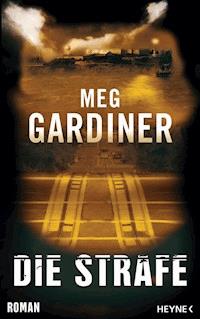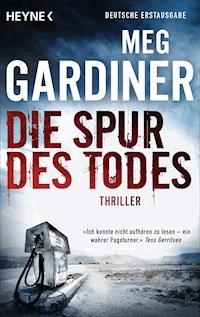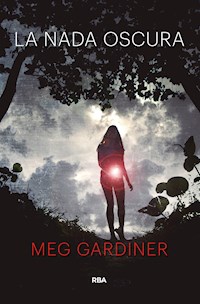Inhaltsverzeichnis
Widmung
KAPITEL I
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
Danksagung
Copyright
Für meinen Bruder Bill und meine Schwestern Sue und Sara
KAPITEL I
Später erinnerte sich Seth an kalte Luft und flammende Streifen am westlichen Himmel, an Musik in seinen Ohren und sein heftiges Atmen. Später verstand er, und dieses Verständnis steckte wie ein Stachel in seinem Gedächtnis. Er hatte sie nicht einmal kommen hören.
Der Weg durch den Golden Gate Park war von tiefen Furchen durchzogen, und er hatte beim Fahren die Kopfhörer aufgesetzt und die Lautstärke hochgedreht. Die Gitarre war im Rucksack über die Schultern geschnallt. Durch die Eukalyptusbäume flackerte tiefrot der Sonnenuntergang. Am Kennedy Drive hüpfte er mit dem Fahrrad über den Randstein, raste über die Straße und nahm die Abkürzung durch den Wald. Nur noch einen halben Kilometer bis nach Hause.
Er war spät dran. Aber wenn er Gas gab, schaffte er es vielleicht trotzdem vor seiner Mom nach Hause. Sein Atem dampfte durch die Luft. In seinen Ohren dröhnte die Musik. Fast hätte er Whiskeys Bellen überhört.
Er warf einen Blick über die Schulter. Fünfzig Meter hinter ihm stand der Hund stocksteif auf dem Weg. Schlitternd stoppte Seth. Er schob die Brille hoch, aber der Pfad lag im Schatten, und er konnte nicht erkennen, warum Whiskey bellte.
Er piff und winkte. »Hey, jetzt komm schon.«
Whiskey war ein großer Hund, zum Teil Irish Setter, zum Teil Golden Retriever. Und zum Teil Sofakissen. Dazu so lieb, dass es schon fast wehtat. Aber jetzt war sein Nackenfell gesträubt.
Wenn ihm Whiskey davonlief, brauchte er bestimmt ewig, um ihn wieder einzufangen. Dann kam er richtig zu spät. Doch Seth war fünfzehn – erst in einem Monat, na schön – und für Whiskey verantwortlich.
Wieder pfiff er. Whiskeys Blick huschte nur kurz zu ihm herüber. Der Hund war eindeutig beunruhigt.
Seth zupfte die Ohrstöpsel heraus. »Whiskey, jetzt komm endlich.«
Der Hund rührte sich nicht. Hinter dem Park auf der Fulton Street rauschte der Verkehr. In den Bäumen sangen Vögel, oben donnerte ein Flugzeug. Und er hörte Whiskey knurren.
Seth fuhr zu ihm zurück. Vielleicht ein Waschbär; Waschbären konnten selbst in San Francisco Tollwut haben.
Neben dem Hund stoppte er. »Hey, Junge, ganz ruhig.« Hinten auf dem Kennedy Drive wurde eine Autotür zugeschlagen. Das Knirschen von Stiefeln auf Blättern und Kiefernnadeln. Whiskey legte die Ohren an. Seth packte ihn am Halsband. Der Hund zitterte vor Anspannung.
Der Vogelgesang war verstummt.
»Bei Fuß.« Seth drehte sich um.
Zehn Schritt von ihm entfernt im Halbdunkel stand ein Mann. Die Überraschung prickelte hoch bis in Seths Haarspitzen.
Der kahlgeschorene Schädel des Mannes ging ohne Unterbrechung direkt in die Schultern über. Die Arme hingen an den Seiten herunter. Er sah aus wie eine Frankfurter, die den ganzen Tag gekocht worden war.
Er deutete mit dem Kinn auf Whiskey. »Ein echter Prachtkerl. Wie heißt er?«
Die Sonne war fast untergegangen. Warum trug der Typ eine Sonnenbrille?
Der Kerl schnippte mit den Fingern. »Komm zu mir, Hund.«
Seth hielt Whiskey am Halsband fest. Das Prickeln war jetzt überall, und hinter den Augen spürte er ein helles Klopfen. Was wollte der Typ?
Der Kerl neigte den Kopf. »Ich hab dich gefragt, wie er heißt, Seth.«
Hinter Seths Augen hämmerte es jetzt laut. Seth war schlaksig und hatte kupferfarbenes Haar, das abstand wie Stroh, und blassblaue Augen, die ideal waren für den strafenden Ausdruck, den seine Mutter als Tausendmeterblick bezeichnete. »Du siehst mich schon genauso an wie dein Vater«, sagte sie manchmal. »Warum immer ich?«
Seth umklammerte Whiskeys Halsband. Warum immer er? Warum, warum – o Scheiße, das hier hatte was mit seinem Dad zu tun.
Was wollte der Typ? Und wieso von ihm?
Los! Er hackte in die Pedale und zischte ab wie ein Windhund, im Neunziggradwinkel weg von dem Typen, direkt in den Wald.
»Whiskey, Fuß«, brüllte er.
Es gab keinen Pfad, nur holperigen Boden, der mit braunem Gras und Laub bedeckt war. Seine Hände krallten sich um den Lenker, und er strampelte mit einer Heftigkeit, die er seinen Beinen nicht zugetraut hätte. Seine Brille hüpfte auf der Nase. Die Ohrstöpsel flogen nach unten und prallten gegen den Rahmen. Blecherne Klänge waberten heraus.
Hinter ihm bellte Whiskey. Seth wagte es nicht, sich umzuschauen.
Der Kerl war nicht der Einzige. Whiskey hatte in Richtung Kennedy Drive geknurrt, und Seth hatte eine Autotür und Schritte auf dem Weg gehört. Er hatte das Gefühl, als hätte ihm jemand einen Apfel in die Kehle gerammt. Zwei Typen, die hinter ihm her waren.
Er musste Mom warnen.
Das Handy steckte in der Jeanstasche, aber solange er dahinraste wie ein Bekloppter, konnte er es nicht rausholen. Ein Wimmern stieg in ihm hoch. Er würgte es ab. Bloß nicht heulen. Die Bäume hatten sich verdunkelt, sie waren nicht mehr grün, sondern schwarz. Hundert Meter weiter vorn erspähte er durch die Zweige vorüberziehende Scheinwerfer auf der Fulton Street.
Er musste es nach Hause schaffen. Seine Mom – o Gott, wollten diese Typen vielleicht auch was von ihr?
Noch neunzig Meter bis zur Fulton. Weiße Lichter harkten durch die Bäume. Seine Hände krampften sich um die Griffe, die Beine brannten. Im Rucksack schaukelte die Gitarre auf und ab. Das Fahrrad ratterte über eine Wurzel. Seth hielt das Gleichgewicht, korrigierte und jagte weiter. Auf der Fulton waren bestimmt Leute. Die Scheinwerfer kamen näher.
Hinter ihm jaulte Whiskey.
Er blickte über die Schulter. Sein Hund hetzte ihm durchs Unterholz nach, der Kerl direkt hinter ihm.
»Whiskey, schnell!«, schrie Seth.
Obwohl seine Beine schon zitterten, keuchte er weiter auf die Straße zu, vorbei an einer alten Eiche.
Hinter der Eiche lauerte der zweite Mann.
Als Seth auf gleicher Höhe mit ihm war, fuhr er den Arm aus und packte die Gitarre am Hals. Seth wurde vom Fahrrad gerissen und flog mit ausgebreiteten Armen nach hinten. Krachend landete er auf dem Boden, die Gitarre unter sich. Die Saiten machten sproing, und der Korpus zerbrach. Seth japste nach Luft.
Der Kerl packte ihn. Er hatte eine graue Igelfrisur und war rechteckig wie ein Betonziegel. Alt, aber voller Pickel. Der Typ zerrte Seth auf die Füße.
Seth wand sich. Ein Kreischen brach aus ihm heraus: »Lass mich los!« Er fuchtelte mit der Faust und trat nach den Knien des Kerls.
»Beruhig dich.« Der Mann drehte Seth den Arm auf den Rücken.
Ein scharfer Schmerz schoss durch seinen Ellbogen. Der Typ stieß ihn in die Büsche.
Plötzlich war Whiskey da, ein knurrendes Paket aus Muskeln und Fell. Der Hund sprang den Typen an und bohrte ihm die Zähne ins Handgelenk. Der Kerl torkelte und ließ Seth los.
Die Brille schief auf der Nase, stolperte Seth durch die Bäume Richtung Fulton Street. Hinter sich hörte er wildes Bellen. Ein Schrei. Dann ein furchtbares Jaulen von Whiskey.
Noch vierzig Meter bis zur Straße. Whiskeys Heulen ging in leises Winseln über. Seth rannte weiter. Noch zwanzig Meter. Im Kopf hörte er seinen Dad: Ein Tier ist kein Grund zum Ausweichen. Wenn es auf der Straße um dich oder einen Hund geht, bist du derjenige, der überleben muss.
Das hier passierte wegen Dad, und er musste hier rauskommen, sonst wartete eine Welt voller Schmerzen und Angst auf ihn und seine Mutter.
Fünfzehn Meter. Er konnte die Straße sehen, Autos, den Gehsteig, die Querstraße von der Fulton weg. Seine Straße – sein Haus war einen Block weiter oben. Angestrengt versuchte er zu erkennen, ob der Wagen seiner Mom dort parkte.
Tatsächlich – in der Auffahrt stand jemand. Eine Frau – blasse Beine unter einem Rock. Langes, hellbraunes Haar.
Neue Energie schoss ihm in die Glieder. »Mom!«
Whiskey jaulte.
Seth zögerte. Whiskey hatte ihn gerettet. Er konnte den Hund nicht im Stich lassen. Er bückte sich nach einem Stein und wirbelte herum.
Der Glatzkopf rollte heran wie ein Expresszug. Bevor Seth zum Wurf ausholen konnte, duckte sich der Mann im Laufen und sprang ihn an.
Seth knallte so heftig auf den Boden, dass die Brille wegflog, aber den Stein ließ er nicht los. Er drosch ihn dem Typen auf den Kopf. »Scheiße, lass mich los!«
Der Glatzkopf packte Seths Hand und drückte sie zu Boden. Dann kam auch schon der andere Kerl angerannt; er schleifte Whiskey am Halsband hinter sich her. »Wie der Vater, echt.« Er drehte den Arm und inspizierte eine blutige Bisswunde. »Mistköter.«
Seth riss den Kopf zurück und brüllte. »Mom!«
Der Glatzkopf griff ihm ins Gesicht und versuchte, ihm mit Gewalt den Mund aufzudrücken und ihm ein Taschentuch als Knebel hineinzustopfen. Er blutete an der Stirn, wo ihn der Stein getroffen hatte. Seth presste eisern die Zähne aufeinander. Whiskey rappelte sich auf und bemühte sich, zu ihm zu gelangen. Der Typ kniff Seth brutal in die Nase. Seth trat nach ihm, um ihn an den Knien zu erwischen, doch im Vergleich zu diesem Kerl war er nur eine Heuschrecke. Als er den Mund öffnete, um nach Luft zu schnappen, wurde ihm das Taschentuch hinter die Zähne gerammt.
Der Mann packte Seth an den Haaren und lehnte sich nach unten, um ihm die Lippen ans Ohr zu drücken. »Ich tu dir weh, wenn du nicht aufhörst.« Er machte schmatzende Geräusche an Seths Haut. »Aber zuerst tu ich deinem Hund weh. Mit einem Schraubenzieher.«
Wie Wasser sickerte die Kraft aus Seth heraus. Auf seiner Brust lastete ein dunkles Gewicht, Tränen stiegen ihm in die Augen.
Der Mund unter der Sonnenbrille lächelte. Das Zahnfleisch glänzte feucht und rosa. Der Glatzkopf wandte sich an den pickeligen Typen. »Ruf an.«
Ohne Brille wirkte das Zwielicht trüb und verwaschen.
Der Pickelige hing an seinem Handy. »Kannst kommen.«
Der Glatzkopf wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. »Du weißt, worum’s hier geht?«
Vorn auf der Straße bremste ein schwarzer Lieferwagen mit quietschenden Reifen. Ein Mann sprang heraus und stakste auf den Wald zu. Ein magerer Weißer, der aussah wie ein Gangsterrapper. Oder wie die Darstellung eines Gangsterrappers auf MTV. Blaues Bandana um die Stirn, rollende Schultern, und aus der Tasche seiner Hängejeans baumelte eine Kette. Die Mickymausausgabe eines Zuhälters.
Der Glatzkopf beäugte ihn, als hätte er sich für einen Umzug maskiert. Hatte ihn offenbar als Schwachkopf einsortiert. Als gefährlichen Schwachkopf.
Dann wandte er sich wieder Seth zu. »Du weißt, wo dein Vater ist? Was er macht?«
Seth schwieg.
»Du kannst es dir aussuchen. Willst du, dass dir was passiert oder dass du verschwindest?« Er musterte Seths Gesicht und verzog den Mund erneut zu einem feuchten Lächeln. »Na also.« Er schaute die anderen an. »Ab mit ihm.«
KAPITEL 2
Der Wind pfiff über das Wasser. Chuck Lesniak rieb sich mit einem Taschentuch über den Nacken. Am Flussufer stand schulterhoch das grüne Gras. Es schwankte in der Brise und flüsterte ihm zu. Letzte Chance.
Der erste Offizier marschierte über den Kai und trug eine Kühlbox voller Bier zum Jetboot. Es war ein feuchter Märzabend, und dem ersten Offizier klebte das verblichene Manchester-United-Trikot am Rücken. Der Skipper des Jetboots trug Epauletten und eine Seekapitänsmütze mit goldener Borte, obwohl sie sich über tausend Kilometer weit im Landesinneren befanden. Er war ein gedrungener Sambier mit einem Lächeln so groß wie ein Straußenei.
Er winkte Lesniak zu. »Bitte kommen Sie an Bord.«
Er hatte einen starken Tonga-Akzent. Seine Herzlichkeit wirkte echt. Auf seinem Namensschild stand WALLY. Anscheinend konnte er Lesniaks Nervosität spüren. Chuck war der einzige Passagier bei dieser Fahrt auf dem Sambesi. Er hatte für einen Privatausflug zur Cocktailstunde bezahlt.
»Nur zu. Das Boot ist wirklich solide gebaut. Ich zeige es Ihnen. Der Motor hat dreihundertfünfzig PS und stammt von Chevrolet.«
Captain Wally deutete Lesniaks Nervosität falsch, aber das war ihm ganz recht. Er nickte. »Made in USA. Klingt beruhigend.«
Er ging an Bord. Das Deck schaukelte unter ihm, und das Fernglas schwang an dem Riemen um seinen Hals hin und her. Das auffrisierte Rennboot wurde Jetboot genannt, um die Touristen davon zu überzeugen, dass sie neben den gekühlten Getränken auch noch ein Extremsporterlebnis bekamen. Er tastete nach seiner Hosentasche, um sich zu vergewissern, dass das Fläschchen sicher verstaut war. Mehr an Flaschen brauchte er heute Abend nicht. Wieder fegte der Wind durchs Gras. Bald ist es so weit.
Der erste Offizier machte die Leinen los. Captain Wally warf den Motor an, der donnernd erwachte und Abgase ausspuckte. Er drückte den Gashebel und legte mühelos ab. Hinter dem Boot schäumte weißes Wasser.
Der Kapitän hob seine Stimme über das Gurgeln des Motors. »Bitte setzen Sie sich doch in den Bug, dort ist es kühler. Und nehmen Sie sich was zu trinken.«
Lesniak schob sich zur Spitze des Bootes und griff sich ein Bier aus der Kühlbox. Ein Bier konnte nicht schaden. War vielleicht sogar gut für die Nerven. Letzte Chance auf einen Volltreffer.
Er musste Ruhe bewahren. Wenn er das hier hinkriegte, hatte er ausgesorgt. Dann konnte er nach Kalifornien abhauen. Von Südafrika hatte er die Schnauze voll. Er war nur wegen der Firma nach Johannesburg gezogen, und jetzt war sein Job beim Teufel. Er schnaubte. Von wegen Job. Das war keine Arbeit, sondern ein Abenteuer mit Malaria-Garantie. Auf Chira-Sayf und die ganzen leuchtenden Versprechungen konnte er pfeifen. Er hatte sich nie an Südafrika gewöhnen können, auch wenn Jo’burg aussah wie Dallas, alle Leute irgendwie Englisch redeten und er einen Porsche fuhr und ein Haus mit Dienstmädchen, Koch, Wachhunden und Überwachungskameras auf den stacheldrahtgeschützten Mauern um seinen üppigen Garten hatte. Natürlich, er hatte gut verdient, einen Haufen Kohle im Vergleich zu dem, was ein Werkstofftechniker in den USA bekam. Bis der Chef den Stecker zog.
Das Boot beschleunigte in der dunstigen Luft. Über dem Wasser hing fett und rot die Sonne. Lesniak öffnete sein Castle Lager, legte den Kopf zurück und trank.
Das Bier war eiskalt. Ja, das hatte er sich verdient. Diese Erfrischung, diesen Deal. Die Flasche in seiner Tasche fühlte sich warm an.
Warum hatte der Chef das Projekt eingestellt? Darauf gab es nur eine sinnvolle Antwort: Er wollte sich damit eine goldene Nase verdienen. Scheiß auf die Angestellten, die dafür geschuftet hatten. Die konnte man rausschmeißen. Und die fetten Bonzen schoben die Kohle ein.
Genau, Alec Shepard hatte sich das Produkt und die Technologie unter den Nagel gerissen, um sie an irgendjemanden zu verhökern. So lief das eben bei den Reichen.
Der Fluss war riesig – gewunden, angeschwollen, fast einen Kilometer breit. Jetzt, während die Sonne immer tiefer sank, wirkte das Wasser fast violett. Er blickte auf die Uhr. Zehn Minuten bis zum Treffen.
Er war erst seit einem knappen Tag hier, nachdem er von Jo’burg nach Lusaka geflogen und von dort mit dem Bus ins Touristenzentrum Livingstone gefahren war. Die Nacht hatte er in einer Fünfsternelodge am Fluss verbracht, ohne die angebotenen Freizeitaktivitäten zu beachten: Safaris, afrikanische Tanzdarbietungen, Wildwasserrafting unter den Victoriafällen. Er hatte nur in seinem klimatisierten Zimmer gesessen und sich auf dem Sportsender ESPN das Basketballspiel zwischen Kentucky und UCLA angeguckt. Bei geschlossenen Jalousien. Selbst fünfzehntausend Kilometer von Kalifornien entfernt, mitten im südlichen Afrika, konnte er die Paranoia nicht ablegen.
Wenn man bei einem Deal den Vermittler ausbooten will, hat man am besten Augen im Hinterkopf.
Seine Kontaktleute hatten diesen Ort aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens waren der Livingstone- und der Mosi-oa-Tunya-Nationalpark voller europäischer Touristen, da fielen zwei weitere weiße Gesichter nicht auf. Zweitens war der Ort hervorragend geeignet, um etwas über die Grenze zu schmuggeln.
Er hatte es doch schon fast geschafft. Hatte die Flasche aus dem Labor und dann aus Südafrika herausgebracht. Fehlte nur noch die Übergabe. Und die durfte er auf keinen Fall vermasseln.
Plötzlich brach ihm der Schweiß aus. Er war massig gebaut, und die Hitze setzte ihm ziemlich zu. Er wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn und trank das Castle in einem Zug leer. Entspann dich. Wenn es so weit war, durfte er nicht aussehen wie halb durchgeknallt. Damit würde er sich nicht nur als Amateur präsentieren, sondern auch als leichtes Opfer.
Der Fluss kräuselte sich silbern im Wind. Er setzte das Fernglas an und suchte das südliche Ufer ab. Dort, vor dem Schilf, schaukelte ein Kanu im Wasser. Einheimische beim Angeln. Flussaufwärts ein Pontonboot auf einer abendlichen Sauftour mit sonnenverbrannten Holländern und Japanern. Reiche Leute, die wahrscheinlich im Victoria Falls Hotel drüben in Simbabwe wohnten. Das schöne, das gruslige Simbabwe, zerstört durch Gier und egoistische Grausamkeit. Kaputtgemacht durch – wie hieß es so schön? Intrigen.
Auch seine Zukunft wäre um ein Haar von Intrigen ruiniert worden. Er war schlau, das sagten alle. Jeden Morgen vor dem Spiegel hatte er sich eingehämmert: Du bist schlau, du bist wichtig. Das Projekt war wichtig. Es abzuwürgen war kriminell.
Aber nicht mit ihm. Die Arbeit der Firma durfte nicht einfach in einem schwarzen Loch verschwinden. Er würde dafür sorgen, dass sie in die Hände von Leuten gelangte, die etwas damit anfangen konnten. Seine Bezahlung war ein angemessenes Dankeschön für gute Dienste.
Und die Übergabe in einem zerstörten Land war die Gewähr dafür, dass niemand in der industrialisierten Welt etwas davon mitbekam.
Die Sonne glitzerte auf dem Wasser. Der Fluss schimmerte wie eine Quecksilberbahn, die sich durch die weite grüne Ebene ergoss. Was stand in dem Hotelprospekt? Wenn der Fluss Hochwasser führte so wie jetzt, rauschten jede Minute sechshundert Millionen Liter über die Victoriafälle. Unglaublich.
Lesniak zog noch ein Bier aus der Kühlbox. Er musste ruhig bleiben und zeigen, dass er den Mumm hatte, das hier durchzuziehen. Als er das Bier aufmachen wollte, klackerte der Flaschenöffner gegen das Glas. Vielleicht war es der große Chevy-Motor, der so vibrierte. Nein, eher nicht.
In weitem Bogen lenkte Captain Wally das Boot zur Flussmitte. Von einer Insel weiter vorn flogen Reiher auf, die sich blendend weiß von dem violetten Wasser und dem grünen Ufer abhoben. Der Himmel über ihm war keramikblau.
Hier wurden die meisten Touristen vollgeschwafelt: Schauen Sie, ein Nilpferd. Sehen Sie den Baumstamm da drüben? Das ist kein Baumstamm, sondern ein Krokodil. Aber Lesniak hatte darauf bestanden, nicht angesprochen zu werden. Dafür hatte er bezahlt.
Und noch etwas draufgelegt für den kleinen Zwischenstopp. Wieder schielte er auf die Uhr. In zwei Minuten sollten sie die Grenze nach Simbabwe überqueren. Er trank die Flasche halb leer und machte sich bereit.
Ja, er hatte die richtige Entscheidung getroffen. Diese Sache war wichtig. Letzte Chance.
Während sie über das Wasser schnellten, glitt sein Blick über dichtes Gras, Akazienbäume und einen dünnen Sandstreifen am Ufer. Flussabwärts raste ein anderes Jetboot in ihre Richtung.
Eigentlich sogar direkt auf sie zu. Captain Wally ging vom Gas.
Mit einem Stirnrunzeln schaute Lesniak über die Schulter. »Was ist los?«
Captain Wally lächelte. »Mein Cousin. Er hat sich letzte Woche sechzig Liter Sprit geborgt. Die will er mir jetzt zurückgeben.«
Das andere Boot beschrieb eine lange Kurve und zog eine weiße Rinne über den Fluss. Dann drosselte es seine Fahrt und legte sich tief ins Wasser. Der Skipper winkte träge. Im Bug hockte ein Passagier mit Baseballmütze, die Arme verschränkt, eine Angel an der Seite. Er spähte zum südlichen Ufer, ohne sich von dieser Unterbrechung stören zu lassen. Ganz nach dem Motto: Wir sind hier in Afrika, da muss man sich anpassen. Das Boot schob sich längsseits, und der Skipper rief etwas auf Tonga. Captain Wally lachte. Lesniak nahm das Fernglas hoch und suchte wieder das Ufer ab. Wo blieb sein Kontaktmann?
Das Boot schaukelte, und aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Captain Wallys erster Offizier aufs andere Boot sprang, um die Benzinkanister zu holen. Er drehte an der Einstellung des Fernglases. Da – ein Stück weiter vorn schob sich ein Nissan Pathfinder hinunter zum Wasser. Sein Herz begann zu hämmern wie ein Schlagbohrer.
Der Pathfinder war schlammverschmiert und hatte simbabwische Nummernschilder. Enttäuschung beschlich ihn. Aber was hatte er denn erwartet? Diplomatenkennzeichen? Einen Plüschwürfel mit Geheimdienstlogo, der am Rückspiegel baumelte?
Irgendwas. Er hatte sich einen Hinweis darauf erhofft, für wen sein Kontaktmann arbeitete. Amerikaner, Europäer, Israelis oder Leute aus dem Osten.
Wieder schwankte das Boot und erzitterte, als Füße auf dem Deck landeten. Die Tonga-Unterhaltung wurde fortgesetzt. Vergiss den Familientratsch, Skipper. Wir müssen weiter.
Schließlich heulte der Motor auf, und der Bug hob sich, als sich das Boot rasch von Captain Wallys Cousin entfernte. Es fuhr direkt in der Mitte des gewaltigen Flusses.
Lesniak wandte sich um. »Steuern Sie zum Ufer, da wo der …«
Knatternd zerrte der Wind an Lesniaks Hemd. Der Motor knurrte tief und schmutzig. Das Boot hüpfte übers Wasser.
Captain Wally war nicht mehr am Steuer. Er war überhaupt nicht mehr an Bord. Er und sein Offizier befanden sich auf dem Jetboot des Cousins, das schon fast in der Ferne verschwunden war.
Am Steuer stand der Passagier des Cousins.
Lesniak umklammerte sein Bier. Die Flasche war klebrig. Seine ganze Hand klebte.
»Sie?«
Der Mann trug Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine noch schwärzere Sonnenbrille. Im blendenden Licht des Sonnenuntergangs war nicht zu erkennen, wohin er schaute. Oder ob er überhaupt Augen hatte. Er war hager und fit, der Mund lief als grimmiger Strich quer über das sonnenverbrannte Gesicht. Er hatte die Baseballmütze abgenommen, und sein Haar glitzerte kupferfarben.
Wie ein Pfeil schoss das Boot über den angeschwollenen Fluss. Wind und Gischt ließen den Schweiß auf Lesniaks Rücken erkalten. Das südliche Ufer wich immer weiter zurück. Der Nissan Pathfinder sauste vorbei. Letzte Chance.
»Wo wollen Sie hin?«, fragte Lesniak.
Der Mann hielt den Gashebel gleichmäßig gedrückt. Langsam wandte er den Kopf, bis die Sonnenbrille auf eine Stelle zwischen Lesniaks Augen zu zielen schien.
Die Bierflasche entglitt Lesniaks Fingern und rollte klirrend über das Deck. »Ich kann alles erklären.«
Der Mann warf das Steuer herum und hielt auf eine Gruppe kleiner Inseln zu. Sie ließen den offenen Strom hinter sich und glitten in einen schmalen Kanal zwischen Inseln mit dichten Bäumen. Wie riesige Blüten hingen die Reiher in den Ästen. Der Mann schaltete den Motor herunter, und das Boot legte sich tiefer ins Wasser.
Er starrte Lesniak an. »Geben Sie es mir.«
Lesniak schnaufte schwer. Von allen Seiten rückten weiße Flügel in sein Blickfeld. Der Gestank nach Vogelkot traf ihn mit solcher Wucht, dass er würgen musste. »Keine Ahnung, wovon Sie reden.«
»Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Geben Sie’s mir.«
Lesniak wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. Er spürte, wie ihn Mut und Selbstvertrauen verließen.
Er hatte sich nie die Mühe gemacht, nach dem Namen dieses Mannes zu fragen. Er kannte ihn einfach nur als Rusty – wegen der roten Haare. So nannten ihn alle: Rusty, der Schäferhund. Der Aufpasser. Der Babysitter. Ein besserer Laufbursche, der immer aufkreuzte, wenn die hohen Tiere kamen. Der nichtsnutzige Verwandte von irgendjemandem, der als Betreuer von Managern und Technikfuzzis bei Firmenrundreisen eine ruhige Kugel schob. Jedenfalls hatte Lesniak das gehört.
Irrtum. Dieser Typ war kein Kindermädchen. Warum war Lesniak nie aufgefallen, dass das ein total abgebrühter Scheißkerl war? »Ich hab es nicht.«
»Der Wachmann im Labor hat geredet. Ich weiß, dass Sie es genommen haben.«
Das Boot schwankte in der Strömung. Rusty der Schäferhund drehte am Rad, damit das Boot weiter flussabwärts steuerte.
»Wer hat Sie geschickt?«
In den Bäumen plusterten sich die Vögel auf. Überall weiße Flügel, leere Augen, immer auf der Hut, ohne ihn anzuschauen. Zu seinem Entsetzen bemerkte Lesniak, dass sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen. Schluss damit. Du siehst aus wie ein Trottel. Reflexartig fuhr seine linke Hand zur Tasche seiner Khakihose und befühlte die Konturen der Flasche. Er konnte nicht aufhören zu grinsen. Hätte er aufgehört, wäre er in Tränen ausgebrochen.
Das war seine Chance. Nur dank seiner Anstrengungen hatte er es mit dem Stoff hierhergeschafft. Er hatte sich was einfallen lassen und war das Risiko eingegangen. Da konnte er jetzt nicht einfach klein beigeben.
Das Boot schlüpfte unter gierigen Ästen hindurch. Die Luft war schwül, es roch furchtbar. Durch das Dröhnen des Chevy-Motors hörte er ein Rauschen. Vielleicht sein eigenes Blut, das versuchte, aus den Adern zu flüchten.
»Wer ist Ihr Auftraggeber?«, fragte der Schäferhund.
Hier war Umsicht geboten. Er räusperte sich. »Machen Sie mir ein Angebot.«
Rustys Brille spiegelte den Sonnenuntergang nicht wider. Sie war völlig dunkel, kohlschwarz, zwei Löcher ins Nichts. Er sprach betont langsam. »Sie haben mir großes Leid zugefügt. Also sagen Sie mir einfach, wer Ihr Auftraggeber ist, und geben Sie es mir.«
»Was?« Lesniak stutzte. Großes Leid? So verhandelte man doch nicht. »Im Ernst, machen Sie mir ein Angebot. Ich bin flexibel.«
Rusty gab wieder Gas und drehte das Steuer gemächlich nach rechts. Sie ließen die Vogelinseln hinter sich und schoben sich wieder hinaus in die Flussmitte. O Gott. In den Touristenprospekten konnte man lesen, dass der Sambesi an dieser Stelle eineinhalb Kilometer breit war, aber er hatte sich nicht vorstellen können, was das bedeutete. Das Rauschen war noch lauter geworden. Und es war definitiv nicht sein Blut. Es waren Millionen Tonnen von Wasser, die weiter vorn nach einer Biegung über die Felsen donnerten.
Der Wind scheuerte wie eine Käsereibe über Lesniaks Gesicht. Er wischte sich über die Oberlippe. »Ein Angebot. Ich bin ganz offen. Was ich habe, ist unvermischt. Rein. Beste Qualität …«
Rusty beugte sich vor. Griff er nach einem Bier? Vielleicht war das alles nur ein Witz.
Als er wieder auftauchte, hatte er ein Jagdgewehr in der Hand.
Natürlich. Im Hotel posierten Mädels im Bikini am Pool, und beflissene Kellner servierten den Gästen Drinks mit rosa Schirmchen. Aber hier draußen hatte jeder Fremdenführer und jede Großmutter ein Jagdgewehr dabei, weil sie mitten durch den afrikanischen Busch fuhren und auf beiden Uferseiten ein gottverdammter Wildpark begann.
Wieso musste ausgerechnet ihm so was passieren? Er war ein Spitzentechniker mit einem erstklassigen Abschluss an der DeVry University. Er spielte im Softballteam der Firma. Er war ein ganz normaler Kalifornier, der nichts weiter wollte als einen BMW, ein Haus in Los Gatos und ein bisschen Anerkennung. Und eine echte Chance.
Rusty zielte mit dem Lauf auf Lesniaks Brust. »Sie geben es mir jetzt, und dann verraten Sie mir, wer hinter dem Ganzen steckt.«
Ein Schäferhund, der sich gegen die Herde wandte.
Plötzlich begann es Lesniak am ganzen Körper zu jucken. Er fühlte sich nackt. Starrte in die Mündung, die auf seinen fülligen, schwitzenden Bauch deutete. Sag was. Sei ein Mann. »Oder?«
»Oder Sie geben es mir.« Rustys Gesicht blieb ausdruckslos. »Wobei ›geben‹ eher locker definiert ist. Freiwillig oder unfreiwillig – das liegt ganz bei Ihnen.«
»Sie können mich nicht umbringen. Captain Wally hat Sie gesehen, sein erster Offizier und sein Cousin auch. Das sind alles Zeugen.«
Der Lauf rührte sich nicht.
Die erste Andeutung eines Wimmerns wehte durch Lesniaks Kehle. Rusty hatte sie geschmiert. Natürlich. Die Sambier verdienten doch höchstens zwei Dollar am Tag. Wahrscheinlich hatte er sie für den Preis eines Big Mac gekauft.
Und niemand wusste, dass Lesniak hier war. Den Leuten von der Firma hatte er erzählt, dass er noch einen Kurzurlaub in London einschieben wollte, bevor er in die Bay Area zurückkehrte. Auch im Hotel heute hatte er niemandem etwas von seinem geplanten Bootsausflug verraten. Und Captain Wally hatte er einen falschen Namen genannt.
Es würde Wochen dauern, bis man ihn vermisste.
In der Ferne schwoll das Rauschen des Wassers zu einem Donnern an. Lesniak spähte flussabwärts. Hinter einer baumgesäumten Biegung hingen Dunstschwaden in der Luft, so dicht, dass sie den Blick verstellten. Dafür herrschte in seinem Kopf schlagartig Klarheit.
Rusty war hier, um die Flasche an sich zu bringen. Vielleicht für sich, vielleicht für den Firmenchef, vielleicht für eine der Gruppen, die jeden Preis zahlen würden, um an ihren Inhalt zu gelangen.
Ob Rusty ihn erschoss, bevor er ihm die Flasche abnahm oder danach, spielte keine Rolle. Der Mann wollte ihn auf jeden Fall umlegen.
Lesniak tat einen taumelnden Schritt zur Seite und sprang über Bord.
Er landete schmerzhaft auf dem Bauch. Das Wasser umfing ihn, als hätte ihn ein Drache verschluckt. Die Strömung packte ihn und zerrte ihn in einem Tempo mit, das er nie für möglich gehalten hätte. Reflexartig öffnete er die Augen und sah blaue Finsternis. Mit wilden Bewegungen ruderte er nach oben und tauchte auf. Schnappte nach Luft.
Der vom Sommerregen angeschwollene Fluss rollte ihn hin und her, als wäre er ein Dorn in der eisigen Haut des Drachens. Das Ufer war nur noch ein ferner Streifen aus grünem Gras. Heftig um sich schlagend, kämpfte er darum, nicht in den Fluten zu versinken, die ihn gnadenlos mit sich rissen.
Zehn Meter links von ihm hielt das Boot mit ihm Schritt.
Verdammt. Er trat um sich und spürte, wie die Flasche an sein Bein stieß. Kleider und Schuhe zogen ihn abwärts. Das Boot glitt heran.
»Geben Sie mir die Hand«, rief Rusty.
»Nicht schießen.« Eine Welle hob ihn hoch, und er erkannte eine Gruppe winziger Inseln. Bis zum Rand dicht mit Bäumen bewachsen, deren Äste in den Fluss hingen.
»Die Hand!«
Wenn er es bis unter die tief hängenden Äste schaffte, konnte ihn Rusty nicht mehr erreichen. »Wenn Sie schießen, geht die Flasche mit mir unter«, gurgelte er.
»Wenn Sie tot sind, treiben Sie erst mal eine Weile. Auf jeden Fall lang genug, dass ich Ihre Leiche bergen kann. Ob lebendig oder tot, Sie geben mir das Zeug. Was ist Ihnen lieber?«
Ein Schluchzen drang aus Lesniaks Mund.
»Hören Sie. Ich tausche. Ich krieg das Zeug, Sie kriegen das Jetboot.«
Lesniak drosch um sich. Immer wieder verdeckten ihm die schaukelnden Wogen den Blick auf die Inseln. Zu den Bäumen, ja. Dort konnte er sich verstecken.
Seine Arme waren bleischwer, die Lunge brannte, Wasser schwappte ihm in den Mund. Hustend spähte er nach vorn, sah Wellen, Äste, einen Baumstamm. Die Inseln kamen näher.
Plötzlich zuckte der Baumstamm mit dem Schwanz.
Er kreischte. Der Adrenalinstoß war so heftig, dass der Sonnenuntergang weiß aufstrahlte. Der Schwanz peitschte zurück. Das Krokodil schwamm direkt vor ihm. O Gott, o Gott …
Wimmernd warf er sich herum. Der Fluss schob ihn auf das Reptil zu.
Dann war das Boot wieder neben ihm. Rusty brüllte: »Los, an Bord, schnell.«
Lesniak haschte nach dem Rumpf, doch seine Hände rutschten ab. Hysterie stieg in ihm auf. In seinen Ohren vermischten sich Motordröhnen, Wasserrauschen und panisches Schluchzen. Wieder scharrte er über das glitschige Fiberglas. Er versuchte, die Fingernägel in die nasse Bootsseite zu schlagen.
Da wurde er am Handgelenk gepackt. Rusty zerrte ihn hoch.
Lesniaks Beine schleiften im Wasser. Er klammerte sich an Rustys Unterarm. »Ziehen Sie mich raus! Ziehen Sie mich raus!«
Rusty ächzte vor Anstrengung. »Halten Sie sich am Bootsrand fest, nicht an mir.«
Wild um sich tretend, grub Lesniak Rusty die Nägel in den Arm. »Lassen Sie mich nicht los. Das Kro…«
Rusty zog und riss an ihm, bis er Lesniak halb aus dem Wasser hatte. Lesniaks Füße schlackerten herum. Verzweifelt blickte er auf und sah das Blut an Rustys Unterarm, wo er sich an ihm festgekrallt hatte.
O Mann. Rusty war nicht groß genug, um ihn an Bord zu hieven. Lesniak war locker zwanzig Kilo schwerer als er. Sein Schnaufen wurde heftiger. Seine Füße hingen noch immer im Wasser und … o Gott, das Krokodil!
Das Boot schlingerte und fing an, sich zu drehen. Rusty rutschte über das glitschige Deck auf ihn zu. Schreiend versuchte Lesniak, Rustys Arm hinaufzuklettern.
Rusty stöhnte. »Lassen Sie meinen Arm los, halten Sie sich am Rand fest, damit ich Sie …«
»Hilfe!«, kreischte Lesniak.
Rusty packte ihn am Gürtel. Lesniak spürte, wie er hochgewuchtet wurde, bis er mit den Hüften an den Bootsrand stieß. Hilflos trat er um sich, um irgendwie beide Füße aus dem Wasser zu kriegen. Das träge rotierende Boot hob und senkte sich mit der Strömung. Er griff nach Rusty und versuchte, sich an seinem Hemd festzuklammern. Doch seine Hand glitt ab und schlug dem Mann die Sonnenbrille vom Gesicht. Er musste aus dem Wasser. Er merkte, dass er laut heulte, konnte aber nicht damit aufhören.
Rusty ächzte. »Halten Sie endlich still, sonst ziehen Sie mich auch noch rein, und wir ersaufen beide.«
Lesniak gelang es, ein Knie über die Kante zu schieben. Dafür sackten seine Schultern zurück zum Wasserspiegel. In seinem rechten Fuß war ein merkwürdiges Prickeln. Das Krokodil, o Gott, das Maul die Zähne grausame Qualen … Er rutschte wieder ab. Rusty griff nach ihm und bekam seine Hosentasche zu fassen.
Die Tasche riss auf. Die Flasche fiel heraus und landete auf dem Deck.
Lesniak starrte sie an. Gemächlich kreiselte das Boot unter ihnen. Die Flasche schimmerte im letzten Sonnenschein. Am Schraubverschluss bemerkte er Blasen.
Mist.
Um den Deckelrand der Flasche schäumte es. Sie war nicht mehr dicht.
Das Boot schwankte, und die Flasche schlitterte über das Deck. Nein, nein – bei der nächsten hohen Welle konnte sie von Bord gespült werden. Lesniak ließ Rustys Arm los und langte danach. Von der Flasche hing seine Zukunft ab, sie war das einzig Wichtige für ihn, seine verdammte letzte Chance und …
»Ich kann Sie nicht halten«, brüllte Rusty. »Klammern Sie sich am Bootsrand fest.«
Das hättest du wohl gern. Vergiss es. Wenn er das tat, schnappte Rusty sich die Flasche, und er ging leer aus. Alle würden erfahren, was er getan hatte, und …
Die Flasche glitzerte. Mit letzter Kraft streckte er sich danach aus.
Plötzlich ruckte das Boot zur Seite. Lesniak verlor den Halt und stürzte wie ein Sandsack ins Wasser.
Die Strömung riss ihn mit. Prustend tauchte er auf und wandte sich zurück. Er trieb schnell dahin, die kleine Inselkette lag bereits hinter ihm. In seinen Ohren hing ein lautes Tosen. Nicht der Motor, sondern das Wasser, das in riesigen Mengen über die Felsen schoss.
Auf dem Boot griff Rusty nach der Flasche. Der Drall des Bootes brachte ihn ins Wanken, doch er schraubte den schäumenden Verschluss schnell wieder zu und schob das Ding in die Hintertasche seiner Jeans.
Benommen schaute ihm Lesniak zu. Mühsam kämpfte sich Rusty zurück zum Ruder des Schnellboots. Er wischte sich den blutigen Arm am Hemd ab, riss das Rad herum und steuerte flussabwärts. Schnell. Direkt auf ihn zu.
Verdammt, nein. Mit diesem mächtigen Chevy-Motor und einem Fiberglasrumpf, der ihm den Schädel zerdrücken würde wie eine Teetasse. Lesniak machte kehrt und paddelte wie ein Wahnsinniger, um dem Boot zu entkommen. Das Wasser spülte ihn mit.
Rusty rief ihm etwas zu. Er verstand nur »warten« und »nicht …«
In Todesangst blickte er über die Schulter. Ohne Brille wirkten Rustys Augen merkwürdig blass. Hinter ihm zog weiß und anmutig ein Reiherschwarm über den Fluss.
Das Jetboot raste auf Lesniak zu. Im nächsten Moment drehte Rusty am Steuer, und das Boot scherte zu einem knappen Bogen aus. Zehn Meter hinter Lesniak wendete es, spie weiß schäumendes Kielwasser und fuhr wieder flussaufwärts.
Lesniak trieb erschöpft in der starken Strömung und spürte einen Kloß in der Kehle. Der Kerl hatte es aufgegeben. Gott sei Dank.
Von wegen Gott sei Dank.
Rusty hatte die Flasche. Er hatte das Zeug. Slick.
Langsam, mit röhrendem Motor, entfernte sich das Boot. Deswegen hatte es den riesigen Chevy-Motor. Es brauchte jede einzelne Pferdestärke, um sich gegen die Strömung zu stemmen. Selbst das Dröhnen der Maschine drang nur noch schwach durch das immer lautere Rauschen der Wassermassen.
Plötzlich pumpte sein Herz auf Hochtouren, und er wirbelte herum. Er trieb mitten im Fluss und jagte mit hoher Geschwindigkeit um eine breite Biegung. Hinein in die Abenddämmerung, die Inseln weit hinten, die Ufer zu beiden Seiten nur noch undeutliche schmale Streifen.
Eine Welle spülte ihn hoch wie einen Surfer, und sein Blick richtete sich nach vorn. Sein Mund klaffte auf.
Wie eine Fliege schwebte er auf sechshundert Millionen Litern Wasser, die in die Tiefe tosten. Er warf sich herum und schwamm flussaufwärts. Mund und Augen weit offen, die Lunge zum Zerreißen gespannt. Die Füße schwer in den Schuhen, die Arme schwach, kämpfte er sich verzweifelt durch die Fluten. Hinter sich das ohrenbetäubende Brausen. Er sah das Ufer, flach, grün und unendlich weit weg. Er sah den roten Schimmer der Sonne auf dem schiefergrauen Wasser. Er sah den Nebel, der über ihm waberte. Mosi-oa-Tunya nannten sie die Victoriafälle: der donnernde Rauch. Er spürte, wie er nach hinten gezerrt wurde, als der mächtige Sambesi zum Kopfsprung ansetzte, zu einer eineinhalb Kilometer breiten Schussfahrt, ein blauer Drache, der von den Klippen abhob und tief hinab in die Schlucht sprang. Er klammerte sich ans Wasser, um nicht unterzugehen, um zu verharren und nicht einhundert Meter tief auf die Felsen zu stürzen. Doch obwohl er brüllend zu den Flussgöttern rief, konnte ihn niemand mehr aufhalten, als er seinen langen Sturz begann.
KAPITEL 3
Jo Beckett streckte die Arme seitlich weg und spreizte die Beine. Die Leute machten einen Bogen um sie und starrten sie kurz an, ehe sie weiterhasteten. Drei Meter weiter vorn stand mit verschränkten Armen ein Cop. Sein Funkgerät knisterte. Hinter sich hörte sie das Ratschen von Latex.
»Keine Sorge, die Handschuhe sind sauber«, sagte die Frau. »Etwas breitbeiniger.«
Wortlos folgte Jo der Anweisung. Mit spinnenhaften Fingern strich die Frau über die Innenseite von Jos Schenkeln.
Der Cop verlagerte das Gewicht. »Kommen Sie, es ist ein Notfall.«
Hände fuhren über Jos Rippen, den Rücken hinab und über ihren Hintern.
Sie zwang sich, nicht zusammenzuzucken. »Hauptsache, Sie stecken mir keinen Dollarschein in den Hosenbund.«
Die Frau hielt inne und funkelte sie wütend an.
Jo setzte eine zerknirschte Miene auf. »Vergessen Sie es, ich bin sowieso eine miese Tänzerin. Ich würde bestimmt über die Stange stolpern. Kann ich …«
»An mir kommt kein Terrorist vorbei, bloß weil jemand behauptet, dass er es eilig hat.«
»Sie ist keine Terroristin«, warf der Cop ein. »Sie ist Ärztin beim mobilen Krisenteam.«
Genau, hätte Jo der Wachfrau gern zugerufen und am liebsten noch einen der saftigen Flüche hinzugefügt, die ihr Großvater in seiner Kindheit in den Gassen von Kairo aufgeschnappt hatte. Aber das war wohl keine besonders gute Idee.
Flughäfen waren das Letzte.
Im San Francisco International herrschte ein Höllenlärm und heftiges Gedränge. Die Menschenmassen stolperten durch die Absperrungen wie Vieh, das mit einem Stock zur Rampe getrieben wird. Das Krachen der Kleidertröge an den Kontrollpunkten erzeugte einen unregelmäßigen Trommelrhythmus. Eine Gruppe Sicherheitskräfte winkte die Leute durch: Weitergehen, beeilen Sie sich. Weisen Sie Ihre Bordkarte vor. Und jetzt bitte noch mal. Und jetzt zeigen Sie sie noch diesem Wachmann. Jo war klar, dass Mehrfachüberprüfungen Ausrutscher verhindern sollten. Aber wenn dieser Kontrollpunkt ein Mensch gewesen wäre, dann hätte man ihm eine Zwangsneurose bescheinigen müssen. Fixiert auf eine vergangene Bedrohung, ohne mit neuen Varianten zu rechnen.
Wie zum Beispiel der möglichen Gefahrensituation an Gate 94.
Draußen wurde die Bay Area von einem Märzgewitter heimgesucht. Regenwolken jagten als düsteres Gewirr aus Grau und Schwarz über den Himmel. Kalter Wind scheuerte über die Landebahnen.
Die Wachfrau nahm die Hände weg. »In Ordnung.« Ihr Ton war eindeutig: Fürs Erste, Schätzchen.
Hastig sammelte Jo Ohrringe, Gürtel und Doc Martens, das Halsband mit dem koptischen Kreuz, die Umhängetasche und ihre Würde wieder ein. Sie spekulierte, dass Flughäfen entweder ein Psychoexperiment zur Massendemütigung oder eine Verschwörung waren, um Reisende in den Wahnsinn zu treiben. Möglicherweise sogar beides. Schuhe aus, Laborratte. Nervig, stimmt’s? Hier hast du eine Xanax.
Der Flughafencop Darren Paterson hatte eine bedauernde Miene aufgesetzt. Er war ein Afroamerikaner mit Kindergesicht, und seine Uniform umgab ihn wie Frischhaltefolie. »Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten.«
Sie schnürte sich die Schuhe. »Kein Problem. Meine Dienststelle sagt, Sie brauchen eine psychologische Untersuchung für einen Passagier in einem Flugzeug aus London. Geht’s um 5150?«
»Das würden wir gern von Ihnen erfahren.«
Paragraf 5150: Zwangseinweisung. Als Psychiaterin hatte Jo die Befugnis, Leute zweiundsiebzig Stunden lang in eine geschlossene Abteilung zu schicken.
Anrufe wie diesen erhielt sie nur, wenn die Polizei der Meinung war, dass jemand eine Gefährdung für sich oder andere darstellte. Doch normalerweise nahmen die Cops die Betreffenden unter Berufung auf Paragraf 5150 selbst in Gewahrsam und brachten sie zur psychologischen Untersuchung in eine Notaufnahme. Vielleicht hatte die Fluglinie Fachpersonal angefordert. Oder Paterson wollte erfahrene Unterstützung – er wirkte noch sehr jung, wie ein Anfänger. Oder da lief was wirklich Bizarres. Auf jeden Fall hatte der Anruf von der Dienststelle sie erreicht, als sie zwei Minuten vom Terminal entfernt war, und die Verantwortlichen hatten kurzerhand entschieden, nicht zu warten, bis das gesamte Krisenteam beisammen war.
»Schön, dass Sie gerade in der Nähe waren«, bemerkte Paterson.
»Reiner Zufall. Hab meinen Bruder zu seinem Flug nach Los Angeles gebracht.« Sie lief neben Paterson durch die Halle. »Was ist passiert?«
»Ian Kanan, angekommen mit einem Virgin-Atlantic-Flug aus Heathrow. War nach der Landung plötzlich verwirrt und aggressiv. Hat sich an Bord verschanzt.«
Das Dröhnen der Jetmotoren hallte durch das Terminal. Regen peitschte gegen die großen Scheiben.
»Verwirrt und aggressiv – aber Sie haben ihn nicht verhaftet. Was genau hat Kanan getan?«, fragte Jo.
»Beim Aufsetzen ist er von seinem Platz aufgesprungen und wollte den Notausgang öffnen.«
»Während das Flugzeug noch rollte?«
»Zwei Passagiere haben ihn niedergerissen. Die Flugbegleiter sagen, Kanan hat sie abgeworfen, als wären sie aus Pappmaché. Anscheinend hat er gekämpft wie ein Irrer.«
»Inwiefern?«
Er warf ihr einen Blick zu. »Wie verrückt eben.«
Ein Lächeln huschte über ihre Lippen. »Bei seltsamem Verhalten fragen sich die meisten Leute: verrückt oder nicht verrückt? Psychiater fragen sich: inwiefern verrückt und welche Art?«
Sie erreichten das Gate. Am Ende des Flugsteigs drängte sich eine Gruppe Mitarbeiter in der offenen Tür der Linienmaschine. Sie betrachteten Jo mit einer Mischung aus Erleichterung und Verwirrung. Eine Seelenklempnerin? Na ja, wenn’s hilft.
Der Kapitän wartete vor dem Cockpit. »Schaffen Sie ihn aus meinem Flugzeug.«
Officer Paterson deutete in den Gang. »Er ist in der Economyclass.«
»Kein Wunder, wenn er da Amok läuft.« Als sich die Flugbegleiter entrüstet zu ihr umdrehten, hob Jo die Hand. »Kleiner Scherz.«
Sie spähte durch das leere Flugzeug. Neben der Bordküche standen weiteres Flugpersonal und ein Polizist herum.
In solchen Situationen konnte sie nie vorhersehen, was sie erwartete. Katatonie. Religiöser Wahn. Ein böser Drogentrip. Trunkenheit oder ein gewalttätiger psychotischer Ausbruch. Ein Typ, der den Sprengsatz in seinen Schuhen zünden wollte.
Ihr blieb keine Zeit, um Ian Kanans komplette Geschichte zu recherchieren. Immerhin waren die zwei Passagiere noch da, die ihn überwältigt hatten. Ron Gingrich war ein zäher Fünfundfünfzigjähriger mit grauem Pferdeschwanz und Grateful-Dead-Shirt. Jared Ely war irgendwo in den Zwanzigern, trug ein schwarzes T-Shirt und Crocs. Er strahlte ein Übermaß nervöser Energie aus.
Jo wandte sich an die beiden. »Erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Gingrich strich sich den Spitzbart glatt. »Wir hatten eine schwierige Landung. Seitenwind, hat sich angefühlt, als würden wir uns querlegen. Sind mit einem lauten Wumms aufgekommen, die Leute haben geächzt. Die Maschine hat ziemlich heftig geklappert. Sogar ein paar Gepäckfächer sind aufgegangen. Dann kommt dieser Typ den Gang raufgeprescht.« Er deutete in den hinteren Teil des Flugzeugs. »Springt über die Frau in der letzten Reihe und will die Nottür aufreißen.«
»Ich hatte den Eindruck, er weiß genau, was er tut«, ergänzte Ely.
»Was meinen Sie damit?«
Ely musterte sie scharf. »Er hat überhaupt nicht gezögert. Ist nicht stehen geblieben, um die Anweisungen an der Tür zu lesen. Hat losgelegt, wie wenn er es schon x-mal gemacht hätte.«
Jo nickte. »Und dann?«
»Spontane Entscheidung«, antwortete Gingrich. »Wir sind einfach auf ihn los. Der Typ hat gekämpft wie ein Berserker, das können Sie mir glauben. Aber wir waren zwei gegen einen und haben ihn schließlich überwältigt.«
»Hat er was gesagt?«
Gingrich nickte. »Allerdings. Klar und deutlich.«
Ely übernahm: »Dass wir verrückt sind.«
Jos nächste Frage galt den Stewardessen. »Wie hat sich Kanan auf dem Flug benommen?«
»Der reinste Zombie«, erwiderte eine Blondine. »Hat nicht gelesen, keine Filme angesehen, nicht einmal die Luftkarte hat ihn interessiert. Hat nichts gegessen. Hat einfach nur dagesessen.«
»Hat er was getrunken?«
»Nein.«
»Sicher?«
Ihr Namensschild wies die junge Frau als Stef Nivesen aus. Sie verzog das Gesicht. »Von England bis hierher ist eine ziemliche Strecke. Alle haben was getrunken. Nur er nicht.«
»Haben Sie beobachtet, dass er irgendwelche Medikamente geschluckt hat?«
»Nein.«
»Wo ist sein Handgepäck?«
Die Flugbegleiter hatten Kanans Rucksack bereits in die Bordküche gebracht. Jo stöberte darin herum. Sie entdeckte ein Notebook, aber weder Drogen noch Alkohol. Sie fand Kanans Pass und seine Reiseroute. Nachdem sie die Dokumente kurz überflogen hatte, reichte sie sie an Paterson weiter.
»Er kam nicht aus London, sondern aus Südafrika. In Heathrow ist er umgestiegen.«
»Spielt das eine Rolle?«, fragte der Polizist.
»Vielleicht.« Jos Blick glitt zum hinteren Teil der Maschine. »Begleiten Sie mich bitte.«
Paterson schritt voran. Die Gruppe bei der Bordküche machte ihnen Platz. Chad Weigel, der zweite Cop, hatte sich vor der Toilettentür postiert.
Er hob die Hand, um zu klopfen, doch Jo hielt ihn zurück. »Einen Moment noch.«
Sie wandte sich an die Flugbegleiterinnen. »Haben Sie die Tür entriegelt, um ihn rauszuholen?«
»Schon zweimal«, erwiderte eine Britin mit dem Namensschild Charlotte Thorne. »Beim ersten Mal hat er sich gegen die Tür gestemmt, damit wir sie nicht aufstoßen können. Außerdem hat er uns aufgefordert zu verschwinden. Beim zweiten Mal hat er gar nichts gesagt. Anscheinend ist er hinter der Tür zusammengesackt.«
»Bewusstlos?« Jo überlegte fieberhaft: Drogen, Alkohol, Krankheit?
Die Stewardess zuckte die Achseln. »Er hat nicht reagiert.«
»Was meinen Sie?«, fragte Officer Paterson.
»Finden wir es raus.« Jo klopfte an die Tür. »Mr. Kanan?«
Sie hörte Wasser im Waschbecken plätschern und tauschte einen Blick mit Paterson aus.
Dann öffnete sich die Tür. Der Mann drehte sich, um die Toilette zu verlassen. Doch als er sie sah, erstarrte er.
Ian Kanan war Mitte dreißig, eins achtzig, weiß. Von hinten und mit einer Jacke wäre nichts Besonderes an ihm gewesen. Doch von Angesicht zu Angesicht fiel Jo auf, wie straff sich das Denimhemd über seinen Schultern spannte. Sie sah Selbstbewusstsein vom Scheitel bis zur Sohle. Am linken Handgelenk hatte er tiefe Kratzwunden. Er war dünn und drahtig. Das Haar kurz und rostbraun wie Eisenerz. Noch nie waren ihr derart blassblaue Augen begegnet. Fast farblos, aber leuchtend hell wie eine alte Eisschicht. Jo hatte das Gefühl, in eine Gletscherspalte zu spähen.
»Verzeihen Sie bitte.« Er schob sich durch die Tür.
Plötzlich registrierte er die Leute im Gang, die ihn alle anstarrten. Dann Officer Paterson und die Schusswaffe an dessen Gürtel. »Was ist denn?«
Jo ergriff die Initiative. »Mr. Kanan, alles klar bei Ihnen?«
Er schaute kurz hinaus durchs Fenster. Graues Brodeln am Himmel und peitschender Regen. Sein Blick zuckte in den Gang. Das leere Flugzeug. Vor Jos innerem Auge erschien der Begriff Fluchtroute.
Er wandte sich wieder zu ihr. »Ich habe mich unwohl gefühlt.«
Ein ganzer, klar ausgesprochener Satz als Antwort auf ihre Frage. Immerhin. Sein Blick war wach, doch dahinter spürte Jo auch etwas anderes: im Zaum gehaltene Verwirrung. Patersons Hand schwebte über der Pistole.
»Ich bin Dr. Beckett. Können Sie mir sagen, warum Sie nicht aus dem Flugzeug steigen wollen?«
»Ich steige sofort aus. Warum sollte ich nicht rauswollen?«
Alle gafften ihn an.
»Gibt es ein Problem?« Seine eigenen Augen schienen die Antwort darauf zu geben: großes Problem.
»Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Können wir das im Flughafengebäude machen?«
»Wozu?«
Aus dem Augenwinkel bemerkte Jo, dass Officer Weigel den Kopf schüttelte. »Weil Sie sich eine Stunde lang auf der Toilette eingeschlossen haben und …«, begann er.
Jo hob die Hand. Kanans Gesicht erstarrte. Seine Pupillen wirkten normal, sie waren gleich groß und reagierten. Sie roch keinen Alkohol. Bemerkte kein Torkeln, Zittern oder Nuscheln. Und dennoch spürte sie, dass etwas ganz Grundlegendes nicht stimmte. Wieder schweifte sein Blick durchs Flugzeug. Dass es leer war, schien ihn zu beunruhigen.
»Sie sind der Letzte«, sagte sie. »Die Crew muss die Maschine abschließen. Gehen wir rüber zum Terminal.«
Bedächtig musterte er sie von oben bis unten. »Von mir aus.«
Auf dem Weg durch den Gang nahmen ihn die Polizisten in die Zange, Weigel vorne, Paterson hinten. Jetzt, aus einigen Schritten Entfernung konnte Jo Kanans Hände sehen, die locker herabhingen. Es wirkte ungezwungen, aber seine Haltung erinnerte sie an einen Revolverhelden vor einem Duell. Als sie die Reihe vor dem Notausgang passierten, bemerkte er die halb geöffnete Tür. Er drehte den Kopf und betrachtete sie stirnrunzelnd. »Warum ist der Notausgang offen?«
Jo hätte schwören können, dass die Temperatur schlagartig um zehn Grad fiel. Dann ging Kanan weiter. Vorn standen die beiden Männer, die ihn überwältigt hatten. Kanan wurde schneller. Plötzlich griff er in die Hintertasche.
»Hey«, entfuhr es Officer Paterson.
Kanan ignorierte ihn, und dann war es zu spät. Als er das Handy herauszog, war Paterson schon bei ihm.
Der Polizist war schnell, aber Kanan war schneller. In einer einzigen fließenden Bewegung wirbelte er herum, packte Paterson an der Hand, verdrehte ihm den Arm und zwang den Cop auf die Knie.
Paterson schrie auf. Die britische Stewardess rief: »Scheiße!« Officer Weigel fuhr herum.
Einen Sekundenbruchteil lang war Kanans Gesicht eine Maske der Unerbittlichkeit. Grimmig starrte er auf Paterson herab. Dann schien Verwirrung über ihn hinwegzuspülen. »Was …?«
Voller Entsetzen schaute er den Polizisten an. Hinter ihm löste Officer Weigel sein Halfter und stürmte los.
Abwehrend streckte Jo die Hände aus. »Warten Sie …«
Weigel zog einen Taser. »Treten Sie zurück, Doc«, blaffte er.
Er feuerte. Die Pfeile trafen, und Kanan erstarrte mit einem Ruck.
Paterson riss sich los. Reglos stand Kanan da. Dann, so schnell, dass Jo kaum folgen konnte, fuhren seine Hände hoch und rollten sich vor seiner Brust zu Fäusten zusammen. Seine Augen erloschen. Sein Blick schlingerte zur Seite, dann drehte sich langsam auch der Kopf nach links, als würde er von einem Magneten im Bogen nach unten gezogen. Paterson rappelte sich hoch und sprang.
»Nicht«, rief Jo.
Zu spät. Paterson riss ihn um, und Kanan brach zusammen wie ein gefällter Baum.
Jo stürzte hinüber. »Officer, nein! Hören Sie auf.«
Paterson zerrte an Kanan. »Gesicht nach unten.«
Kanan reagierte nicht. Noch immer wand er sich nach links, die Hände an die Brust gespresst, die Wange am Boden.
»Hände hinter den Rücken«, befahl Paterson atemlos.
Jo packte den Cop an den Schultern. »Hören Sie auf. Er hat einen Anfall.«
»Er leistet Widerstand.« Ächzend versuchte Paterson, Kanans Hände nach unten zu zerren.
»Officer, es ist ein Anfall. Es hat keinen Sinn, ihn festzuhalten.«
Kanan zuckte nicht, er schlug nicht um sich und drosch auch nicht den Kopf gegen den Boden. Er war abgetaucht in Gefilde, wo an den Rändern seines Gesichtsfelds helle Linien flammten und ein wildes Farbenspektrum durch sein Bewusstsein wirbelte. Er drehte sich noch immer.
»Partieller Anfall«, stellte Jo fest. »Lassen Sie ihn sofort los.«
KAPITEL 4
Kanan lag im Gang der Maschine und rotierte langsam wie auf einem Bratspieß. Jo versuchte, Officer Paterson wegzuziehen. »Rufen Sie einen Krankenwagen.«
Officer Weigel baute sich vor ihnen auf, den Taser in der Hand. »Das waren hunderttausend Volt. Er wird es überstehen.«
»Die Elektroschocks haben den Anfall vielleicht ausgelöst, aber es muss noch was anderes mit ihm sein. Officer Paterson, lassen Sie ihn jetzt los.«
Endlich hatte Paterson ein Einsehen. Als sich Jo neben Kanan kniete, jagte ihr ein Angstschauer über den Rücken wie kaltes Wasser. Sie war keine Ärztin, sondern forensische Psychiaterin. Bei ihrer Arbeit ging es nie um medizinische Notfälle. Die Leute, mit denen sie sich beschäftigte, waren bereits tot.
Sie rief sich zur Ordnung. Ein Schritt nach dem anderen. Zuerst ABC. Atemwege, Beatmung, Circulation. Sie stellte sicher, dass Kanan atmete, und prüfte seinen Puls. Dann schlüpfte sie aus dem Pullover und schob ihn zusammengerollt unter seinen Kopf. Seine Haut strahlte Hitze ab.
»Einen Krankenwagen und Sanitäter. Rufen Sie an.«
»Sie wollen ihn nicht einweisen?«, fragte Paterson.
»Nein. Er kommt in die Notaufnahme.«
Paterson sprach in sein Funkgerät. Jo suchte Kanans Kopf nach Brüchen und Platzwunden ab. Doch die einzigen Verletzungen, die sie bemerkte, waren die Schrammen an seinem Unterarm. Sie vermied jede Berührung damit und überlegte, dass es wohl vernünftiger gewesen wäre, Latexhandschuhe mitzubringen. Im Gang entdeckte sie sein Handy und hob es auf. Sie sah nach, wen er angerufen hatte: nur eine einzige Nummer mit der Vorwahl 650, aber die siebenundvierzig Mal.
Wie eine zurückweichende Welle klang der Anfall allmählich ab. Schließlich hörte Kanan auf, sich zu winden, und blieb schlaff auf dem Boden liegen. Seine Augen schlossen sich und öffneten sich wieder. Aus Patersons Funkgerät drang statisches Prasseln.
Jo legte Kanan die Hand auf die Schulter. »Mr. Kanan? Ian?«
Sie hörte das Klirren von Handschellen, die von einem Gürtel gelöst wurden.
»Nicht.« Sie warf einen Blick nach hinten. »Er hat wahrscheinlich eine Kopfverletzung. Wo bleiben die Sanitäter?«
»Sind schon unterwegs«, antwortete Paterson. »Er hat einen Polizeibeamten angegriffen. Wir müssen ihn festnehmen.«
»Sie können ihn nicht verhaften.«
»Dafür sind Sie nicht zuständig. Nur für die Einweisung. Wie schaut’s damit aus?«
Kanan regte sich. »Was … bin … der Fluss ist zu …«
Jo sprach ihn an. »Ian.«
»Ganz falsch … es ist …« Er schaute sie an wie durch einen verzerrten Videolink. »Slick … Fälle … Misty, ich …« Er blinzelte und packte Jo am Arm. »Die Hand!«
Sein Atem wurde schneller. Jo prüfte seinen Puls. Hundertachtundvierzig.
»Werden Sie von jemandem abgeholt?« Sie bemerkte den Ehering an seinem Finger. »Von Ihrer Frau vielleicht?«
Sein Blick funkelte, als hätte ihre Stimme eine Explosion in seinem Gehirn ausgelöst. Dann verdrehte er die Augen, bis nur noch das Weiße zu erkennen war, und seine Lippen öffneten sich. Unter Jos Händen verkrampfte sich sein Körper.
Er hatte schwere Zuckungen. Diesmal war es ein Grand-Mal-Anfall.
Der Rettungswagen raste durch den Regen auf dem Highway 101 Richtung Norden und scheuchte mit der Sirene den Verkehr aus dem Weg. Kanan lag reglos auf eine Trage geschnallt. Jo saß neben seiner Schulter. Die Sanitäterin hielt sich fest, als das Auto eine Kurve nahm. Sie rief immer wieder Kanans Namen und leuchtete ihm mit einer Stiftlampe in die Augen.
Hinten an der Hecktür hockte Officer Paterson, das Kindergesicht argwöhnisch verzogen. Seine linke Hand glitt immer wieder über die Handschellen an seinem Gürtel.
Jo schüttelte den Kopf. »Einen Epilepsiepatienten dürfen Sie nicht fesseln.«
»Eine Hand an der Trage.«
»Nein. Wir müssen ihn bewegen können. Wenn er sich übergibt, darf er das Erbrochene nicht einatmen, sonst könnte er daran ersticken.«
»Der Typ ist eine tickende Zeitbombe. Er wird auf jeden Fall verhaftet«, beharrte Paterson.
»Wenn Sie glauben, Sie können ihn in diesem Zustand über seine Rechte belehren, dann sind Sie derjenige, der eine Einweisung braucht.«
Kanan stöhnte.
Die Sanitäterin sprach ihn an. »Ian, können Sie mich hören?«
Eine Windbö pfiff über den Rettungswagen und schleuderte Regen gegen die Fensterscheiben. Kanans Augenlider flatterten nach oben.
Jo nahm seine Hand. »Wie heißen Sie?«
Er blinzelte benommen. »Ian Kanan.« Sein Blick klärte sich. Seine Pupillen waren gleich und reagierten auf das Licht. Etwas Wölfisches glühte in ihnen.
Jo spürte ein Prickeln im Nacken.
In der Maschine hatte Kanan Paterson mit der Unaufhaltsamkeit einer Zugkatastrophe auf die Knie gezwungen. Auch wenn sie sich vehement für ihn eingesetzt hatte, war Jo nicht scharf darauf, dass Kanan hier im Krankenwagen Unheil anrichtete.
»Sie hatten einen Anfall. Bleiben Sie ruhig liegen.«
»Was?«
»Sind Sie Epileptiker?«
Er runzelte Stirn. »Was für eine blöde Frage.«
Jo hatte ihr Examen in Psychiatrie und Neurologie abgelegt, doch bei ihrer Arbeit als forensische Psychiaterin hatte sie sich fast ausschließlich mit vergangenen Ereignissen zu befassen. Wenn die Polizei oder die Gerichtsmedizin bei einer Leiche keine klare Todesursache feststellen konnte, wurde sie hinzugezogen, um eine psychologische Autopsie vorzunehmen. Die meiste Zeit war sie damit beschäftigt, die zahllosen Möglichkeiten zu enträtseln, mit denen das Elend der Welt dem Leben eines Menschen ein Ende bereiten konnte.
Hier war es anders. Sie hatte einen Mann vor sich, der noch atmete, einen Mann mit einem großen, nicht identifizierten Problem.
Jo hatte das ungute Gefühl, dass er jederzeit auf sie losgehen könnte. »Erinnern Sie sich vielleicht, dass Sie sich den Kopf angeschlagen haben?«
»Nein.« Seine Hände tasteten nach den Hosentaschen. »Wo ist mein Telefon?«
»Das habe ich.«
»Ich muss anrufen.« Er fixierte Jo aus schmalen Augen. »Sind Sie Amerikanerin? Von der Botschaft?« Sein Blick schwirrte durch das Wageninnere, und ein angespannter Ausdruck trat in sein Gesicht. »Wo bin ich?«
»Auf dem Weg zum San Francisco General Hospital. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?«
»Nein. San Francisco?« Er versuchte sich aufzusetzen. »Wer sind Sie?«
»Dr. Beckett.« Sie drückte ihm die Hand auf die Brust. »Sie waren in Südafrika. Haben Sie Mittel gegen Malaria geschluckt?«
»Chinin? Klar, Gin Tonic.«
»Lariam?«
Lariam konnte ernste Nebenwirkungen auslösen, unter anderem Krampfanfälle und Psychosen.
»Nein.«
»Was haben Sie in Südafrika gemacht?«
Ein unheimlicher Glanz lag in seinen blassen Augen. Sie wusste nicht, weshalb er zögerte. Ob aus Verwirrung oder Berechnung, er brauchte volle zehn Sekunden, bis er eine Antwort fand. »Geschäftsreise.«
Jo erzählte Kanan nicht, weshalb sie ausgerechnet ins San Francisco General Hospital fuhren. Es gab zwei Gründe dafür. Erstens war es das einzige Krankenhaus mit umfassender Versorgung für Schwerstverletzte und zweitens die für die Einweisung von Psychiatriepatienten zuständige Stelle. Wieder glitt Kanans Blick durch den Wagen, bis er an Officer Paterson hängenblieb.
Mit mahlendem Kiefer stemmte er sich gegen die Gurte. »Meine Familie. Ist ihnen was …«
»Hey.« Mit zwei Schritten war der Polizist neben der Trage. Die Sanitäterin drückte Kanan zurück aufs Kissen.
Jo legte ihm die Hand auf den Arm. »Was ist mit Ihrer Familie, Mr. Kanan?«
Eine Sekunde lang schien er komplett verwirrt zu sein. Dann blinzelte er und zwang sich offenbar, langsamer zu atmen. »Was ist mit mir passiert?« Er sah den Officer an. »Bin ich verhaftet?«
»Noch nicht«, antwortete Paterson. »Aber nach der Landung hatten Sie es so eilig, dass Sie rausspringen wollten, obwohl die Maschine noch gerollt ist.«
»Was, sind wir abgestürzt?« Seine Augen zuckten gehetzt hin und her. »Ist der Flieger runtergekommen?«
Beunruhigt musterte ihn Jo. Innerhalb von nur zwei Minuten war Kanan bewusstlos und hellwach gewesen, hatte sich vernünftig und willensstark, dann wieder verwirrt gezeigt.
»Mr. Kanan …«
»Ian.«
»Ian, ich bin Psychiaterin. Die Polizei hat mich zum Flughafen gerufen, um Ihren Zustand zu beurteilen, weil …«
»Sie halten mich für verrückt?«
»Ich glaube, Sie haben eine Kopfverletzung.«
Er starrte sie lange an. In seinen Augen blitzte etwas auf, ein Schmerz, ein Begreifen. Sein Atem ging abgehackt. »Sie werden sagen, dass ich es selbst getan habe.«
Erneut lief Jo ein kalter Schauer über den Rücken. »Ihre Verletzung?«
»Es ist vorbei, oder? Ich habe versagt.«
»Inwiefern versagt?«
Er drückte die Augen zu. Kurz hatte Jo den Eindruck, dass er gegen die Tränen ankämpfte. Aus Patersons Funkgerät kam ein Knistern. Als das Geräusch an Kanans Ohr drang, schlug er die Augen auf und sah den jungen Cop an. Dann entspannte sich sein Gesicht.
Er atmete tief durch und wandte sich mit leuchtenden, unbesorgten Augen an sie. »Hey, was ist hier los?«
»Wir bringen Sie ins Krankenhaus.«
Verblüffung. »Warum?«
Die nächsten Worte sprach Jo betont langsam. »Wissen Sie noch, was ich Ihnen vor einer Minute gesagt habe?«
»Nein. Wer sind Sie?«
Die Sanitäterin wickelte sich das Stethoskop um den Hals. »O Mann.«
Paterson hielt sich mit der Hand an der Wagenwand fest. »Was ist?«
Bitterkeit stieg in Jo hoch. »Amnesie.« Sie schaute Kanan an. Und nicht die harmlose Art.