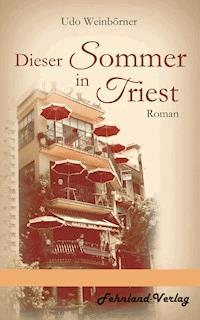Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fehnland-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In „Die Stunde der Räuber“ geht es um Schillers Verlust der Kindheit, die Unfreiheit, aber auch um Freundschaft, Liebesrausch und Aufbegehren – die schwierigen Anfangsjahre des Dichters … Unterhaltsam, kenntnisreich und zugleich spannend erzählt Weinbörner von den Jugendjahren Schillers bis zur Erstaufführung der Räuber und den Anfangsjahren als freier Schriftsteller in seiner Mannheimer Zeit. „Die Stunde der Räuber“ von Udo Weinbörner ist die stark überarbeitete und erweiterte Neuausgabe des Erfolgsromans „Schiller – Der Roman“ (Langen-Müller-Verlag, München, 2004) als zweibändige Taschenbuchausgabe. Jeder Band für sich ist ein abgeschlossener historischer Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Stunde der Räuber
Der Schiller-Roman
Roman
Udo Weinbörner
Fehnland-Verlag
Erstausgabe
Alle Rechte beim Verlag
Copyright © 2019
Fehnland-Verlag
26817 Rhauderfehn
Dr.-Leewog-Str. 27
Cover-Design: Tom Jay (www.tomjay.de)
unter Verwendung des Gemäldes "Schiller als Regimentsarzt" von Philipp Friedrich von Hetsch (im Besitz des Schiller-Nationalmuseum, Marbach am Neckar)
Gedruckt bei Bookpress.eu in Polen
9783947220328
Ich bin nicht tot,
tausche nur die Räume,
Inhalt
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Zweites Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Drittes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Danksagung
Der Not gehorchend,
nicht dem eigenen Trieb.
(Schiller: Die Braut von Messina, Eingangsszene)
Und setzt ihr nicht das Leben ein,
nie wird euch das Leben gewonnen sein.
(Schiller: Wallensteins Lager, 11. Auftritt)
Erstes Buch
Kapitel 1
»Und wenn er schon weg ist?«, Elwert war ungeduldig, mochte nicht zu spät kommen. Die Sonne brannte am frühen Morgen schon vom Himmel herab, sodass einem selbst das kühle Schulgebäude als vorstellbar erscheinen konnte, und sei es um den Preis eines langweiligen Vormittags. Fritz und sein Freund Elwert lungerten auf der Landstraße herum, und ihr Weg führte sie keineswegs zum Religionsunterricht, bei dem ihre Aufmerksamkeit nur durch die Furcht vor drastischen Bestrafungen durch Dekan Zilling aufrecht gehalten werden würde. Fritz schüttelte den Kopf, kannte seinen Freund besser. »Der Hoven muss bald kommen! Der macht so etwas nicht. Oder meinst du, er konnte seine Sehnsucht nach unserem Dekan nicht bezähmen?« Diese Frage war so absurd, dass Fritz lachen musste. Doch Elwert schien mit anderen Dingen beschäftigt und reagierte überhaupt nicht. »So setzen wir uns doch wenigstens ein wenig«, schlug Elwert jetzt vor, der seltsam matt aussah. Aber auch diesem Vorschlag widersprach Fritz: »Ich sehe ihn besser, wenn ich stehe.«
Die Zeit verstrich und eine Bestrafung wegen der Verspätung war ihnen beiden inzwischen sicher. Doch was wog eine Bestrafung gegen den Verlust des besten Freundes Hoven? Unentschlossen und langsam traten jetzt beide doch den Schulweg an. Die schnurgerade Straße flimmerte in der Sonnenglut. Immer wieder blieb Fritz stehen, reckte sich bis auf die Zehenspitzen und hielt kopfschüttelnd Ausschau. Sie waren allein unterwegs auf der Landstraße. Verlassen von der Welt, dachte Fritz. Die Einsamkeit ließ ihn seine Furcht vor der Prügel, die sie gleich erwarteten, noch deutlicher spüren. Elwert schien es inzwischen völlig die Sprache verschlagen zu haben. Fritz presste die trockenen Lippen fest aufeinander. Hoven würde heute nicht mehr kommen. Niemand kam. Mutlos und enttäuscht ließ sich Fritz jetzt doch in den Schatten neben dem am nächsten stehenden Baum niedergleiten. Mit hochgezogenen Knien lehnte er mit dem Rücken an dem kantigen Stamm. Elwert folgte seinem Beispiel. Eine Stunde früher oder später, was schien überhaupt noch von Bedeutung?
»Der Zilling wird eine ganz schöne Wut auf uns haben«, begann Elwert das Gespräch nach einer Weile. Fritz, der sich wegen seiner Angst und Enttäuschung Luft zu machen suchte, begann sofort, seinen Freund zu beschimpfen: »Denkst immer nur an dich! Und wenn dem Hoven was geschehen ist? Wenn er gar überhaupt nicht mehr kommt? Du bist mir ein schöner Freund! Lamentierst wegen ein paar blauer Flecken und vergisst deine Freunde!«
Erschrocken über die eigene Heftigkeit beobachtete Fritz die Reaktion seines Schulkameraden, aber Elwert nahm den Wutausbruch wie einen erfrischenden Regenguss. Fritz verstand ihn plötzlich. Nichts war schlimmer, als still und allein an seiner Angst zu kauen, die einem wie ein Kloß im Hals steckte. Er wünschte sich nur die Kraft, das Schicksal zu zwingen. »Natürlich ist mir der Hoven nicht gleichgültig! Warum, meinst du, sitze ich hier!«, protestierte Elwert und knuffte ihn in die Seite. Er kramte in seinem Ranzen, zog einen Kreuzerwecken hervor, teilte diesen und hielt Fritz eine Hälfte hin. »Da, nimm.« – »Keinen Appetit. Wie kannst du jetzt nur ans Essen denken!«, erboste sich Fritz. – »Wenn Hoven hier hocken und auf uns warten würde, hätte er schon drei von der Sorte verdrückt, das kannst du mir glauben!«, grinste Elwert und biss mit bedächtiger Ruhe in seinen Wecken. Fritz nahm die andere Hälfte. Auch die letzten Krümel waren bald vertilgt und die drückende Einsamkeit des Sommermorgens lastete ebenso schwer auf Fritz wie die Hitze. Wenn Hoven gar nicht mehr kam … Wenn alles zerfiel auf dieser Welt und keine Freundschaft mehr Bestand hatte?
Elwert stand auf, klopfte sich die Hose sauber und griff nach seinem Ranzen. Doch Fritz quälte die Gewissheit des Verlustes von Hoven. »Und wenn ihm was geschehen ist, Elwert? Wenn wir jetzt alle sterben müssen und es vielleicht nur noch nicht wissen? Eine schreckliche Krankheit, eine Seuche, ein Hinterhalt. Hingemäht wie das Vieh! Und mühen uns Jahr für Jahr nach Stuttgart des Landschulexamens wegen. Wofür quälen wir uns, wenn es keine Freundschaft mehr gibt und uns am Ende nur der Tod erwartet? Ein Held, Elwert, möchte ich sein! Ein Streiter für die Freundschaft. Doch wo ist die Hoffnung? Alles ist schal und trocken und kein Fleiß lohnt wirklich.«
Elwert schritt voran und zog Fritz durch seine Entschlossenheit mit. »Trocken, mein Freund, ist bei der Hitze vornehmlich meine Kehle!« – »Die Welt zerfällt in Scherben und du machst Witze.« Voll hilflosem Zorn trat Fritz mit seinen Schnallenschuhen nach Steinen und beförderte diese in Elwerts Richtung. Der sprang, um diesen auszuweichen. »Nun quäl dich nicht unnötig und lass den Quatsch.« Elwert nahm einen der Steine auf und warf ihn zurück. »Mal nicht die ganze Welt schwarz, weil dein Großvater gestorben ist. Der Mann war alt, und wir haben unser ganzes Leben noch vor uns. Der alte Mann hat’s überstanden. Komm, proben wir unseren Heldenmut und strecken einstweilen dem Zilling unseren Hintern für eine zünftige Abreibung entgegen!«
Zwei Straßenzüge von der Schule entfernt stand die Stadtkirche von Ludwigsburg. Von weit her hörten sie schon die Orgelmusik. Fritz entdeckte die angelehnte Kirchentür.
»Hörst du die Orgel? Da probt bestimmt der Schubart. Es ist das Lutherlied ›Ein feste Burg‹. Hör doch, wie erhaben die Töne daherkommen, als könne sie nichts erschüttern.«
»Fritz, lass die Tür. Komm doch weiter!«
Doch die Musik war ihm wie ein Band, dem er folgen musste. All seine Enttäuschung und Trauer schwang mit in den dunklen Tönen der Orgel. Er betrat die Kirche, verharrte eine Weile im Eingangsbereich. Das Dröhnen der Orgel füllte die Leere in seinen Gefühlen und verdrängte die Probleme der Gegenwart. Fritz wagte, keinen Schritt mehr weiter zu gehen. Fasziniert lauschte er. Auch wenn er nur wenig von Musik verstand, dies schien ihm große Kunst zu sein. Etwas, das nicht nur sonntags in der Kirche gespielt werden durfte.
Doch die Musik verstummte jäh mit einer schrillen Dissonanz, die unmissverständlich zum Ausdruck brachte, dass nicht nur Schubart, sondern gleichsam die Orgel selbst verstimmt war. »Wer in drei Gottes Namen lärmt da unten rum und hat kein Ohr für die Musik und keinen Verstand! Trete er hervor!« Schubarts Stimme donnerte gewaltig von oben herab und Fritz fühlte sich an die alttestamentarische Zwiesprache von Mose mit Gottvater erinnert. Fast im gleichen Moment sah er Elwert die Flucht ergreifen. Wenn er schon für ihn, vielleicht auch für Hoven, eine Tracht Prügel von Dekan Zilling riskierte, so wollte er wahrscheinlich seinen Mut nicht überstrapazieren. Fritz erwiderte Schubarts wütenden Blick von unten mit einem Achselzucken: »Ich bin’s nicht gewesen. Sie hätten ewig so weiterspielen mögen und von mir wäre in Andacht kein Laut zu hören gewesen …« – »Rotzlümmel!«, fluchte Schubart, der die ihm erwiesene Ehrerbietung aus dem Mund eines fast vierzehnjährigen, bleichgesichtigen Knaben für einen Schabernack hielt und von der Empore hinunter stürmte.
Elwert kam nicht weit, denn er lief vor der Kirche geradewegs in die Arme des Dekans Zilling, der ihn bei einem Ohr zu fassen bekam und ihn in schmerzhaft verdrehter Haltung zurück in die Kirche zwang. Den erschrockenen Fritz begrüßte Zilling mit den Worten: »Da haben wir ja das Lumpenpack beisammen!«
Für einen Moment setzte Fritz alle Hoffnung auf Schubart. Ein Künstler mit so tiefen Empfindungen musste Verständnis haben und die Welt in eine gerechtere Bahn zwingen. Tatsächlich stießen Schubart und Zilling am Fuß der Holzstiege zur Empore fast zusammen. »Hat er sie angestiftet, der Musik zu lauschen, die so dröhnend über die Straße weht, dass mir ein geistvoller Unterricht schier unmöglich ist?« Wenn Zillings Zorn wallte, konnte niemand ihn besänftigen. »Was versteht der Herr Dekan denn von Musik? Sie sollten vielleicht mit mehr Feuer in Religion unterrichten und Ihre Schüler ließen sich nicht so leicht ablenken. Vielleicht ist auch die Musik der bessere Gottesdienst.« Schubart schmunzelte überlegen und seine gesamte Körperhaltung verriet, dass er nicht viel von dem Geistlichen hielt. Zilling schäumte vor Wut: »Das wird ein Nachspiel haben! Glaubt er, sich dem Müßiggang an der Orgel ungestraft hingeben zu dürfen und das Ganze noch als Kunst und Gottesdienst zu verbrämen, während sich unsereins müht, gute Menschen zu erziehen. Ich weiß sehr wohl einiges über ihn!« Dazu hob er drohend den Zeigefinger der linken Hand in die Höhe. »Er soll aufrührerische Verse verbreiten!« – »Ich kenne da wohl so manchen Vers, der Ihnen, Herr Dekan, nicht schmeckt, der Allgemeinheit aber munden würde! Eine Kostprobe?« Schubart lachte fast ausgelassen. »Wenn Zilling, Er, kein Flegel wär, dann spräch er nicht mit Er …« – »… endgültig genug von diesen Frechheiten!«, schrie Zilling dazwischen und trat ihm gefährlich nah. »Oho, der Herr Dekan will raufen. Zu dieser Respektlosigkeit ließe noch nicht einmal ich mich im Gotteshaus hinreißen!«, entgegnete Schubart.
Ohne es wirklich zu bemerken, hatte Zilling das Ohr seines Schülers Elwert losgelassen und dieser befand offenbar, wie Fritz kleinmütig feststellen musste, dass er für heute genügend Mut bewiesen hatte, und entwischte aus der offen stehenden Kirchentür. Gern wäre Fritz ihm gefolgt, aber er stand noch immer unbeweglich und hoffte auf ein Wunder, das von Schubart ausgehen könnte. Nur einen verzweifelten Augenblick lang schien der Dekan versucht, dem Organisten an den Kragen zu langen. Fritz schätzte wohl nicht zu Unrecht, dass Zilling nicht nur rhetorisch, sondern auch körperlich unterlegen wäre, wenn er tatsächlich zugelangt hätte. Und hätte Zilling seiner Wut nachgegeben, für Fritz und sein unentschuldigtes Fernbleiben vom Unterricht hätte sich wohl niemand mehr interessiert. Doch der Dekan maß die gedrungene, kräftige Statur Schubarts. Er hielt den Blick in Schubarts rundes, fleischiges Gesicht nicht aufrecht. Nur kurz erhob sich sein rechter Arm wie zum Schlag und Fritz hielt den Atem an. Dann aber brachte er nur ein gequältes Lachen hervor, und mit den Worten: »Ich lass mich doch nicht von ihm provozieren!«, ging er entschlossenen Schrittes auf Fritz zu, griff mit unnachgiebiger Härte nach dessen Arm und zog den Schüler, der ihm widerwillig folgte, mit einem kräftigen Ruck hinter sich her.
Fritz bewunderte den Organisten. Das Gefühl eines erneuten Verlustes überwältigte ihn jetzt. An seinem Schicksal nahm Schubart jedoch offenbar keinen Anteil, denn ohne ein weiteres Wort warf er hinter beiden die Kirchentür zu und verriegelte diese. Die Welt, die Fritz so viel bedeutete, verschloss sich hinter ihm und lieferte ihn der Ungerechtigkeit und den Quälereien eines tobsüchtigen und vielleicht auch sadistischen Geistlichen aus.
Kapitel 2
Elwert wartete auf der Landstraße auf Fritz und stützte seinen schwer humpelnden Freund auf dem Nachhauseweg. Fritz brachte aber außer einer kurzen Begrüßung kaum ein Wort über die Lippen. Er verbiss sich die Schmerzen und verlor mit heldenhafter Haltung kein Wort über die erlittene Schmach der Prügelstrafe. Elwert, verlegen und schuldbewusst, plapperte das Blaue vom Himmel herunter. Fritz fühlte sich schließlich erleichtert, die letzten Meter zum elterlichen Haus allein gehen zu können. Denn die Verletzungen, die er durch die Züchtigungen erhalten hatte, setzten ihm zu. Er zitterte am ganzen Körper.
In der Stube saß Frau von Hoven bei seiner Mutter und schwätzte bei Kaffee und Kuchen. Fritz nahm sich auch ein Stück und hockte sich vorsichtig auf die Türschwelle zur Küche. Von draußen hörte er Christophine, die mit den beiden kleinen Schwestern spielte. Fritz hoffte, aus dem Gespräch etwas über seinen Freund Hoven zu erfahren, und gab sich alle Mühe, trotz seines erbarmungswürdigen Zustandes, der Unterhaltung zu folgen.
»Ihr Vater, Frau Schiller, war ein aufrechter Mann. Weiß Gott, er wird vielen fehlen.«
Frau Dorothea Schiller trocknete sich daraufhin ein paar Tränen. Sie hatte sehr an diesem mürrischen alten Mann gehangen und viel mit ihm gelitten, als ihm Krankheiten und Altersgebrechen immer mehr zusetzten. Fritz liebte seine Mutter dafür, wenngleich er sich nur eine ungefähre Vorstellung davon machen konnte, wie viel Kraft es sie gekostet haben mochte, für ihre fünfköpfige Familie zu sorgen und sich gleichzeitig um den Großvater zu kümmern. »Ja, es ist schwer, die Eltern zu Grab zu tragen. Denn ehe man sichs versieht, rückt die Reihe an einen selbst. Und Sie, liebe Frau Schiller, haben ja noch Ihre große Familie.« Jetzt legte Frau von Hoven eine gewichtige Pause ein und ließ diese letzten Worte auf ihre Zuhörerin wirken.
Fritz erschrak zutiefst. Es stimmte also doch! Friedrich von Hoven und seinem Bruder war etwas geschehen! Aber wie konnte dann diese Frau so teilnahmslos dasitzen, Kuchen essen und Kaffee schlürfen? Nein, das durfte nicht sein!
»Aber, Frau von Hoven, Sie haben doch auch Ihre Jungs. Die machen ihren Weg und werden Ihnen Freude bereiten«, antwortete Dorothea Schiller.
»Leer ist es und still im ganzen Haus, als sei ein Marder im Hühnerstall eingefallen. Jetzt habe ich nur noch für meinen Hauptmann zu sorgen, der ohnehin den ganzen Tag aus dem Haus ist. Die Zeit schleicht den ganzen Tag lautlos vor sich hin und die Stunden zerren zäh an meinen Nerven. Auch wenn Sie, werte Freundin, Ihren Vater verloren haben, es ist noch junges Leben um Sie. Aber wer weiß, wie lang …« In der Stimme der Frau von Hoven schwang etwas Pathetisches mit, das Fritz hätte beruhigen können. Aber, zerschlagen wie er sich fühlte, steigerte sich sein Erschrecken. Der Friedrich tot, hingerafft von einer heimtückischen Krankheit! Keinen klaren Gedanken mochte Fritz mehr fassen. Ihm fiel der Teller zu Boden und er sprang auf. »Sagen Sie, Frau von Hoven, was ist mit Ihren Söhnen? Sind sie tot? Das darf nicht sein!«
»Nein, so beruhig dich doch, Fritz!« Dorothea Schiller versuchte, ihn in die Arme zu schließen, aber Fritz wich ihr aus und humpelte entschlossen auf Frau von Hoven zu, warf sich vor ihr auf die Knie und hing mit beiden Händen an ihrem Rock. Ihm war es dabei völlig gleichgültig, welchen Eindruck dies auf die ebenfalls erschreckte Mutter seines Freundes machen würde. Zu tief war sein Schmerz.
»Was hat er nur!«, rief Frau von Hoven aus. »Natürlich leben beide Jungen noch. Fritz, komm zu dir!«
»Wo sind sie? Ich will es wissen!«, beharrte Fritz jetzt, der die von Frau von Hoven künstlich erzeugte Unsicherheit nicht mehr länger ertragen konnte.
»Des Herrn Herzogs Order ging an alle Offiziere, die Söhne haben. Jetzt hat er beide allergnädigst auf der Solitude behalten … So nimm doch bitte deine Hände von meinem Rock und steh auf!« Verlegen strich Frau von Hoven ihre Rockfalten zurecht, während Dorothea Schiller die Kuchenreste vom Boden aufsammelte und das Geschirr in die Küche brachte. »So ist es also wahr, dass der Herzog die Jungen in seine militärische Pflanzschule zwingt«, sagte Dorothea Schiller.
Fritz verstand überhaupt nichts, stand aber jetzt gehorsam auf und nahm am Tisch gegenüber von Frau von Hoven Platz. Sein Freund und dessen Bruder lebten noch. Das blieb das Wichtigste für den Moment! Ihm wurde schwindelig, aber er hielt sich tapfer.
»Mein Friedrich hat es nicht gewollt! Ganz sicher wollte er nicht fort!«, protestierte Fritz.
»Er lässt dich auch schön grüßen.«, Frau von Hoven lächelte ihn nachsichtig an. »Es ist eine Ehre für ihn.« – »Er hat das nicht gewollt! Und er nimmt es nicht als Ehre! Warum lügen Sie? Lügen ist klein und hässlich.« Fritz mochte sich nicht mehr beruhigen.
»Mein Gott, Dorothea, was ist nur mit Ihrem Kind los?« – »Fritz, so komm doch zu dir. Dem Friedrich und seinem Bruder geht es gut«, versuchte Dorothea Schiller, auf ihn einzuwirken, aber was wusste sie schon von dem Verlust, der ihn traf? »Lassen Sie ihn nur. Und recht hat er irgendwie auch«, sagte Frau von Hoven mit weinerlichem Ton. »Immer hab ich es dem Hoven gesagt, aber ein Offizier nimmt es nicht so arg, solang es ihn nicht höchstselbst betrifft. Dabei habe ich mich immer so gefürchtet. Warten Sie nur, liebste Freundin, das trifft auch Sie.« Und dabei schaute sie Fritz direkt ins Gesicht, dass ihm angst wurde.
»Mein Mann hat mir noch nichts davon erzählt«, antwortete Dorothea Schiller aufgeregt. »Davon hätte er gesprochen.« – »Unser Herzog verschont keinen, meine liebe Freundin. Wer sollte es ihm verbieten? Wir haben noch gemeint, ein Kind herzugeben, muss reichen. Unseren Ältesten haben wir versucht zu verbergen. Aber der Herzog hat meinen Mann angefahren: Warum glaubt er, mir seinen zweiten Sohn verheimlichen zu können? Der muss auch her! Gemein gelacht hat er dabei. Mir zerreißt es das Herz.« Theatralisch griff sie sich an die Brust, dort wo Rüschen und Spitzen des Brusttuches sie bedeckten, um sogleich Kaffee und Kuchen zu loben.
Fritz spürte den Boden unter sich schwanken. Seine schlimmsten Befürchtungen wurden Wahrheit: Er verlor seinen besten Freund. Auch wenn er nichts von der drallen Frau von Hoven mit ihrem Hang zu Klatschgeschichten hielt, ihre Kinder waren ihr entführt. Daran ließ sich nicht rütteln – und er selbst schien der Nächste zu sein, dem dieses Schicksal unabwendbar drohte.
»Nach dem Landschulexamen studiert unser Fritz Theologie. Das ist so ausgemacht. Was sollte der Herzog dagegen haben?« Dorothea Schiller suchte nach Argumenten, ihre innere Ruhe wiederzufinden. Fritz sah es seiner Mutter an, dass sie zwar vernünftig sprach, aber keineswegs beruhigt schien. Rücken und Gesäß brannten ihm immer noch wie Feuer, doch sein Stolz verbat es ihm, über die von Dekan Zilling empfangene Prügel zu berichten und sich seine Wunden behandeln zu lassen. Kein Wort darüber sollte ihm in Gegenwart der klatschsüchtigen Frau von Hoven über die Lippen kommen!
»Es hatte auch was Gutes. Der August hat so bitterlich geweint, als er seinen Ranzen packen musste, dass wir ihn nicht aus dem Haus bekommen hätten, wenn nicht der Friedrich mitgegangen wäre. Jetzt ist wenigstens mein Kleinster nicht allein«, erzählte Frau von Hoven. Dorothea Schiller schwieg betroffen. Fritz fragte gequält: »Macht er keine Ausnahme, der Herr Herzog?«
Ohne Fritz weiter zu beachten, redete Frau von Hoven weiter auf ihre Freundin ein. »Seine Neue, die Frau Baronin, soll er in Bayreuth kurzerhand in die Karosse gehoben haben und schon in derselben Nacht mit ihr abgestiegen sein. Gebetet werden sie nicht die ganze Nacht haben. Jetzt wohnt sie bei ihm auf dem Schloss …« Gespräche dieser Art wurden im Schiller’schen Haushalt üblicherweise nicht über den Herzog geführt. Und wenn sich Fritz auch noch so elend fühlte, wollte er doch jetzt nichts versäumen. Vor seinen Augen verschwamm aber die Umgebung langsam und das Gesicht der Frau von Hoven geriet zur Fratze, zum Inbegriff seiner Ängste.
»Man hört, die Gräfin wird sich scheiden lassen von ihrem Mann, wo sie doch evangelisch ist.«
Frau von Hoven schüttelte ungläubig vor so viel Naivität ihrer Freundin den Kopf. »Das macht die Sache doch nicht besser, wo er katholisch verheiratet bleibt. Außerdem glaube ich das mit der Scheidung nicht einmal. Diese Herrschaften brauchen nicht den Segen der Kirche, um sich hinzugeben. Das war schon immer so. Schon seinen seligen Vater kümmerte die Religion wenig. Ist er doch katholisch geworden beim Anblick des kaiserlichen Reiterregiments. Die leben wie die Wilden. Dem Schmied seine Margarete – noch keine achtzehn – hat jetzt auch schon ein Kind von ihm.« Frau von Hoven hob vor Erregung den Zeigefinger drohend in die Luft. »Sie wird bald niederkommen.«
»Dabei hätte er die Macht, könnte so viel Gutes tun«, seufzte Dorothea Schiller. In diesem Moment stürmten Luise und Maria Charlotte, die beiden jüngsten Schillerkinder lärmend in die Stube und Frau Schiller rief nach Christophine. »Geh, bring die Kleinen wieder nach draußen. Was hier besprochen wird, schickt sich nicht für Kinderohren.« Verlegen strich sich Dorothea Schiller, der es wohl am liebsten gewesen wäre, wenn auch Fritz mit nach draußen gegangen wäre, eine Haarsträhne aus der Stirn. Gespräche über unverfängliche Themen lägen ihr mehr, dachte Fritz, der dem Phinele zulächelte. Aber Frau von Hoven war eindeutig keine Frau für den Austausch von Kochrezepten. Fritz wunderte sich zum wiederholten Mal, dass sie zu den Freundinnen seiner Mutter gehörte. Schon kehrte sie zu ihrem Thema zurück. »Glauben Sie nicht, der Herzog wird eine Ausnahme machen, nur um Württemberg einen neuen evangelischen Kuttenspringer zu schenken. Ein schneidiger Offizier oder ein verschlagener Jurist sind ihm da allemal lieber. Wie man hört, soll Fritz in diesem Schuljahr große Fortschritte gemacht haben …« – »Lassen Sie doch meinen Jungen in Ruhe. Wer weiß, wie sich alles fügen wird. Schauen Sie nur, er ist schon ganz blass. Sie ängstigen ihn mit Ihren Reden, liebste Freundin. Fritz, komm, trink etwas.« Dorothea Schiller stellte ihm eine Tasse Wasser auf den Tisch. Fritz spürte die Besorgnis seiner Mutter, registrierte den Seitenblick von Frau von Hoven und hörte wie aus großer Ferne noch: »Die Franziska von Leutrum soll übrigens gar nicht so hübsch sein. Da hat der Herzog schon besseren Geschmack bewiesen. Aber sie wird schon ihre Qualitäten haben …«, dann schwand ihm das Bewusstsein und er spürte noch einen stechenden Schmerz, als er seitlich vom Stuhl kippte und auf den Boden schlug.
Nasse Tücher kühlten seinen Rücken und sein entblößtes Hinterteil. Die Haut darunter pochte heiß. Seine Mutter saß am Bettrand und wischte ihm mit einem kalten Tuch über Nacken und Stirn. Fritz fieberte ein wenig, aber er fühlte sich besser. Er genoss die Fürsorge. Gleichzeitig machte er sich, kaum dass er wieder zu Bewusstsein gekommen war, Gedanken darüber, wie er seinem Vater die Verletzungen erklären könnte, ohne dessen Zorn zu reizen. Aber zunächst küsste ihn seine Mutter auf die Stirn und flüsterte ihm Worte des Trostes ins Ohr. Langsam schärften sich seine Sinne wieder.
Da hörte er Männerstimmen aus der Stube und schon nach kurzem Lauschen erkannte er die Stimme seines Vaters und die des Präzeptors Honhold von seiner Schule. Zu seiner größten Verwunderung schalt sein Vater die von Dekan Zilling vorgenommene Züchtigung als nicht hinnehmbare Härte und Präzeptor Honhold entschuldigte sich wortreich für den Dekan, den er ermahnt habe, nicht fahrlässig mit der Gesundheit der ihm anvertrauten Schüler umzugehen. Gehorsamst erkundigte sich der Präzeptor Honhold nach dem Befinden des Jungen. Daraufhin trat Kaspar Schiller an das Bett seines Sohnes, sah, dass dieser das Bewusstsein wieder erlangt hatte, und ordnete an, er möge sich sein Nachthemd überwerfen und in der Stube erscheinen. Dorothea Schiller, die mit der Entscheidung ihres Mannes nicht einverstanden war, half ihrem Sohn beim Aufstehen und Ankleiden. Etwas unsicher fühlte sich Fritz auf den Beinen und angstvoll trat er seinem Vater und dem Präzeptor unter die Augen. Letzterer gab ihm freundlich lächelnd die Hand und schien offenbar erleichtert, Fritz bereits wieder auf dem Weg der Besserung zu finden.
»Jetzt berichte er mir, warum dort blaue Flecken und blutige Striemen auf seinem Hinterteil blühen. Stell er sich grade hin und beginne er zu erzählen!« Der militärisch gestrenge Tonfall in Kaspar Schillers Stimme ließ keine Ausflüchte zu. Auch auf die Beschwichtigungen des Herrn Präzeptors ging der Vater nicht weiter ein. Gesenkten Hauptes, rastlos mit den Händen den Hemdzipfel drehend, gab Fritz schüchtern zur Antwort: »Ich habe den Unterricht bei Herrn Dekan Zilling versäumt und Herrn Schubart beim Orgelspiel zugehört. Dies hat den Herrn Dekan Zilling sehr wütend gemacht. Insbesondere weil er sich mit dem Herrn Schubart aufs Heftigste gestritten hat.« – »So, der Schubart … Und dann hat er brav Hinterteil und Kreuz hingehalten, damit der Herr Dekan seine Wut auf Schubart an ihm abreagieren kann!«
Fritz schaute vorsichtig seinen Vater an, in dessen Stimmlage sich so etwas wie Mitgefühl anzudeuten schien. »Nichts gesagt hat er seiner Mutter von dem Vorfall und den Schmerzen, als er nach Hause kam?«
»Ich habe nichts erzählt, denn ich habe mir gedacht, der Herr Dekan meint es nur gut …«
Der Präzeptor Honhold wandte sich ab, um seinen Gesichtsausdruck zu verbergen. Aber Kaspar Schiller rief: »Ist er toll geworden oder ist er ein Duckmäuser, der Angst hat, sich zu seinen Taten zu bekennen? Das nächste Mal gibt er Bescheid, damit seine Wunden versorgt werden können. Hat er mich verstanden? Geh er jetzt schlafen.«
Fritz blickte dankbar zu seinem Vater auf, dessen Stimme sogar mild klang. Rasch trugen ihn seine nackten Füße über den kalten Boden zurück zu den Salben und kalten Umschlägen. Für heute war er in der Familie tatsächlich so etwas wie ein Held und selbst die kleinen Geschwister schlichen andächtig umher. Gegen Abend stellte ihm seine ältere Schwester, das Phinele, selbst gepflückte Wiesenblumen ans Fenster. Auch wenn Fritz fand, dass Blumen für einen männlichen Helden nicht das richtige Mittel der Gunstbezeugung und Verehrung waren, rührte ihn die Geste schon sehr.
Fritz lag an diesem Abend noch lange wach. Er hatte zwar kein Fieber mehr, aber sein Herz schlug noch unregelmäßig. Sein Kopf arbeitete rastlos an unsinnigen Gedanken, von denen er keinen zu Ende führte. Im Zimmer nebenan hörte er die Stimmen seiner Eltern. Seine bisherige Kinderwelt schien zu zerbrechen. Nur eine Frage der Zeit blieb es offenbar, bis der Herzog auch ihn von zu Hause wegbefahl. Immer wieder musste er an Schubarts Orgelspiel denken, an dessen furchtloses Auftreten. Was Fritz brauchte, war eine Mitte, etwas, das er völlig überzeugt als die Wahrheit in seinem Leben akzeptieren konnte – so wie der Schubart seine Kunst. Fritz fühlte sich zerrissen von widerstreitenden Gefühlen und Gedanken und suchte die Nähe seiner Eltern. Er schlich zur Tür und horchte den vertrauten Stimmen.
»Die Welt da draußen ist größer, wahrhaft groß, Dorothea, außerhalb unserer kleinen missgünstigen Welt hier in Ludwigsburg und im Ländle. Und vor allem ist sie gerechter, als es uns der Herzog glauben lassen mag, wenn er uns den Lohn schuldig bleibt und wir darben und unser Augenmerk nur aufs tägliche Leben richten müssen. Dies macht die Nasenspitze zum Horizont! Der Klopstock dagegen ist ein Poet! Einer, der weit schaut ins Land – über Grenzen hinweg. Schubart hat es als Erster begriffen! Was sage ich! Ein großer, ein deutscher Poet – mitten in dieser halbherzigen Kleinstaaterei, die uns klein und in Ketten hält!«
»Sprich leiser, Kaspar. Du weckst sonst noch die Kinder auf«, bat Dorothea.
»Es ist schwer, seine Zunge im Zaum zu halten, wenn das Herz überquillt. Und das mir altem Haudegen! Es waren noch viele da, ein richtiges Ereignis.« Kaspar Schiller ging offenbar in der Kammer umher, denn Fritz hörte die Dielen knarren. Aber Fritz verließ seinen Horchposten nicht. Klopstock? Fritz erinnerte sich, den Namen schon einmal im Zusammenhang mit Schubart vom Vater gehört zu haben. Wie das klang! Ein Poet … Konnte dies sein eigener Weg sein? Konnten die Worte, wohl gesetzt in Vers und Reim die Welt weiten, Stütze sein auf der Suche nach der Wahrheit und Freiheit?
»Fritz, komm ins Bett. Wenn der Vater dich dort erwischt, wie du lauschst …«, Phineles Stimme flüsternd aus der Dunkelheit. »Sei still!«, zischte Fritz seiner Schwester zu. »Ich erzähle dir nachher alles.« Sein Herz schlug so heftig, dass ihm schwindlig wurde. Sein Ohr klebte förmlich an der Tür. Für einen Moment erschrak Fritz, als sein Vater direkt vor der Kammertür stehen blieb, und er suchte schon fieberhaft nach einer passenden Ausrede. Deutlich erklang Vaters Stimme, als er aus einem Gedicht vorlas:
»Ihr habt der Menschheit heilige Wunde
Tief herunter entweiht. Sie hätten Engel mit Jauchzen
Und mit weinendem Dank von der Könige König empfangen.
Oh, ihr standet erhoben; um eure Throne versammelt
Stand das Menschengeschlecht. Weit war der Schauplatz, der Lohn groß,
Menschlich und edel zu sein. Die Himmel sahen euch. Es wandten
Alle Himmel ihr Angesicht weg, wenn sie sahen, was ihr tatet;
Wenn sie sahen den mordenden Krieg, des Menschengeschlechtes
Brandmal alle Jahrhunderte durch, der untersten Hölle
Lautestes, schrecklichstes Hohngelächter, den ewigen Schlummer
Eurer Augen, das neben euch drückte der kriechende Liebling,
Keine Tugend belohnt und keine Träne getrocknet! …«
Bedeutungsvoll verstummte die Stimme seines Vaters und Fritz spürte, wie diese Worte, so erhaben über die Finsternis, ihn beschäftigten und nicht losließen.
»Mit laut tönender Stimme, dass es von den Decken widerhallte, hat uns der Schubart das vorgetragen und gefordert, dass die Menschheit das Joch der Unterdrückung abschütteln müsse, damit ein jeder genug habe und in Frieden leben könne. Diese Poesie, Dorothea, ist zu etwas nutze! Eine deutsche Dichtung für eine neue Zeit!« Kaspar Schiller konnte sich nicht beruhigen und sprach trotz der erneuten Ermahnung seiner Frau mit unverminderter Lautstärke weiter. Als er schließlich noch berichtete, wie sie gepackt vom Feuer des Vortrages alle Klopstocks Buch bestellt hätten, empörte sich Dorothea Schiller: »Das Geld reicht nicht für das tägliche Brot! Jetzt, wo der Fritz bald mit dem Studium beginnt, müssen wir doch alles zusammenhalten. Wenn du wenigstens etwas Geistliches gekauft hättest, das er vielleicht hätte gebrauchen können …« – »Dorothea, du verstehst das nicht. Man meint, man müsste fliegen, wenn man es nur könnte«, Kaspar Schillers Stimme wurde rau vor Sehnsucht. »Natürlich hast du auch recht. Und den wackeren Schubart wird es die Stellung kosten. Ihn zurück nach Geislingen zwingen, wenn nicht sogar außer Landes. Der Dekan Zilling hockte auch da, jener, der ihm nicht grün ist. Ein so freies Wort weiß die Obrigkeit nirgendwo zu schätzen! Und Feinde hat der Schubart mit seiner frechen Art wahrlich genug. Aber Mut hat er und öffnet uns die Augen. Dem Schubart gebührt Anerkennung, Dorothea.«
»Dieser Mensch mit seinen Weibergeschichten predigt seine weinselige Art von Freiheit. Er soll sich lieber um seine beiden Kinder und seine Frau kümmern«, Dorothea Schiller urteilte nüchtern. Fritz in seinem Versteck bedauerte, dass sie die Glut der Verse, das Unerhörte der Worte nicht einmal empfinden konnte. Gern hätte er seiner Mutter zugerufen, dass er auf alle Studien verzichten wolle, wenn ihm solche Poesie verschlossen bliebe. Die Hand von Kaspar Schiller legte sich auf die Türklinke. Fritz sprang auf und floh ins Bett. Ihm gelang es nicht mehr, sich zuzudecken, da kroch schon der Lichtschein durch den offenen Türspalt. Fritz presste die Augen fest zu und stellte sich schlafend. In seinem Kopf klangen die Verse nach: »Keine Tugend belohnt und keine Träne getrocknet.«
Der Vater trat an sein Bett und zog ihm die Decke über die Schultern. Nebenan weinte die kleine Maria Charlotte, die zahnte. Fritz hörte, dass seine Mutter sie aufnahm und ihr beruhigend zuredete. Dann sagte sie zu ihrem Mann: »Diese Poesie ist nicht für unsereinen. Sie macht nicht satt.« – »Ja, ja. Sie macht unruhig. Doch wie kann man in Frieden leben, wenn der Herzog seine Schulden gegen mich nicht begleicht, wo wir das Geld so nötig haben? Da hat er fünfzig mit lebensgroßen vergoldeten Götter- und Fabelwesen geschmückte Prachtschlitten für den Winter in Auftrag geben lassen, von denen jeder zehn Mal so viel kostet, wie ich in einem halben Jahr verdiene. Aber ein Offizier wie ich, hat das Maul zu halten und zu parieren …«
Die Tür fiel ins Schloss und nebenan erlosch das Licht. An den gleichmäßigen Atemzügen erkannte Fritz, dass seine Schwester bereits eingeschlafen war. Wohin sollte er sich in solch einem Leben wenden? Noch lange lag er wach und spürte in seinen Wunden auf dem Rücken das Blut pochen.
Am nächsten Morgen saß Fritz am Tisch in der Stube und malte lateinische Verben auf die vor ihm liegende Schiefertafel. Aus der Küche quoll der süßliche Dunst, eingekochter Früchte, die Christophine und Mutter in den letzten Tagen gepflückt hatten. Sie nahmen gemeinsam den schweren Topf von der Feuerstelle und Dorothea Schiller rührte zähflüssigen Honig unter die Früchte. Fritz schaute ihr bei den Verrichtungen zu. Er bemerkte die gebückte Haltung seiner Mutter, wie sie sich vor Sorgen und Müdigkeit kaum auf den Beinen halten konnte. Was waren seine Sorgen schon gegen die Not, täglich für die Familie sorgen zu müssen? Nein, er würde hart gegen sich selbst sein, arbeiten, lernen und es ihr so entlohnen!
»Mir geht der Honig aus«, sagte Dorothea zu ihrer Tochter. »Ich fürchte, ich muss noch zum Imker, und dies jetzt, wo es uns ohnehin am Nötigsten mangelt.« – »Lass nur, Mutter!«, rief Fritz eilig, sprang auf und lief zur Haustür. »Mir kann er nichts abschlagen. Ich laufe schon!« – »Warte«, rief sie ihm zu, kam hinter ihm her, fasste ihn bei der Schulter, strich ihm die widerspenstigen roten Locken aus dem Gesicht und musterte ihn versonnen. Fritz wurde verlegen und versuchte, sich abzuwenden. Aber noch bevor er selbst die Haustür öffnen konnte, flog ihm diese entgegen und er stieß mit Elwert zusammen. »Komm mit zur Schule! Der Präzeptor Honhold hält heute eine Ansprache. Sie haben den Schubart davongejagt.«
»Unseren Schubart?« Fritz stürmte ins Zimmer, griff sich seine Schulsachen und eilte dem Freund hinkend hinterher. Keinen Gedanken mehr an seine Mutter, die sich sorgte und ihm noch hinterherrief. Keinen Gedanken mehr an die Wunden, die höllisch brannten, als er zu schwitzen begann.
»Lautestes schrecklichstes Hohngelächter… Keine Tugend belohnt und keine Träne getrocknet!« Alles würde er dransetzen, etwas aus sich zu machen! Und wenn es das Leben kosten würde! Fritz wollte fortan keine Grenzen mehr akzeptieren, außer denen, die er sich selbst setzte. Wenn du es nicht schaffst, sagte er zu sich selbst, bleibe hart, bleibe hungrig, durstig nach Erfolg und Leben! Elwert lief voran, froh, seinen Freund wieder auf den Beinen zu sehen.
Kapitel 3
Jetzt plagte ihn die Gicht schon im Spätsommer. Hauptmann Kaspar Schiller zog schwerfällig das rechte Bein nach. Im vorderen Schlosshof verschnaufte er und sah sich um. Er kam nicht gern hierher. Die hohen Fenster in immer gleichem Abstand blickten gleichgültig aus dem hellen Geviert der Mauern auf ihn herunter. Die Fräcke und reich bestickten Uniformen wichen ihm aus, als er langsam die prunkvolle Treppe emporstieg. Die Fußgarde an der Tür des Warteraums ließ den Hauptmann Schiller passieren. Kalt und düster wirkten die großen Innenräume auf Kaspar Schiller, obwohl das Sonnenlicht fast ungehindert durch die Fenstersprossen fiel. Eine angstvolle Ahnung beschlich ihn.
Durch die letzte hohe Flügeltür schritt mit schwarzem Mäntelchen und weißem Beffchen Dekan Zilling auf ihn zu. Scheu grüßte Kaspar Schiller und verbeugte sich. Über die kleinen, heimtückischen Schweinsaugen des Dekans senkten sich die Augenlider zum Dank ein wenig. Dann schritt der Dekan vorbei, stolz und frech. Denunzianten leben wohl in diesem Staat, dachte Kaspar Schiller verbittert und wünschte sich, es wäre Schubart gewesen, der dort durch die Tür gekommen wäre. Er ballte die Faust hinter dem Rücken: Im nächsten Leben sehen wir uns wieder, Herr Zilling! Wie mochte es um den Glauben des Dekans bestellt sein, wenn er davon überzeugt war, zu seinem eigenen Vorteil ungestraft andere ins Unglück stürzen zu dürfen …
Vor dieser letzten Tür zum herzoglichen Kabinett warteten gut ein Dutzend weitere Personen auf eine Audienz. Eine Gemeindeabordnung stand dicht gedrängt beisammen. Man sprach sich Mut zu. Kaspar Schiller wusste, dass es ihnen darum ging, dass der Herzog seine Residenz wieder von Ludwigsburg nach Stuttgart verlegen sollte. Man wollte nicht vergebens zwölf Millionen Gulden Schulden für den Landesherrn übernommen haben. Doch so bekannt jedermann das Anliegen dieser wohl gekleideten Herren war, die größtenteils die wohlhabende Ludwigsburger Bürgerschaft vertraten, so offensichtlich trat schon vor der Tür zum herzoglichen Arbeitszimmer ihre Machtlosigkeit zutage. Der Herzog wird leichtes Spiel haben, die Sache in seinem Sinn zu entscheiden, dachte Kaspar Schiller. Er wird ihnen neue Rechnungen aufmachen, seine Lustbarkeiten zu finanzieren. Ein paar Bürgermeister vom Land in ihrer schlichten schwarzen Sonntagskleidung mit Silberknöpfen und in ihren klobigen Schuhen drückten sich ängstlich in der Nähe der hohen Fenster herum und blickten verächtlich auf die in ihren Augen eitlen Städter. Sie würden den Herzog bitten, ihre Klee- und Haferfelder zu verschonen und sein Wild nicht für die Seefeste und Mondjagden auf ihre Kosten zu mästen. Natürlich würde auch dieses Anliegen den Herzog nicht in seinen alltäglichen Geschäften weiter belasten, schätzte Kaspar Schiller, aber er würde sie vielleicht freundlich und verständnisvoll empfangen, da er sie für seine Landpartien als Treiber und Bediente noch gebrauchen konnte. Außerdem schien nie ausgeschlossen, dass der eine oder andere über eine hübsche Landestochter verfügte, die ihm bei Gelegenheit die Ehre erweisen könnte.
»Hilf dir selbst, so hilft dir Gott«, seufzte Kaspar Schiller. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, ohne ausdrücklichen Befehl hier vor dem Herzog wegen irgendetwas vorstellig zu werden. Dies hier gehörte ganz entschieden nicht in seine Welt. Mit Fleiß, Sparsamkeit und tiefem Gottvertrauen richtete er sein Leben – Dinge, die bei Hofe gar nichts oder nur wenig zählten. Zu seiner Überraschung wurde er als Erster hereingerufen. Er spürte, wie ihm die Blicke aller Wartenden und Ängstlichen folgten. Mit gesenktem Kopf schritt er in die Mitte des großen Kabinettraumes. Die von Gicht geplagten Knochen schmerzten sehr bei der tiefen Verbeugung, die er absichtlich etwas verlängerte. Dann stand er unbeweglich in strammer militärischer Haltung, den Blick starr auf den Wandbehang hinter dem mit Blattgold verzierten Schreibtisch des Herzogs gerichtet.
Herzog Carl Eugen erhob sich und ging mit leicht federndem Schritt über das verschiedenfarbige Holzparkett des Zimmers. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, schien er über etwas nachzudenken.
Kaspar Schiller kämpfte gegen die Unsicherheit, die seinen Pulsschlag beschleunigte. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er erinnerte sich an die Stunden und Minuten vor den großen Schlachten, an denen er als Soldat in württembergischen Diensten teilgenommen hatte. An diese atemlose Stille vor der ersten Gewehrsalve, dem ersten Kanonendonner. Nur die Leere nicht Besitz ergreifen lassen in diesen letzten Momenten, den Geist wachhalten und schärfen! Die Wehrhaftigkeit und der Überlebenswille standen in diesen Augenblicken auf der ernstesten Probe. Es gab kein Ausweichen, kein Zurück. Er, Kaspar Schiller, gereift zum erfahrenen Soldaten, geübt im Überleben, aus den untersten Rängen sogar bis zum Hauptmann befördert, hatte seine Lebenslektion gelernt. Er straffte seine Haltung, den Hut fest unter den linken Arm geklemmt, und er wich dem Blick des Herzogs nicht aus, als dieser unvermittelt nah vor ihm stehen blieb. Gleich würde er fallen, dieser erste Schuss in diesem ungleichen Kampf … Das Augenduell dauerte nur einige Sekunden, dann wandte sich Carl Eugen ab und sprach: »Beruhige er sich. Hat wohl gedacht, ich hätte ihn vergessen? Dabei kenne ich ihn wohl. Außerdem hat er gute Freunde, die auf ihn aufmerksam machen – wohnt doch die Frau von Hoven im gleichen Haus? Mein Kammerdiener ist bekannt mit dieser Familie. Wie ich höre, soll sein Sohn Fortschritte gemacht haben – auch Empfehlungen des Dekans Zilling im Griechischen und seines Lehrers Jahn im Lateinischen liegen mir vor. Ein wenig ungestüm noch, der Herr Sohn, wie?« Carl Eugen legte das Papier, das er vom Schreibtisch aufgenommen hatte, wieder zur Seite.
Kaspar Schiller war es mehr als unangenehm, dass sich jetzt der Herzog erneut unmittelbar vor ihm aufbaute und seinen direkten Blickkontakt suchte. Aber er schwieg, ließ sich nicht zu einer unbedachten Äußerung herausfordern.
»Ist er nicht gebeten worden, seinen Sohn zur herzoglichen Schule anzumelden, damit aus ihm ein rechter Württemberger werde? Er hat sich noch nicht eingefunden für die Erledigung der Formalitäten. Er ist anscheinend so bedeutend, dass ich selbst mich bemühen muss.« Herzog Carl Eugen lachte kurz auf und ging im Zimmer auf und ab.
»Eure Herzogliche Durchlaucht mögen entschuldigen, aber …« – »Ich weiß, ich weiß«, mit einer Armbewegung, als würde er ein Orchester dirigieren, schnitt ihm Carl Eugen einfach das Wort ab, »jetzt kommt die alte Leier von seiner Gicht, die ihn plagt. Ist er ein Kerl oder ein Waschweib? Was meint er, warum ich ihn die Uniform eines Hauptmanns tragen lasse! Nicht damit er sich müßig ins Bett lege, seine Zipperlein zu pflegen und den Interessen seines Landesherren zu trotzen! Er soll nicht so schauen und sich beruhigen!«
Kaspar Schiller spürte, wie seine Lippen bebten. Waren es nicht die Jahre im Feld unter freiem Himmel, die Entbehrungen als Soldat und seine nie gebrochene Loyalität gewesen, die ihm diese Gicht eingebracht hatten? Er hatte sich geschunden für seinen Sold, dem ihm dieser aufgeblasene Hagestolz jetzt schon wieder für Monate schuldig geblieben war! Immer schwerer fiel es ihm, zu schweigen zu diesen ungerechten Vorwürfen. Es biss die Zähne aufeinander – dies hier war ein Kampf anderer Art. Kaspar Schiller wusste, dass es nur noch darum gehen konnte, seine Niederlage in Grenzen zu halten.
»Er weiß nichts kontra zu sagen? Nein? Er schweigt. Nun gut, dann gib er mir seinen Sohn für meine Schule, damit ich aus ihm was Gescheites machen kann!« Der fordernde Unterton des Herzogs ließ keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit mehr zu. Dennoch wollte Kaspar Schiller seinen einzigen Sohn nicht kampflos hergeben. »Ich und meine Frau werden Eurer Herzoglichen Durchlaucht auf ewig dankbar sein, wenn unser Sohn der Neigung zum geistlichen Beruf folgen darf. Es ist auch Herrn Dekan Zilling nicht verborgen geblieben, mit welchem Eifer und Erfolg sich unser Sohn um eine geistige Reife bemüht und seine Kenntnis in den Schriften der Bibel vervollständigt hat. Mit Eurer gnädigsten Herzoglichen Erlaubnis müsste er für die Fortführung seiner Studien nach Tübingen.« Kaspar Schiller wunderte sich über die Festigkeit seiner Stimme, und fast war ihm so, als könne er sich selbst in dieser Situation zuschauen und höre jemanden Dritten sprechen. Er stand auf unsicherem Grund und durfte es bei allem Widerstand gegen das herzogliche Begehren nicht riskieren, seine eigene Existenz und die seiner Familie zu gefährden.
»Hauptmann Schiller, hat er nicht sein ganzes Leben treu seinem Land gedient? Es ist ihm wohl nicht schlecht bekommen. Er ist wer und nützlich für das Gemeinwesen und seinen Herzog!« Herzog Carl Eugen stand vor ihm und wippte auf den Zehenspitzen. »Die Religion hat noch kein Land reich und seine Bürger satt gemacht. Ich sage ihm: Es sind schon genug Kuttenspringer im Land, die sich im Wortverdrehen üben! Ich brauche Staatsdiener, Beamte! Sein Sohn könnte dem Land nützlich sein wie er selbst. Warum ziert er sich? Sein Sohn lernt etwas, bekommt eine Zukunft und wird in herzoglichen Gnaden auch noch durchgefüttert!« Eine Weile schwieg der Herzog und schaute Kaspar Schiller prüfend ins Gesicht. Dann senkte er seine Stimme, die damit einen bedrohlichen Unterton annahm: »Was hat er, Hauptmann Schiller, jetzt vorzubringen, sich meinem Wunsch zu widersetzen? Er soll es jetzt sagen, sofort! Oder er soll schweigen und sich fügen!«
Gewehrsalven und Pulverdampf verzogen sich und Kaspar Schiller sah sich im Geiste allein und verlassen auf dem Schlachtfeld im Angesicht einer heranstürmenden, gut bewehrten Übermacht. Nicht zu schnell aufgeben, dachte er, in tiefer Sorge um das Wohlergehen seines einzigen Sohnes. Fritz war schon als Kind immer ein wenig schwächlich und kränklich gewesen. Alle Kinderkrankheiten hatte er aufs Schwerste durchlitten. Oft war er in Fieberkrämpfe gefallen, sodass sein Leben an einem seidenen Faden gehangen hatte. Kaspar Schiller konnte sich sehr wohl vorstellen, was der militärische Drill und die Härte, die den Offizieren zu Eigen war, die die herzogliche Schule beaufsichtigten, bei seinem Sohn anrichten könnten. Er kannte sehr wohl alle Schattenseiten des Soldatenlebens von herzoglichen Gnaden. Die Gicht in seinen Knochen und der von Narben gezeichnete Körper erinnerten ihn täglich an den Preis, den ein solches Leben auch von den Härtesten forderte. Alles hätte er daher dafür getan, um Fritz ein anderes, besseres Leben zu ermöglichen. Nicht vergebens wollte sich Kaspar Schiller den privaten Lateinunterricht für seinen Sohn beim Pfarrer Moser in Lorch vom Mund abgespart haben, in einer Zeit zudem, in der ihm der Herzog an die zweitausend Gulden Lohn schuldig geblieben war und sie nicht wussten, wovon sie die Kinder ernähren sollten. Er, Kaspar Schiller, war diesem Land und seinem Herzog wahrlich nichts schuldig geblieben! Sein Sohn hatte sich die Freiheit zu studieren verdient.
»Er schweigt trotzig! Sieht er denn nicht ein, dass ich das Beste für seinen Sohn will?« Carl Eugen trat erneut in sichtlicher Erregung einen Rundgang durch das Zimmer an, die Hände auf dem Rücken verschränkt, die Finger in nervöser Bewegung. Seine Sache stand schlecht, das wusste Kaspar Schiller, aber noch immer schlug das Kämpferherz. Einen Haken schlagen vor der Übermacht, eine Flucht andeuten, um dennoch mit gezogenem Degen, sich wehrhaft zu stellen … »Die Gnade Eurer Herzoglichen Durchlaucht steht mir nur allzu deutlich vor Augen und ich werde mich ebenso wie meine Frau zeitlebens in Dankbarkeit daran erinnern. Derart um das Fortkommen und die Bildung der eigenen Landeskinder bemüht zu sein, zeugt von wahrhafter Größe und Herzensbildung, die niemandem verborgen bleiben darf. Und dass der Wunsch der Herzoglichen Durchlaucht an meine Familie gerichtet wird, macht uns wirklich glücklich. Aber man unterrichtet an der Pflanzschule doch nicht geistliche Wissenschaften, und ich kenne Neigung und Begabung meines Sohnes sehr wohl. Ich weiß nicht, ob er bei seiner zarten Natur sich der robusteren Wirklichkeit eines anderen Berufsstandes, von dem ich sehr wohl eine Vorstellung zu haben glaube, eignen wird. Das ist es, was einer Entscheidung im Wege steht, und der Schmerz, der mit dem Verzicht auf den Berufswunsch einhergeht.«
Übellaunig griff der Herzog nach dem Weinglas auf seinem Schreibtisch, leerte es in einem Zug, um es anschließend in einer Ecke des Kabinetts zu zerschmettern. Das Klirren des Glases klang in des Hauptmanns Ohren wie das Aufeinandertreffen von Degenklingen. Unwillkürlich trat Kaspar Schiller einen Schritt zurück, nahm aber sofort wieder Haltung an. Der Herzog verfiel jetzt in einen Kasernenhofton: »Was meint er, warum ich so lange mit ihm spreche? Er ist Soldat und hätte doch einfach zu parieren! Sein Sohn soll groß gewachsen sein und er, Hauptmann Schiller, sei daher nicht so zimperlich. Ich werde für seinen Sohn sorgen – auch dann noch, wenn er den Schulhosen entwachsen ist. Wähl er sich ein anderes, ein nützliches Fach. Jurisprudenz meinetwegen – sie ernährt auch ihren Mann.« Herzog Carl Eugen nahm eine Schriftrolle von seinem Schreibtisch und händigte sie Kaspar Schiller aus. »Also? Ich habe einen Eleven auf der Pflanzschule mehr! Faktum! Lies er das, unterschreibe er und seine Frau und reiche es ein in meiner Kanzlei. Nach Weihnachten erwarte ich seinen Sohn. Bei meiner sonstigen Ungnade. Wegtreten!« Der Herzog trat ans Fenster und drehte ihm den Rücken zu. Das Blut schoss Kaspar Schiller zu Kopf und seine Hände zitterten. Deutlicher als sonst quälte ihn die Gicht in seinem Bein. Ungelenk fiel seine Gunstbezeugung aus, die der Herzog nicht wahrzunehmen schien.
»Ich danke Eurer Herzoglichen Gnaden für sein Interesse und die Ehre.« Er entfernte sich mit rückwärts gewandten Schritten und fand vor Aufregung nicht sofort zur Tür. Warum nur musste die Hoven mit ihrer Klatschsüchtigkeit und Missgunst auch seinen Sohn ins Unglück stürzen? Er verabscheute dieses Weibsbild zutiefst und er würde Dorothea die nächste Zeit den Umgang mit ihr untersagen. Aber jetzt war es zu spät. Es war geschehen. Fritz würde nie mehr nach Tübingen können, um dort zu studieren. Mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern eilte Kaspar Schiller durch den Empfangsraum, ohne noch einen Blick für die dort Wartenden übrig zu haben. Diese schauten besorgt hinterher, fürchteten sie angesichts des offenkundigen Misserfolges dieses Offiziers um das Gelingen ihrer eigenen Angelegenheiten.
Wolken zogen auf und schickten einen feinen, dichten Landregen über die Schlossanlagen. Kaspar Schiller, niedergeschlagen und verzweifelt, schaute nicht mehr zu den hohen Fenstern empor, die den Innenhof umschlossen. Es interessierte ihn auch nicht, ob der Herzog oben noch immer am Fenster stand und ihm hinterherblickte. Ganz sicher war er seinem Land ein guter Diener und daran würde sich auch nichts ändern. Das Parieren war ihm als Soldat zur zweiten Natur geworden, mochten seine Feierabendgedanken auch eigene Wege gehen. Aber wie sollte er seinem Sohn erklären, dass er als Vater vor dem Herzog versagt hatte? Gradewegs lief Hauptmann Schiller in eine Gruppe von Soldaten und Offizieren, die auf dem Weg in eines der Gebäude waren. Er rempelte sogar zwei von ihnen an, murmelte eine nicht verständliche Entschuldigung und ging, ohne militärischen Gruß, begleitet von den Protestrufen einfach weiter. Nur dem Eingreifen eines älteren Offiziers verdankte er es, dass es nicht zu Handgreiflichkeiten kam. Dieser fasste die Angerempelten am Arm und hielt sie mit den Worten zurück: »Lasst ihn. Das ist der Schiller. Der kommt gerade vom Herzog …«. Unwillkürlich blickte die Gruppe nach oben. Sie sahen tatsächlich ihren Carl Eugen am Fenster stehen und zu ihnen hinunterschauen. Rasch zerstreute sich die Gruppe.
Unter einem der Torbogen verweilte Kaspar Schiller, zog die Schriftrolle hervor und überflog den verlogenen und schicksalhaften Text.
Nachdem es Seiner regierenden Herzoglichen Durchlaucht zu Württemberg gnädigst gefällig gewesen, unseren Sohn
Johann Christoph Friedrich Schiller
in die Herzogliche Militär-Akademie zu unserer untertänigsten Danksagung in Gnaden aufzunehmen, ( …) versprechen wir, dass obenbenannter unser Sohn dieser Einrichtung sowohl als allen übrigen Gesetzen und Anordnungen des Instituts auf das Genaueste nachzuleben geflissen sein wird …
Kaspar Schiller las den Text erneut, Wort für Wort. Tränen traten ihm, dem hart gesottenen Offizier, in die Augen und er weinte hemmungslos. Alle angestaute Anspannung, Wut und Enttäuschung ließen sich nicht länger zurückhalten. Passanten und Wachtposten blickten ihm in sein tränenüberströmtes Gesicht. Aber niemand wagte, sich ihm zu nähern. Erst in der Nähe des Opernhauses nahm Kaspar Schiller schließlich wahr, dass er durch die Schlossanlagen ging. Er blieb stehen, versuchte, sich zu beruhigen, und betrachtete den Prunkbau mit all den Zierraten und Verkleidungen. Inzwischen hatte es auch aufgehört zu regnen. Ihm fiel ein, dass es des Herzogs Anordnung gewesen war, dieses Prachtgebäude aus Holz zu errichten. Ein Holz, so dachte Kaspar Schiller mit innerer Befriedigung, das sich dem durchlauchtigsten Befehl bald widersetzen und im morastigen Grund verfaulen musste. Tatsächlich beruhigte er sich ein wenig und wischte sich mit dem steifen Stoff seiner Uniformjacke über das Gesicht. Er nahm seinen Weg auf der schnurgeraden Straße wieder auf, und als er vor Wittleders Bude stand, in der man Amt und Würde alljährlich kaufen musste, wollte man ihrer nicht verlustig gehen, stand sein Entschluss fest. Wenn die Zeit reif wäre, würde er Fritz den Entschluss des Herzogs mitteilen. Knapp und ohne unnötige Gefühle würde er ihm erklären, dass er seine künftige Laufbahn als die eines Beamten in Württemberger Diensten zu sehen habe. Und wenn es ihm als Vater auch das Herz brach, er würde von Fritz Gehorsam fordern, ihn schließlich auf seinem Weg zur Militärischen Pflanzschule begleiten und hoffen, dass er stark genug sei, dort sein Glück zu machen. Die Erkenntnis der eigenen Hilflosigkeit ergriff ihn und er wusste, dass es seinem Sohn genauso ergehen würde. Kaspar Schiller zog sich den Uniformrock grade, rückte sich den Degen zurecht und richtete den Blick nach vorn. Fritz würde das erste Mal die Einsamkeit des Lebenskampfes spüren, der er schon seit Kindesbeinen, als sein eigener Vater früh gestorben war, ausgesetzt gewesen war. Er würde erwachsen werden. Ganz sicher würde es ihn stärken. Darauf jedenfalls richtete Kaspar Schiller jetzt seine ganze Hoffnung.
Kapitel 4
Noch einmal flehte Fritz ohne Hoffnung: »Habt doch Mitleid mit mir! Gebt mich nicht weg! Ihr wollt doch nicht mein Unglück. Ich habe es geahnt, seit der Hoven weg ist. Aber warum muss ich den gleichen Weg gehen? Jeder Mensch hat doch etwas in sich, das sich nicht befehlen lässt! Gilt das Wort des Herzogs so viel mehr als meine Not?«
Kaspar Schiller stand marschbereit in der Tür und sah wortlos zu Boden. Während der vergangenen Weihnachtsfeiertage hatte Fritz versucht, das Unvermeidliche zu vergessen. Besondere Aufmerksamkeit war ihm von seinen Eltern zuteilgeworden, die er an seine Geschwister weitergab. Jetzt quälte ihn der Abschied umso härter. Frierend stand Fritz in der Finsternis vor seiner Mutter und den Geschwistern. Ein schwaches Kerzenlicht erleuchtete den Raum. Das Phinele fiel ihm schluchzend um den Hals: »Ach, könnte ich nur für dich gehen! Ich halte zu dir und denke immer an dich!« Seine Mutter saß kraftlos auf einem Stuhl in der Stube und reichte ihm einen Becher mit warmer Milch, den Fritz aber ignorierte. Stattdessen fiel er auf die Knie und legte seinen Kopf in ihren Schoß. Ihre Hände strichen sanft über seinen Nacken. Dorothea Schiller flüsterte Worte des Trostes, wie immer, wenn er schwer krank darniedergelegen hatte. Fritz sah ihre Tränen, wie sie ungehindert über ihre Wangen liefen. Es hatte keinen Zweck, das Leid des Abschieds zu verlängern. Er wollte seine Familie nicht mit der eigenen Verzweiflung quälen. Er trank die Milch, dann drückte er seine beiden kleinen Schwestern an die Brust, die verschüchtert in ihren weißen Nachthemden in der finsteren Ecke der Stube standen und ihn mit großen Augen anschauten. Seinen Ranzen hatte Fritz bereits gestern gepackt. Dorothea Schiller legte ihm noch ein Brot dazu. Er schulterte seine Habseligkeiten, trat vor seinen Vater. »Hat er an alles gedacht?«, fragte dieser und maß seinen Sohn mit prüfendem Blick. Fritz nickte, blieb die Antwort schuldig, weil ihm die Stimme versagte.
Draußen empfing Fritz die beißende Kälte des Winters. In der Nacht hatten Schneestürme eingesetzt, die jetzt im fahlen Morgenlicht noch nichts von ihrer Heftigkeit eingebüßt hatten. Eisiger Wind zerrte an dem kahlen Geäst der Alleebäume und raubte Fritz ein ums andere Mal den Atem. Schwer schleppte er an seinem Ranzen und stemmte seinen schmalen Körper den Widrigkeiten dieses Tages entgegen. Die unterdrückten Tränen saßen ihm noch in der Kehle. Fast empfand er es als Erleichterung, dass der eisige Wind sie jetzt aus den Augenwinkeln trieb. Vor ihm stapfte Kaspar Schiller, der ihm so ein wenig Schutz vor dem Wind bot und mit seinen Fußstapfen den Tritt erleichterte. Fritz musterte die breite, verschneite Gestalt seines Vaters, der sich Schritt um Schritt, leicht nach vorn gebeugt, nicht vom Weg abbringen ließ. Er stellte sich vor, dass der Vater stehen blieb und ihn einfach in seine Arme schließen würde, aber er war sich zugleich sicher, dass dies so nicht geschehen konnte. Der Ruf einer hungrigen Krähe klagte von weit her über das Feld, wurde aber bald vom Nebel und der niedersinkenden Wolkenmasse erstickt. Die weißen Parkanlagen lagen wie eine leblose Ebene vor ihnen. Fritz behielt die Schultern seines Vaters im Blick und schritt dem Unvermeidlichen entgegen. In dieser verzweifelten Situation wurde ihm bewusst, wie alt und hilflos der Vater sich gefühlt haben musste, als er die Forderung des Herzogs entgegengenommen hatte, wie schwer ihm selbst dieser Gang sein musste und wie mühselig er an der inneren Unaufrichtigkeit seines geduckten Lebens trug. Er würde nicht stehen bleiben und sich nach ihm umdrehen. Kaspar Schiller konnte Fritz nicht ins Gesicht sehen und hatte doch keine Schuld daran. Sein Vater war klein und ihn drückte die Last des Lebens schwer. All dies erkannte Fritz in überdeutlicher Klarheit. Irgendwie machte ihm diese Erkenntnis seinen eigenen Weg leichter.
Fritz blies die warme Atemluft in die frostblauen Finger seiner Fäuste. Der Weg, der jetzt durch den Schlosspark führte, schien nicht enden zu wollen. Endlich hob sich auf dem Hügel das Rokokoschloss mit seiner umlaufenden Galerie aus der Nebel- und Schneewand hervor. Hoch wölbte sich die beschneite Kuppel des Mittelbaus. Aus den Kaminen stieg Rauch. Kaspar Schiller verlangsamte seinen Schritt, ließ Fritz näher herankommen. Dann deutete er, ohne sich umzudrehen, auf die mächtig geschwungene Doppeltreppe vor dem Schloss und sagte: »Dies wird dein neues Heim sein, mein Sohn …« Fritz schien es so, als habe er noch etwas Tröstendes anfügen wollen, aber sein Vater schwieg nach kurzem Zögern und stapfte weiter durch den Schnee. Erst, als sie fast die Treppe erreicht hatten, drehte sich Kaspar Schiller zu seinem Sohn um, fasste ihn bei den Schultern und sah ihm mit großem Ernst in die Augen. »Gib er mir sein Wort, dass er den Befehlen Folge leisten und fleißig lernen wird. Denk er daran, was ich ihm eingeschärft habe. Dies hier ist keine Dorfschule mehr und es herrscht militärische Ordnung! Unterschätze er dies nie! Er weiß, dass die Familie von der Gunst des Herzogs lebt. Bedenke er dies stets!« Als sich seines Vaters Blick für einen Moment in der Weite verlor, bemerkte Fritz, dass er angstvoll auf die Festung Hohenasperg mit dem Gefängnisturm schaute. Fritz fror erbärmlich, dass ihm die Zähne hart aufeinander schlugen.
Stundenlang führte sie ihr Weg über die langen Flure des Schlosses von Kanzlei zu Kanzlei. Hier waren Papiere auszufertigen, dort untersuchte man ihn auf seine körperliche und geistige Eignung und schließlich beriet man über die vom Landschulexamen und der Schule bescheinigten Leistungen. Noch nie hatte Fritz das Schlossgebäude betreten, und er staunte über den zur Schau gestellten Reichtum, bemerkte aber zugleich auch, dass sein Vater seinen sicheren Ton verlor und sich in devoter Höflichkeit übte. Als ob es nicht genug gewesen wäre, dass er hier in Sklavendienste eintrat, wurde offenbar noch erwartet, dass man sich duckte und buckelte! Ein Anstaltsmedikus diagnostizierte bei dem groß gewachsenen Jungen Untergewicht, eine Augenentzündung und leichte Erfrierungen an den Füßen. Ansonsten wurde Fritz für tauglich befunden.
Man wies ihm seinen zukünftigen Klassenraum und sein Arbeitspult zu. Fritz verstaute seine Bücher. Der Dreizehnjährige wurde entsprechend der Ordnung der Anstalt in eine blaue Uniform gesteckt, vervollständigt durch weiße Weste und Hose, durch Degen und Stulpenstiefel, durch einen Zweispitz mit Silbertressen und Federbusch sowie durch einen Zopf und den auf jeder Seite mit Gips verkleisterten Schleifenlocken. Hauptmann von Seeger händigte ihm die umfangreichen Regeln der Militärischen Pflanzschule aus und befahl ihm, diese binnen zwei Tagen zu lernen. Man würde ihn abfragen und nach zwei Tagen kein Pardon bei Verstößen geben.
Ein Bett mit Namensschild wurde Fritz zugewiesen und im Schlafsaal das rasche Abschiednehmen befohlen. Vor den gaffenden Eleven, die nach ihrem morgendlichen Exerzieren jetzt ihre Betten machten, reichte ihm sein Vater die Hand zum Kuss. Fritz spürte, dass es jetzt endgültig kein Zurück mehr geben konnte, dass seine Kindheitstage hinter ihm lagen. Unsicherheit, Angst und Verzweiflung übermannten ihn. Er wurde ein letztes Mal zum Kind. Tränen strömten ihm über die Wangen und ein Schluchzen von tief unten aus seinem schmächtigen Körper schüttelte ihn. Seine blassen Lippen suchten die Hand des Vaters und er verweilte in dieser Haltung, wollte den Moment hinauszögern. Es kümmerte ihn nicht, was seine künftigen Mitschüler denken mochten. In seiner Verzweiflung waren ihm diese nicht existent.
»Ich muss jetzt gehen, Fritz. Es ist ja kein Abschied auf immer, auch wenn ihn seine Geschwister und seine Mutter hier nicht besuchen dürfen. Aber das weiß er ja.« Selten hatte die Stimme seines Vaters so mild geklungen. »Es hat mich sehr gefreut, was sein Lateinlehrer Jahn und der Präzeptor Honhold über ihn geschrieben haben. Er ist doch ein braver Junge, der uns auch hier Ehre machen wird.« Noch immer erhob sich Fritz nicht aus der gebückten Haltung. Noch immer ließ er nicht ab von der Hand seines Vaters. Ungebrochen strömten die Tränen. »Achte er mir auf seine Füße. Mit Erfrierungen ist nicht zu spaßen. Das schmerzt sehr, wenn man diese Dinge nicht ernst nimmt.« Fritz hörte seinen Vater seufzen. Mit einer Hand griff er ihm unters Kinn und hob das Gesicht des Jungen empor. Tiefernst und traurig sah er dem Jungen in die Augen. »Adieu, mein Sohn. Gott beschütze ihn!« Dann fuhr er ihm mit der Hand sanft wie nie über den Hinterkopf. Diese Geste erinnerte Fritz an seine Mutter und er verlor den letzten Rest von Haltung. Er warf sich weinend an die Brust seines Vaters, der ihn mit beiden Armen umfing und verlegen nach dem Aufseher schaute, der im Flur wartete. Ein paar Eleven lachten und rissen Witze über das Muttersöhnchen. Dies machte Kaspar Schiller zornig und in einem barschen Tonfall, der dem eines Offiziers würdig war, wies er die Grünschnäbel zurecht: »Gleichgültig ist wohl nur der, meine Herren, der nie ein Elternhaus gehabt hat. Sie sind doch wohl gebildete Personen oder jedenfalls solche, die auf dem besten Weg sind, es zu werden. Da sollten Sie wissen, was Schmerz heißt und Abschied nehmen, und sich nicht so kindisch aufführen und auf Kosten eines Schwächeren belustigen! Ich darf wohl annehmen, dass Sie meinem Sohn gute Kameraden sein werden, die ihm sein Elternhaus ersetzen und seinen Verlust, den er heute erleidet, erträglich machen werden? Ich bitte Sie darum, meine Herren!«
Doch eingeschüchtert reagierten die Eleven keineswegs. Ein stämmiger Kerl mit breitem Mund rief vergnügt: »Haben Sie keine Sorge, Herr Hauptmann, beim Landesvater selbst sind wir wie im Paradies. Milch und Honig strömen uns in den Rachen. Und gebratene Tauben pflücken wir uns alltäglich von den Bäumen …« – »Unser Vater sorgt gar väterlich für uns, so als hätte er uns alle gezeugt!«, wusste ein anderer zu ergänzen und erntete dafür Gelächter und tosenden Beifall, vor allem von jenen zahlreichen Eleven, die tatsächlich in Verdacht standen, uneheliche Kinder von Carl Eugen zu sein.
»Dannecker, Scharffenstein! Sie spekulieren wohl auf Arrest!«, ertönte die frostige Stimme des Aufsehers.