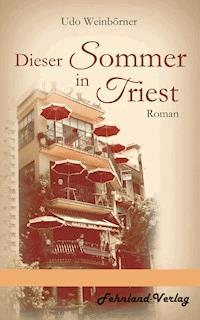
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fehnland-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viktoria Farber muss erkennen, dass ihr Leben als Handchirurgin seit ihrer Diagnose ‚Parkinson‘ keine Zukunft mehr hat. Verzweifelt flieht sie nach Triest. Dabei ahnt sie nicht, wie sehr diese ‚Stadt der Winde‘ mit ihren Prachtbauten und österreichischen Kaffeehäusern sie mitreißen und verändern wird. Schon bald findet sich Viktoria in einem Strudel von Konflikten wieder, die vom Vertrieb gefälschter Gemälde, bis hin zu Grundstücksspekulationen in der Lagune vor Grado reichen. Am Ende dieses Sommers steht ihre größte Entscheidung an: Kann sie sich trotz ihrer Krankheit auf die Liebe ihres Lebens einlassen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Sommer in Triest
Roman
Udo Weinbörner
Überarbeitete 2. Auflage im September 2019
Alle Rechte bei Verlag/Verleger
Copyright © 2019
Fehnland-Verlag
26817 Rhauderfehn
Dr.-Leewog-Str. 27
www.fehnland-verlag.de
9783947220281
Für Anne
und Jan und Justine
In Liebe & Dankbarkeit
Jeder Reisende sucht,
was er nicht ist,
wovon er aber weiß,
dass es erst die ganze Wahrheit
über ihn ausmacht.
Inhalt
– 1 –
– 2 –
– 3 –
– 4 –
– 5 –
– 6 –
– 7 –
– 8 –
– 9 –
– 10 –
– 11 –
– 12 –
– 13 –
– 14 –
– 15 –
– 16 –
– 17 –
– 18 –
– 19 –
– 20 –
– 21 –
– 22 –
– 23 –
– 24 –
– 25 –
– 26 –
– 27 –
– 28 –
– 29 –
– 30 –
– 31 –
– 32 –
– 33 –
– 34 –
– 35 –
– 36 –
– 37 –
– 38 –
– 39 –
– 40 –
– 41 –
– 42 –
– 43 –
– 44 –
– 45 –
– 46 –
– 47 –
– 48 –
– 49 –
Begleitwort des Autors und Literaturhinweise:
– 1 –
Ein leichtes Zittern in der linken Hand. Kaum spürbar. Aber ausreichend, um den Bewegungsfluss zu stören. Der Faden von Konzentration und Routine zerriss. Sie hielt inne, den Blick auf die verzerrt vergrößerte eigene Hand gerichtet. Normalerweise arbeitete sie präzise wie eine Maschine, die filigrane Führung des Skalpells wie ein Zauberstab. Sogar die Naht überließ sie keinem anderen. Und jetzt dieses Zittern! Dieser zerrissene Faden! Seit Jahren überraschte sie kein Stocken mehr. Präzisionsarbeit ließ keine Zweifel bei der Ausführung zu. Wenn sie an den OP-Tisch trat, war ihre mentale Vorbereitung abgeschlossen. Sie hatte es bei Rennfahrern beobachtet, wie diese vor dem Start in den Boxen hockten, die Augen geschlossen und die Strecke in Gedanken fuhren. Wie diese den Körper jede Kurve mitschwingen ließen. Genauso war es bei ihr. Bevor sie den Operationssaal betrat, kannte sie jeden Schnitt, hatte in Gedanken jedes Instrument in die Hand genommen, ihr Gewicht vom linken auf das rechte Bein verlagert. Sobald sie die Vergrößerungsgläser aufsetzte, tauchte der Rest der Welt um sie herum endgültig ab.
Es hörte auf; ihre Hand – ganz ruhig. Sie wusste, jetzt musste sie wieder von vorn beginnen mit ihrer Konzentration. Wo hatte sie aufgehört?
Immer schon wollte sie Handchirurgin werden, staunend vor diesem Gotteswerkzeug stehen, begreifen, was Jahrmillionen an Evolution für ein Wunder vollbracht hatten. Die Überlegenheit der menschlichen Rasse lag nicht allein in der Entwicklung des Bewusstseins; die technische Überlegenheit rührte von der Fähigkeit des Begreifens. Verwundert, als sähe sie die Hand des Patienten jetzt zum ersten Mal, schaute sie auf das Operationsfeld. »Mehr Licht!« Ihre Stimme war barscher als gewöhnlich, der Satz eine Brücke zur Normalität. Kahnbeinfraktur. Ein schwerer Sturz. »Wischen bitte!« Die OP-Schwester zur Linken tupfte ihr oberhalb der Brille den Schweiß von der Stirn.
Doch die Routine wollte sich nicht wieder einstellen. Die Gedanken ordnen. Os-naviculare-Fraktur, ein Routineeingriff am Handwurzelknochen. Diagnose gesichert durch Computertomografie. Präzisionsarbeit wie eine mathematische Beweisführung, an deren Ende man die Vollkommenheit der Schöpfung bestaunt, aber doch nur Flickwerk dagegen zu setzen gehabt hatte. Der Ehrgeiz, dem Original, der Natur möglichst nahezukommen. Sie war gut darin – die Beste ihres Jahrgangs.
Irgendjemand räusperte sich. Der Anästhesist gab Blutdruckwerte zum Besten, vielleicht auch, um die ungewohnte Pause zu beenden. Sie blickte kurz zur Seite, aber er gab sich beschäftigt. Warum sollte dies heute anders sein? Sie galt als kühler Profi. Ruhiger werdend, präparierte sie zwei kleine Knochenstücke frei und setzte sie an die richtige Position. Kontrollblick zu den Aufnahmen auf dem Lichtfeld an der Wand. Ein weiterer Knochensplitter musste links von der Sehne des Mittelfingers sitzen, doch sie fand ihn nicht sofort. Verdrahtung, um den Operationsfortschritt zu sichern oder weitersuchen? Sie stockte erneut, wurde nervös.
Nicht die Hand des Patienten, ihre eigene lag erneut im verzerrten Blickfeld ihrer Vergrößerungsgläser. Es kam wieder, das Zittern. Sie spürte es ganz deutlich, jeder weitere Schnitt wäre jetzt fahrlässig. Wie erstarrt, angesichts der Entdeckung! Der Versuch, das Zittern zu unterdrücken, führte zu einer unmenschlichen Anspannung. Ihre Zähne knirschten.
Sie übergab das Skalpell für das Desinfektionsbad, die Hände erhoben, in steriler grüner Plastikverpackung, wie zur Aufgabe bereit. Ihre Augen hielt sie halb geschlossen, jegliches Leben schien aus ihr gewichen. Reglos stand sie da, bereit, ja entschlossen, weiterzumachen, doch die Eiseskälte kroch ihre Beine hinauf. Leblos wie eine Plastikpuppe konnte sie nicht länger in der ihr eigenen eleganten Fechterpose verharren. Sie geriet ins Wanken, machte einen unsicheren Schritt nach hinten. Es ging gut, sie stürzte nicht. Die Uhr im OP-Saal an der Wand über dem Eingang tickte laut in der Stille des Vormittags, die Zeiger standen auf zehn nach neun.
Der Chef sprach mit ihr, doch sie verstand ihn nicht. Irgendetwas von Übernahme und jemand solle sie rausbringen. Seine Verärgerung hallte in ihr nach. Seine tiefe Stimme verklang erst allmählich in ihrem Inneren, als sie spürte, wie sie jemand bei den Schultern fasste und in den Vorraum zu den Waschbecken und zur Umkleide führte.
Sie bat darum, allein sein zu dürfen. Es ginge schon wieder. Keine Erklärungen, nicht jetzt. Sie suchte selbst noch nach Erklärungen für das, was da drinnen geschehen war. Wie aus der Zeit gefallen, stand sie unschlüssig im Flur der Station und blickte aus einem Fenster auf die Straße. Unten fuhr ein Krankenwagen mit Blaulicht vor. Die Kälte und der Schrecken saßen tief. Erschöpft ließ sie sich auf einen Stuhl fallen.
»Na, Prinzessin, Höchststrafe? Dass dir auch mal so was passiert ist!« Der Spott Schröders war nicht zu überhören. Dr. Marcel Schröder, Knackarsch, das streichelte sein Ego. Sie winkte nur ab: »Lass mich einfach in Ruhe! Verstanden?« Doch er frotzelte weiter, nahm sie nicht so ernst, genoss ihre Niederlage noch, bevor er wissen konnte, worum es eigentlich ging. Sie blickte angestrengt in die entgegengesetzte Richtung aus dem Fenster, bemüht, ihn zu überhören. Was hatte sie ihm nur angetan, dass er sich so aufspielte? Vielleicht war er selbstkritisch genug, sein eigenes Mittelmaß zu erkennen. Schröders Ungeduld würde aus ihm nie einen Handchirurgen werden lassen. Nicht einmal als Liebhaber bewies er Fingerspitzengefühl. Sie ertappte den Liebling der Götter, wie er, während sie sich liebten, im Spiegel mit einem Seitenblick den Sitz seiner Frisur prüfte. Dr. Locke, wie sie ihn seitdem spöttisch nannte, schwitzte nicht gern, alles Animalischen war ihm fremd. Sie wollte ihn halt mal nackt sehen. Der Preis dafür, sich ebenfalls ausziehen und anfassen zu lassen, schien ihr bei Prüfung aller Umstände angemessen zu sein. Die ganze Sache war es dann doch nicht wert gewesen. Irrtümer wie diese, dachte sie jetzt in einem Moment großer Klarheit, passieren mir immer häufiger, weil ich mich einsam fühle.
Sie brauchte jetzt einen rabenschwarzen Kaffee, den es im Schwesternzimmer gab. Auf dem Weg dorthin begegnete ihr Stationsschwester Agnes, Schwangerschaft im sechsten Monat, wunderschöne schmale Hände. Sie tauschten ein paar Freundlichkeiten aus. Agnes fragte sie nicht nach dem Vorfall im OP.
Es wurde auch für Viktoria Zeit, Bilanz zu ziehen. Der Gedanke erschreckte sie in letzter Zeit bei den unterschiedlichsten Anlässen. Ein Kind wäre eine Möglichkeit. Mit Freundinnen hatte sie darüber gewitzelt. Gelegenheiten hatte sie genug, sich eines zeugen zu lassen. Man bräuchte ja keinen Vater dazu. Einen Kerl, einen ordentlichen Ständer, ein wenig Spaß, gute Gene. Die biologische Uhr schlug Kapriolen. Und diese Einsamkeit, die sich danach nicht ausradieren ließ, wenn man sich an einem fremden männlichen Körper rieb, ein paar Nächte nicht allein schlief.
Sie ging am Schwesternzimmer vorbei, holte ihren Mantel. Sie meldete sich krank, hoffte insgeheim darauf, noch als Schwindlerin entlarvt zu werden. Ein Erschrecken, eine Zurechtweisung und alles könnte wie früher sein. Doch der ganze März war wie ein böser, wirrer Traum, das jedenfalls dachte sie, als sie durch die sich automatisch öffnenden Glastüren des Haupteingangs ging, noch unter dem Vordach stand, am obersten Knopf des Mantelkragens nestelte und dem Regen zusah, der auf den Asphalt klatschte, um in Bächen zum Parkplatz hinunter zu strömen. Diese Kälte, diese Finsternis, die nicht weichen wollte, diese Sehnsucht nach ein wenig Sonne zwischen den Krankenhausschichten ließ sie jedes Jahr schier verzweifeln.
›Wo blieb im März das Frühjahr? Keinen Kerl, kein Auto und irgendein verdammtes Zittern, was noch, du einsame alte Schnepfe?‹, begann sie sich in stummer Wut zu beschimpfen.
»Du bist zu gut für den Alten – viel zu gut. Das verträgt kein Mann auf Dauer«, da lief er wieder leichtfüßig auf sie zu. Dr. Locke, baute sich männlich breitbeinig vor ihr auf, spielte mit dem Autoschlüssel in der Hand.
»Was willst du?«, es gelang ihr ein gequältes Lächeln. Noch bevor er antworten konnte, setzte sie nach: »Es war ein üblicher Fall. Bei der Amputation habe ich die linke mit der rechten Hand verwechselt oder war es umgekehrt? Egal! Jedenfalls, der Chef hat was zu nähen. War‹s das?«
»Wie wäre es mit ein wenig Entspannung bei dir zu Haus? Ich fahre dich auch.«
Noch nicht einmal eine Abfuhr würde ihm etwas anhaben. Seine Selbstbezogenheit schirmte ihn gegen jede Zurückweisung ab, machte ihn unangreifbar und natürlich auch unbelehrbar.
»Wiederholungen langweilen mich.« Sie hielt die Hand in den Regen, als würde sie die Temperatur einer köstlichen Nässe kosten. »Und ich liebe dieses Wetter. Es macht einen klaren Kopf.« Dann schritt sie wie eine Königin davon und versuchte tapfer, den Regen zu ignorieren, der ihr hinten in den Mantelkragen lief. Der Gedanke, dass Dr. Locke, alias Knackarsch Schröder, ihr kopfschüttelnd noch nachschauen würde, machte das alles halbwegs erträglich. Jedenfalls so lange, bis sie im nächsten Linienbus in der letzten Ecke hockte und sich ihre Tränen von den Wangen wischte.
Sie schleppte sich die hölzerne Stiege zu ihrer kleinen Zweizimmerwohnung im dritten Stock eines Mietshauses in billiger, weil lauter Kölner Stadtlage, Nähe Zollstock, hinauf. Seit ihrer Studienzeit lebte sie hier, immer war etwas wichtiger gewesen als die Suche nach neuen vier Wänden. Nicht einmal Regale hatte sie gekauft und aufgestellt. Früher hatte sie Literatur geliebt, jetzt las sie fast ausschließlich Krimis und Fachliteratur, Bücher, die sich, wenn sie diese nicht sofort den Schwestern schenkte, in Umzugskartons an der Wand stapelten. In das Chaos von Wohnzimmer mit Küchenzeile ließ sie ohnehin keine Gäste. Sie vermied es, Einladungen anzunehmen, und kam es zur Notwendigkeit einer Gegeneinladung, gab sie, auch wenn sie es sich kaum leisten konnte, in den besten Lokalen der Stadt die perfekte Gastgeberin. Es sollte nicht über sie geredet werden. Der einzig vorzeigbare Raum der Wohnung, ihr Schlafzimmer, war ihr Allerheiligstes. Teuer eingerichtet, indirekte Beleuchtung, schöne erotische Drucke an den Wänden. Ihr Rückzug aus einer chaotischen Welt und der einzige Raum neben dem Bad, den sie, wenn es sich nicht vermeiden ließ, mit Liebhabern teilte.
Ein leichtes Schlafmittel, dann drückte sie sich ein Kopfkissen an ihr Gesicht, vergrub sich darin, um den Lärm auszublenden. Die Straßenbahn, die unten vorbeirumpelte, die Nachbarin, die wieder mal Zoff mit ihrem Lover hatte. Ihre Stimme, immer schriller, wie splitterndes Glas. Gerade, als sie meinte, dieser Streit ginge endlos weiter, das Zuschlagen der Wohnungstür. Draußen heulte der Motor des Wagens auf. Es war ein Trick, die Geräusche zu einem gleichförmigen Band der Wahrnehmungen zu reduzieren, das nur noch wenige Höhen und Tiefen kannte. Gelang es, versank ihr Bewusstsein in einem gleichförmigen Rauschen. Doch heute arbeitete es in ihrem Kopf immer weiter. Sie verließ ihr Bett, zog das Rollo wieder hoch und starrte abwechselnd auf den Parkplatz hinter dem Haus und auf ihr Spiegelbild auf der verdreckten Scheibe. Das Spiegelbild schloss sie nicht in die Arme, blickte nicht freundlich zurück, kein einziges Mal, nur ihre fragenden Augen in dem bleichen Gesicht, die starr auf einen Punkt in der Ferne gerichtet schienen, aber noch nichts zu erkennen vermochten.
»Dr. Marcel Schröder«, sie ertappte sich, als sie seinen Namen murmelte. Ein Bild von einem Kerl. ›No Sports‹ und dabei wie von Michelangelo in Marmor gemeißelt. Die Natur verschwendete sich immer an die Falschen. Eigentlich war Locke nicht so übel, hatte auch seine guten Seiten. Ein Lichtblick von guter Laune, ein Leuchtturm im Meer der Schicksale des Klinikalltags und der Stimmungsschwankungen infolge der ständigen Überforderung und der Dauermüdigkeit. Sie musste ihn jetzt nicht zum Heiligen stilisieren, um sich ganz eventuell einzugestehen, dass sie etwas zu schroff und zu arrogant mit ihm umgegangen war. Was, wenn es sich tatsächlich um besorgte Anteilnahme gehandelt hatte? Sie wählte seine Nummer, ließ es fünf, sechs Mal klingeln. Wollte schon auflegen, um ihn nicht zu wecken, als sich eine kichernde Stimme einer jungen Frau meldete. »Hallo, wer da? Hallo? Hören Sie, das passt jetzt gar nicht.« Pause. Seine Stimme aus dem Hintergrund. »Ja, ich leg schon auf, ich komme schooon.«
Die Frau am anderen Ende der Telefonverbindung musste sich nicht vorstellen, sie erkannte die Stimme am Klang: Elena, die Blonde, mit dem gebärfreudigen Becken, den endlos langen blonden Haaren und D-Körbchen. Elena, aus Kasachstan, eine von den Stationsmäuschen, die mit ihren Körperpfunden an den richtigen Stellen zu wuchern wusste. Elena wusste auch, dass sie nicht in die Welt passen würde, in der Locke lebte, mit Konzerten, Ausstellungen, Literatur, eben Lockes wirkliche Leidenschaften. Kultur gehörte für Elena in die Männerwelt. Im wahren Leben konnte sie nur etwas mit Sachen anfangen, wenn diese wenigstens mit Geld zu tun hatten.
Viktorias Telefonhörer fiel ihr aus der Hand, als stünde er unter Strom. Doch sie lächelte über ihre Naivität. Weder eine Glucke, noch ein Mäuschen wollte sie sein, und es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es ihr jetzt nicht endlich gelänge einzuschlafen.
– 2 –
Die Computertomografie machte ein ehemaliger Studienkollege für sie und verbuchte die Untersuchung als Gerätetestlauf. Gemeinsam starrten sie auf das Innere ihres Gehirns, während er ihr die schönsten Komplimente machte. Kein Tumor, kein Schlaganfall, das Ergebnis beruhigte sie nicht wirklich. Ihr Zittern in der linken Hand verschwieg sie ihm, auch die Schmerzen in der Schulter und die Muskelverhärtungen in der Wade. Schlafstörungen und Depressionen nahm sie als Folgewirkungen ihrer Ängste. Nichts Lebensbedrohliches, daher für sie sekundär. Aber sie hegte einen Verdacht, und sie brauchte Sicherheit. Ein Dat-Scan-Verfahren, bei dem mithilfe von injizierter Radioaktivität die Stoffwechselprozesse im Gehirn sichtbar gemacht werden konnten. Kostspielig. Dafür bräuchte sie die Krankenkasse, das ging nicht als Freundschaftsdienst, und sie wollte, dass niemand in der Klinik etwas davon erfuhr. Also keine Untersuchung am Ort, keine Untersuchung unter Kollegen. Sie wollte allein darüber entscheiden, wie sie mit dem Ergebnis umgehen würde. Die Entscheidung reifte in ihr, und sie spürte ihre Kraft zu diesem Schritt wachsen. Das Terminproblem umging sie mit einer privaten Sonderzahlung bei der Anmeldung. Wofür sonst hatte sie Rücklagen, wenn nicht für eine Notsituation wie diese? Die Überweisung schrieb ihr ein Neurologe aus München, dem sie sich als Kollegin zu erkennen gab und dem die Tragweite einer möglichen Erkrankung sofort bewusst war. Der ältere Arzt wurde schweigsam, erwies sich aber in der Folge als zuverlässig und hilfsbereit. Mehr verlangte sie nicht.
Sie hatte sich in der Zwischenzeit vom OP-Plan streichen lassen und machte Stationsdienst. Der Chef schickte die Oberärztin vor, ihr ins Gewissen zu reden. Sie solle nicht mit Nachlässigkeiten ihre Karriere gefährden. Dr. Beate Herbold, die in Ehren ergraute Kollegin kurz vor ihrem Ruhestand, sprach davon, dass es auch heute noch nicht für eine Frau selbstverständlich sei, eine solche Karriere zu machen. Geradezu einer Sensation komme es gleich, dass der Chef ihre Position nicht von außen besetzen wolle. Während die Oberärztin die Stationen des beschwerlichen Werdegangs der Jüngeren noch einmal ins Gedächtnis rief, ihre fünfjährige Assistenzarztzeit in der Chirurgie, ihre Assistenzarztzeit in der plastischen Chirurgie, ihre Weiterbildung zur Gefäßchirurgin und jetzt die drei Jahre hier als Stationsärztin hörte sie zu, sah die Mühen, die Prüfungen, ihre Kollegen an sich vorbeiziehen und konnte den Blick nicht von ihren Händen abwenden. Den schlanken, langen Händen einer erfolgreichen Chirurgin. Sie sei doch als Oberärztin gesetzt. Was denn los sei mit ihr? Viktoria gelang ein dankbares Lächeln für die Besorgnis. Sie schwieg, bis auf den Hinweis, sie könne noch nicht darüber sprechen. Enttäuschen wolle sie niemanden.
Am nächsten Tag übernahm Dr. Locke ihre Aufgaben. Seine zur Schau getragene Anteilnahme schmerzte sie. Doch sie gab sich ungerührt und beantragte Urlaub.
– 3 –
Seine Jeans hing ihm unter den Hüften und gab hinten den Blick auf den Ansatz der schwarzen Unterhose frei. Das Sweatshirt hätte einem Beitrag für eine Altkleidersammlung aller Ehre gereicht, und sein Pflegezustand entsprach seinem Einsatzgebiet – Keller, Atombunker. Das also war der Arzt, der die Ergebnisse in den Händen hielt, die über ihr weiteres Leben und Sterben entscheiden würden.
»Viktoria Farber?«, er lächelte sie an, als würde er sie zu einem Drink einladen, forderte sie mit einer lässigen Armbewegung auf, ihm zu folgen. Es ging vom Wartezimmer zurück in den Keller, in dem sie bereits quälende Stunden bei Kunstlicht und niedrigen Decken verbracht hatte. In einem Raum, vollgestopft mit Computern reichte ihm ein Assistent, ebenfalls von der Güte Ramschverkauf Resterampe Supermarkt, einige Unterlagen. Jetzt stellte er sich vor, was nichts zur Sache tat, denn sie vergaß seinen Namen sofort, hätte ihm die Aufnahmen am liebsten aus den Händen gerissen. Aber sie war hier nichts anderes als eine Kassenpatientin mit Zuzahlung.
»Wo sagten Sie, haben Sie die Einschränkungen?«
»Links, ein Zittern in der linken Hand und eine Nackensteifigkeit.«
Er nickte zur Bestätigung, so als hätte er es auch erst gerade entdeckt. Hielt ihr eine Aufnahme vor Augen, sodass sie unwillkürlich einen Schritt zurücktrat, um besser sehen zu können. »Sehen Sie hier, rechts, pathologisch, die Substantia Nigra, die Zellen, die für die Dopaminproduktion und Ihre Muskelversorgung verantwortlich sind, sterben ab. Und links, hier«, mit der Spitze des Kugelschreibers deutete er in die Mitte des Gehirns, »degenerativ, eine deutliche Schädigung. Sie sind Rechtshänderin?«
Sie nickte nur schweigend.
»Da haben Sie noch Glück im Unglück. Die meisten trifft es an ihrer aktiveren Seite zuerst. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nochmaligen Untersuchung in einer Woche.«
»Wieso? Das Ganze noch einmal?« Es gab nur einen Stuhl und auf dem hockte der Assistent und schaute unbeteiligt. Sie zitterte, hatte Mühe, die Gedanken zu ordnen. »Hören Sie, ich kann das nicht noch einmal!«
»Morbus Parkinson – oder Multisystematrophie. Sie müssen mit Ihrem Neurologen darüber reden. Aber gesichert ist die Diagnose erst nach einem weiteren Scan-Verfahren. Eine Multisystematrophie wäre nicht so günstig.«
Sie hatte keine Kraft mehr, um wütend zu werden. »Nicht so günstig? Das wäre eine Katastrophe, ein paar Jahre Lebenserwartung vielleicht …«, ihre Stimme verebbte zu einem kraftlosen Flüstern. Gleich würde sie umfallen.
»So kann man das auch sehen«, der Bursche warf noch einen Blick auf die Unterlagen, um diese dann für den Bericht an den Neurologen zur Seite zu legen. Er schaute auf die Uhr.
»Tut mir leid. Wir sollten jetzt den Termin vereinbaren.«
Ein Rest Widerstand regte sich in ihr. »Wie kommen Sie darauf? Wie stehen meine Chancen? Fifty fifty, neunzig zehn? Das CT war unauffällig, keine Veränderungen an der Gehirnstruktur.«
»Wie gesagt, letzte Gewissheit bringt nur der nächste Test.«
Die Versuchung, sich als Kollegin zu erkennen zu geben, der sie dann schließlich doch nicht nachgab. Das würde nichts ändern. Wut, Panik, Hilflosigkeit … Sie erinnerte sich daran, dass die Techniker unter den Medizinstudenten schon an der Uni immer anders getickt hatten. Ein Eisblock wäre gegen ihn und seinen Kumpanen in diesem Kellerloch noch heiß gewesen. »Keinen Termin. Kein Interesse an der wissenschaftlichen Gründlichkeit. Es reicht. Danke, ich kann nicht mehr …«
Wofür bedankte sie sich jetzt auch noch? Sie hatte kein Interesse daran, ob sie jetzt rascher oder langsamer sterben würde. Es war ihr scheißegal – denn eigentlich war sie schon tot. So oder so: Parkinson – das war das Ende ihrer beruflichen Pläne, das Ende ihres bisherigen Lebens. Stattdessen ihre Garantie, noch vor dem Rentenalter zum Pflegefall zu werden. Wie konnte das sein? Sie war doch viel zu jung dafür! Eine von zweihunderttausend, schoss es ihr durch den Kopf, es erschien ihr unwahrscheinlich, als junge Frau daran zu erkranken.
Viktoria Farber sank nicht in Ohnmacht, ihre Beine trugen sie irgendwie nach draußen. Die Gewissheit, jetzt die Seite vom Leistungsträger der Gesellschaft zur bedauernswert unheilbar Kranken gewechselt zu haben, umgab sie wie eine undurchdringbare Finsternis. Schicksale anderer Menschen waren ihr aus dem Klinikalltag vertraut und gerade darin hatte sie sich stark gewähnt, als sie hierhin gekommen war. Aber jetzt brach sie zusammen. Sie würde nicht mehr dazugehören, nicht mehr zur Chirurgengilde, zu ihrer Station. Keine Versicherung würde sie mehr nehmen. Wie war sie überhaupt vorbereitet? Freunde würden sie meiden, schon aus Unsicherheit, wie man ihr begegnen sollte. Sie kannte das und die Sehnsucht nach der Normalität einer alltäglichen Überforderung in der Klinik fraß sie schier auf. Sie wollte arbeiten, schuften, studieren, doch es gab nichts mehr für sie zu tun. Keine Kinder, keine Familie, keine Zukunft … Ihr Herz raste, obwohl sie seit einer Stunde unbewegt auf einer Parkbank hockte und heulte. Sie würde sterben, und ihr Tod rückte in greifbare Nähe.
Sie hatte ja nicht mehr alle. Und jeden, der sie künftig so von der Seite angehen würde, könnte sie davon informieren, dass er verdammt recht hätte, sie für verrückt zu erklären, da ihr nach Schätzungen der Medizin Jahr für Jahr 20.000 Gehirnzellen absterben würden. Ihr Körper starb, messbar und bald für jeden sichtbar. Schwerbehindert, von einem Tag auf den anderen als bedauernswertes Geschöpf gezeichnet. Sie lachte sich aus und dachte zur gleichen Zeit daran, sich umzubringen, spielte verschiedene Möglichkeiten durch, konnte sich nicht entscheiden. Die Panik, schon jetzt verrückt zu werden …
Es war Freitagabend. Sie stand vor dem Privathaus des Münchner Neurologen, von dem sie inzwischen einiges gelesen hatte. Sollte er sie wieder wegschicken, es wäre sein gutes Recht. Seine Tochter öffnete und beäugte sie misstrauisch. Was wollte sie eigentlich hier? Hilfe! Verdammt noch mal, ich brauche Hilfe! Das Misstrauen wich nicht, sie ließ sie draußen warten. So waren junge Töchter eben.
»Frau Kollegin«, seine Stimme hieß sie willkommen, »ist es so schlimm? Kommen Sie doch bitte herein.« Er fasste sie beschwichtigend am Arm und half ihr damit, sich aus ihrer inneren und äußeren Erstarrung zu lösen. Nur wenige Augenblicke später rastete Viktoria Farber aus: »Was ist das für ein Rattenbunker, in den Sie mich da geschickt haben! Wer rekrutiert eigentlich diese schmierigen Typen da? Sind Sie sicher, dass die überhaupt was von Medizin verstehen? Die sind wahrscheinlich durch eine Automechanikerprüfung gefallen und verwechseln mein Gehirn mit einem defekten Vergaser!«, krächzend sprudelte der Unsinn aus ihr heraus. Die Tochter des Hauses flüchtete nach oben in ihr Zimmer.
›Situationsangemessene schwere depressive Phase‹, stand in seinem Gutachten später zu lesen und, ›Verdacht auf Morbus Parkinson‹. Verdacht, die Wissenschaft nahm es ihr übel, dass sie auf die weitere Untersuchung verzichtete, nicht dem Atomgott der Gehirn-Stoffwechselprozesse im Bunker huldigte. Sie blieb ›verdächtig‹, obwohl Erfahrungswerte für sie sprachen. Jetzt sollte sie schon dankbar sein, dass sie zwischen Vierzig und Fünfzig zum Pflegefall werden würde.
Die Psychopharmaka, die ihr der Neurologe aus den Praxisbeständen zusteckte, halfen ihr für die Heimreise. Als sie jedoch feststellte, dass sich ihr Zittern durch die rosaroten Pillen trotz der Einnahme von Parkinson Medikamenten verstärkte, warf sie die Tablettenpackung weg. Sie stellte sich der Finsternis der Depression, bewaffnet mit Johanniskrautpräparaten. Die gute alte Hausapotheke sorgte dafür, dass ihr Lebensfaden nicht riss. Sie schloss sich ein, magerte ab und fraß sich durch Berge von Fachliteratur zur Krankheit, ohne ein Schlupfloch zu finden, durch welches sie hätte flüchten können. Ihr Leben reduzierte sich auf einzelne Stunden des Tages und auf minimale Verrichtungen.
Objektiv betrachtet, halfen die Medikamente. Das Zittern wurde überdeckt, sie gewann an Beweglichkeit, doch die Beipackzettel ihrer Medikamente bewahrten sie vor Illusionen. Übelkeit, Schlafstörungen, Kreislauf- und Konzentrationsstörungen, häufiges Verschlucken, Muskelzuckungen in den Beinen wurden ihre ersten Begleiter. Es sollten noch weitere folgen. Wahrscheinlich texteten kleine Teufelchen diese Zettel in ihren Stoffwechselatombunkern und erzielten Bestsellerauflagen damit. So gesehen hatte sie ihren Beruf verfehlt. Wenn sie überlebte, sollte sie sich Sorgen um ihre Finanzen machen. Solide gerechnet reichten ihre Ersparnisse für den Rest nach einer solchen Lebenskatastrophe nicht aus.
– 4 –
Viktoria Farber stieg am nächsten Morgen, immer noch wie betäubt von dem folgenschweren Schritt, in den ICE nach Mailand via Verona. Ihr Handy lag auf dem Küchentisch in der Wohnung, ihr Leben stand in einem Koffer und einem prall gepackten Rucksack neben ihr. Dies würde ein Aufbruch ins Ungewisse, ohne Perspektive werden. Reisen ohne Rückfahrkarte, überlegte sie, war eigentlich das Letzte, wofür sie in ihrer Situation Kraft aufbringen konnte. Aber wenn es kein Voran mehr gab, wurde es Zeit, die Laufrichtung zu ändern. Sie sah furchtbar aus, zitterte am ganzen Körper und schlich wie eine Diebin, die Gepäckstücke hinter sich her zerrend als Letzte den Gang des ICE entlang.
Der junge Mann, der ihr gegenübersaß, schaute mit einem glasigen Blick durch sie hindurch oder schlief. Was hätte er auch an ihr entdecken sollen? Die Musik aus seinem MP3-Player, eine leise, aber nicht zu überhörende Geräuschkulisse. Nach einer Weile fühlte sie sich unsichtbar, und das erschien ihr nicht das Schlechteste.
›Honeymoon-Phase‹ nannten die Mediziner die ersten zwei Jahre einer normalen Parkinsonerkrankung, weil die Medikamente die schlimmsten Ausfallerscheinungen überdeckten und man sich der Illusion hingeben konnte, ein normaler, gesunder Mensch zu sein. Mit ihrem Entschluss, nicht mehr die Möglichkeit einer noch schwereren Erkrankung in Betracht zu ziehen, die Multisystematrophie einfach für sich selbst auszuschließen, hatte sie die Kraft für diese Reise gefunden. Das also war ihre ›Hochzeitsreise‹. Keine Jungmädchenträume von scheppernden Dosen an der Stoßstange einer weißen Limousine, von durchtollten Nächten mit einem feurigen Liebhaber, von Champagner, teuren Kleidern und Konzertbesuchen, Hochzeitssuiten in sagenhaften Grand Hotels. Von welch perfider Teufelei musste ein Mediziner beseelt sein, um den Begriff ›Honeymoon‹ für solche Lebenssituationen zu gebrauchen?
Wenn schon, dann Italien. Nicht an das schmachtende Venedig mit Gondolierenromantik dachte sie, was nur zu zweit im Überschwang der Gefühle zu ertragen gewesen wäre. Sie wollte dem Frühling entgegen, Glyzinen und Sonnenschein, mittelalterliche Gassen, Castelllos. Auf der Piazza sitzen im ersten Sonnenschein des Jahres und nicht fragen, wie lange das Geld reichen würde. Der Zug glitt durch die Landschaft, Regennasen liefen quer an den Scheiben entlang, graue Städte druckten sich im fahlen Licht der letzten Wintertage. Die Köpfe der Passanten verschwanden anonym unter Schirmen und Kapuzen, während sich Viktoria Farber hinter all diesen vorbeirauschenden Bildern bereits das Leuchten des Meeres im gleißenden Sonnenlicht, das Wasser, das von einem Windstoß leicht gekräuselt wurde, vorstellte und von alten Gemäuern in strahlendem Sonnenschein träumte. Das erste Mal seit Wochen, dass sie träumte und nicht mehr in der Hölle auf Erden briet. Sie traute diesem Gefühl nicht, aber sie klammerte sich daran.
Beim Studium der Abfahrtsanzeigetafel auf dem Bahnhof Porta Nuova in Verona fiel Viktoria ein, dass sie, abgesehen von Tee und Toast, einem Rest Käse und einer Flasche Mineralwasser noch nichts zu sich genommen hatte. Unterzuckert, diagnostizierte sie die schwindelnde Leichtigkeit, die es ihr schwer machte, sich inmitten der drängelnden Menschenmassen auf dem Bahnsteig zu bewegen. Café Latte, ein Cornetto mit Erdbeermarmelade. Ein milder Luftzug streichelte ihre Wangen.
Wohin jetzt? Noch weiter nach Süden. Stadt oder Dorf, Meer oder Berge? Noch bevor ihre Ängste wieder in ihren Eingeweiden rumorten, kaufte sie sich eine überdimensionale Sonnenbrille, von der Art, wie sie hier offenbar zum Kult geworden waren. Sie starrte durch das so entstehende Halbdunkel erneut auf die Abfahrtsanzeigetafel des Bahnhofs. Was wusste sie von Italien? Viktoria mochte dieses Land, trotz Goethereise und klassischer Deutschlektüre. Sie verspürte nicht die geringste Eile. Sie machte eine ganz persönliche italienische Bestandsaufnahme. Ihre Erinnerung malte Lebensbilder wie Postkarten, zauberte Geschmacksnuancen und Geräusche. Mit ihren Eltern war sie in ihrer Kindheit mehrere Male nach Italien verreist. Campingurlaube, kleine Pensionen, einmal ein teures Hotel, in dem sich ihr Vater nie wohlgefühlt hatte. Erinnerungsbilder stiegen in ihr hoch. Vielleicht sprach sie noch ein paar Brocken Italienisch. Vielleicht würde ihr sogar der eine oder andere Satz gelingen. Doch wohin wollte sie jetzt? Sie blickte sich um und eigentlich war ihr alles gleichgültig. Nur die bleierne Müdigkeit verließ sie nicht.
Von hinten sah sie seine breiten Schultern. Er führte nicht weniger Gepäck mit sich, aber er trug es in Rucksäcken und Hippbags aller Art am Körper und bewegte sich mit der Gelassenheit eines Niebesiegten. Ohne Absichten folgte sie ihm einfach. Von der Statur her sprach vieles dafür, dass er ein Deutscher war. Sie hastete ein wenig auf dem Bahnsteig des Nebengleises entlang, um ihn von vorn sehen zu können. Sein ovales Gesicht mager, um die Backenknochen muskulös, mit strengem Nasenschwung, der dem Ganzen einen asketischen Zug verlieh. Sie konnte sich dieses Gesicht gut in einer mittelalterlichen Mönchskutte vorstellen. Komische Idee. Seine Haare lässig gescheitelt, standen ein wenig wirr in der milden Veroneser Luft. Seine Augen, zwei hellblaue stechende Punkte unter dichten blonden Brauen. Der Hals lang, etwas gewunden, halb im Profil die Kopfhaltung wie ein Raubtier. Seine Arme wirkten fremd, als suchten sie nach einer sinnvollen Beschäftigung inmitten dieses Gedränges auf dem Bahnhof. Sieben auf einen Streich, wenn er sie anheben und einmal herumwirbeln würde.
Triest, warum eigentlich nicht Triest? Irgendwo Richtung Grenze, Slowenien, Adria. Sie kaufte sich das Ticket und folgte ihm Richtung Zug. Das enthob sie einer Entscheidung. Im Großraumabteil half ihr ein älterer Herr, das Gepäck zu verstauen. Für einen kurzen Moment schaute der junge Deutsche zu ihr herüber. Dann stiegen zwei weitere junge Männer zu. Italiener, mit Seilen und Rucksäcken beladen. Wahrscheinlich für eine Gebirgstour. Gab es bei Triest Berge? Viktoria schwindelte. Sie hatte zu wenig gegessen. Der Zug fuhr an. Sie fand noch rechtzeitig Halt an der Kopflehne. Fast wäre sie hingeschlagen. Vorsichtig setzte sie sich und war dankbar, dass niemand in ihrer Nähe Platz genommen hatte und jetzt Fragen stellen konnte. Sie schloss die Augen. In ihrem Kopf ein Gefühl, als säße sie in einer Achterbahn auf dem höchsten Punkt der Strecke, eben in jenem Moment, in dem sich der vorderste Wagen mit ihr nach vorn bewegen würde. Bruchteile von Sekunden im absoluten Schwebezustand, der sie jedoch im realen Leben jetzt stunden- und tageweise nicht verließ. Das war ihre Krankheit: Das Sterben der Gehirnzellen in der Substantia Nigra und ihr von den Medikamenten geschundener Körper, der sie vollkommen zwecklos dauerhaft alarmierte. Viktoria Farber bewohnte ihren Körper nicht mehr allein. Eine ständige Begleitung war dort eingezogen, ein zitterndes, schwebendes Etwas, das krampfte und sie stolpern und stürzen ließ, wenn sie ihm nicht huldigte. Nervös kramte sie in ihrem Rucksack. Sie hatte sich einen kleinen Tabletten-Schieber (Morgen – Mittag – Abend – Nacht) gekauft. Für meine Omi hatte sie lächelnd in Apotheke behauptet, und sie hatten ihr einen mit großen Fächern und besonders großer Beschriftung gegeben. Sie warf die Pillen, aus der hohlen Hand ein und spülte mit einem Schluck aus der Mineralwasserflasche nach.
Die Panikattacke war vorbei, doch der Schwindel blieb. Sie starrte auf ihr Spiegelbild. ›Sieht man es mir an? Bin ich durchsichtig geworden? Wie lange schon interessiert sich kein Mann mehr für mich?‹ Ihre Gesichtszüge kamen ihr vertraut und fremd zugleich vor. Ihr Blick wurde unscharf, versank in ihrem Spiegelbild. Sie musste einige Zeit mit diesem Studium verbracht haben, denn das Bild ihres Körpers als Ganzes stand ihr schließlich vor Augen: ihre langen, festen Arme und Beine, die glatte, leicht gebräunte Haut, die dunklen Locken auf den Kopf und auf dem Geschlecht. Es war das Bewusstsein von diesem Mädchenkörper, diesem anderen Körper, das jetzt Abend für Abend einen Schock in ihr auslöste, wenn sie sich zitternd auszog, um zu duschen, und ins Bett zu flüchten. Warum hatte ihr Körper sie im Stich gelassen? Die Depression, wie ein schwarzes Loch, würgte sie und drohte Viktoria in den Sekunden, in denen sie wieder in die Gegenwart zurückkehrte, immer weiter zu verschlingen. Irgendwie flüchteten sich ihre Gedanken wieder in das Fotoalbum der Kindheitstage.
Sabine Grün, blond, blauäugig mit Zahnspange schob sich in Viktorias Erinnerungsbilder. Bibi, ihre Banknachbarin beim Abitur, dann hatten sie einige Semester zusammen studiert, bis Bibi abgebrochen und erklärt hatte, lieber würde sie Naturwissenschaften studieren, als Menschen behandeln. Wo war sie abgeblieben? Ozeanografie in Kiel und dann – eine Karte aus Triest, ein paar Briefe noch, bevor der Kontakt abriss. War sie damals nicht im ›Meeresbiologischen Institut‹ in Triest gelandet? Das wäre geradezu eine Bestimmung …
Viktoria wurde unendlich müde. Der Schwindel in ihrem Kopf raubte ihr jedes Bewusstsein. Auf ihr Gepäck wollte sie Acht geben, sah noch neben der Bahnlinie die Küste auftauchen, auf die sie so lange gewartet hatte. Das Meer, eine grau-blaue Fläche im Sonnenlicht erstarrt. Es lag da, keineswegs verheißungsvoll, sondern eigenartig unerreichbar. Der Zug nahm hinter Venedig mächtig Fahrt auf. Wenige schwere Wolken am Himmel schoben sich immer wieder für Minuten vor die Sonne. Dann ein kleiner Bahnsteig. Als der Zug wieder anfuhr, schlief sie fest.
– 5 –
La Stazione Centrale Triest – das Gepäck war nicht verloren gegangen. Benommen stand Viktoria Farber auf dem Bahnsteig und war verblüfft über die milde, beinahe süße Luft. Unschlüssig verharrte sie neben dem Zug und lauschte auf das fremde Sprachengewirr. Den jungen Deutschen und seine Freunde hatte sie aus den Augen verloren. Vielleicht wäre sie ihm einfach weiter gefolgt? Hastig, von irgendwelchen Terminen getrieben, strömten die meisten Reisenden dem Ausgang entgegen. Andere gegenläufig, entschlossen zum Aufbruch, jagten zu den Zügen, die sich wie vollgefressene Raupen der Stadt genähert hatten, um hier geduldig neue Beute zu machen. Viktoria ließ sich Zeit und schlenderte der lautstarken Masse hinterher, die sich an der Piazza della Libertà sofort auf die Busstationen, die wartenden Autos oder Taxen verteilte. Wie aus großer Ferne betrachtete sie die Szenerie: ›Das also ist das tosende Leben!‹, dachte sie verwundert, und: ›Willkommen im Frühling‹.
Viktoria kaufte einen Stadtplan und stand unschlüssig vor dem Portal des Bahnhofs auf der Piazza della Libertà. Gegenüber an den Haltestellen mit den blauen Überlandbussen, die mit offenen Türen und laufendem Motor das hohe Lied des Aufbruchs sangen, das von einem stetigen, fast tröstlichen ›Pronto!‹-Staccato der Italiener, lautstark in ihre ständig wimmernden Mobiltelefone gesungen, begleitet wurde, genau gegenüber der Szenerie, ein paar Rentner, Voyeure, arbeitsunwillige Taxifahrer auf den weißen Plastikstühlen eines Cafés. Männliche Betrachter eines Schauspiels, das hier Ankunft oder Abschied hieß. Viktoria schulterte ihren Rucksack, zerrte an dem Koffer und ging zu dem Café hinüber. Sie grüßte freundlich, nahm Platz und bestellte Wasser, Espresso und ein Ciabatta.
»Germania«, sagte Viktoria, »in der Nähe von Köln, Cologne.« Das waren ihre ersten Worte seit Verona. Der ältere Mann, des Deutschen mächtig, machte ihr Komplimente, und während sie den Espresso hinunterstürzte, stellte sie erleichtert fest, dass sie noch nicht unsichtbar geworden war. Sie sprach vom Dom, dem Rhein und ihre Reise. Ein anderer schien in Köln gelebt und gearbeitet zu haben, Ford-Werke, betonte er immer wieder. Der erste Mann ging jetzt auf das Wetter ein. Es sei bereits ungewöhnlich heiß, man habe erst fünf Regentage gehabt, aber bereits Temperaturen über 25 Grad und Stürme. Zu trocken. Viktoria nickte und antwortete, es sei ein wunderschönes Licht hier, die Sonne in Italien bringe alles zum Strahlen. Die anderen Männer und die Bedienung hörten ihr zu. Wo sie hin wolle? Ob sie länger bliebe? Während sie ihr Ciabatta ass, sprach sie von einer Schulfreundin, die hier im Meeresbiologischen Institut arbeiten würde. »Sabine Grün«, sagte sie mit erwartungsvoller Stimme, so als ob es wahrscheinlich wäre, dass jetzt einer aufspringen, ihr auf die Schulter schlüge und erregt, »Sabine!«, ausrufen würde. Allgemeines Nicken. Man beschrieb ihr den Weg zum Institut. Jetzt wusste sie, zum Hafen und Meer musste sie sich links halten. Als sie erklärte, sie reise ohne Zeitvorgabe und wisse nicht, wie lange sie bleibe, wann sie weiterfahren würde, nickte man anerkennend. Dies sei, meinte der erste ältere Mann, die einzige Art, irgendwo anzukommen. Kaum jemand reise mehr so. Er deutete dabei auf die aus dem Bahnhof hastenden Menschen. »Niemand kommt mehr wirklich an. Keiner sieht, wo er ankommt.« Die anderen stimmten zu, als sei Viktoria damit herausgehoben und in einen geheimen Klub aufgenommen worden. Ihr schienen die aufgedrehten Alten ein wenig aus der Olivenölreklame von Bertolli entsprungen, so agil und neugierig wirkten sie.
»Kommen Sie«, erbot sich der Zweite, »mein Wagen steht dort, ich fahre Sie zum Hafen und anschließend zu einem billigen, guten Hotel.« Als sie versuchte abzulehnen, protestierten alle im Chor so laut, dass es ihr rasch peinlich wurde und sie das Angebot annahm. Zuerst jedoch pilgerten ihre beiden Gesprächspartner mit ihr zum Sissi-Denkmal »Elisabetta«, der wohl noch immer beliebtesten Herrscherin aller Zeiten hier. Das Denkmal gegenüber vom Bahnhofsgebäude war eine künstlerisch italienische Antwort auf das Habsburger Hofzeremoniell – jedenfalls wie Viktoria es sich vorstellte.
Ihr Gepäck landete in dem kleinen Fiat auf der Rückbank neben ihr, und während sich die beiden älteren Herren als Reiseführer langsam in Rage redeten und gegenseitig überboten, dachte sie in einem ihrer peinlichen Momente an Mädchenhändler und finstere Verschläge auf Containerschiffen. Entschlossen verdrängte sie ihr Unsicherheitsgefühl in die hinterste dunkle Ecke ihres Unterbewusstseins. Sie zog ihre Mundwinkel nach oben und machte artig Komplimente. Jetzt sahen die beiden sie tatsächlich an, als hätten sie irrtümlich eine Touristin verladen, und es verschlug ihnen für einen Moment die Sprache. Als Viktoria, ärgerlich über sich selbst, ihren Blick wieder auf die Straße richtete und fluchte, gewannen beide Männer wie auf Knopfdruck ihre Lebendigkeit wieder.
Sie fuhren auf der Hafenstraße. In Triest fiel es dem Besucher leicht, die hässlichen Seiten der Industrialisierung und der Großstadt auf den ersten Blick zu ignorieren. Gerade an der Küstenlinie erinnerte das Stadtbild nostalgisch verklärt an das Wien der Habsburger. Ein Promenadenband aus den hell leuchtenden weißen Fassaden der Palazzi im imposanten Stil des Wiener Klassizismus, beeindruckende Repräsentationsbauten der Reeder, Händler, Versicherungen und Besatzer des 18. und 19. Jahrhunderts.
Schon sprach Giuseppe, ihr erster Begleiter, von den Kaffeehäusern im Wiener Stil, von Palatschinken. Er hatte in einem früheren Leben in Österreich als Koch gearbeitet und betete jetzt Zunge schnalzend eine Abfolge österreichischer Mehlspeisen herunter.
Sie hielten am Strand von Miramare. Ein paar Schritte, um sich die Beine zu vertreten, meinte der eine, während sich Giuseppe eine Zigarette ansteckte und hinter dem Lenkrad verweilte, wegen der Koffer, wie er meinte. Vielleicht auch, um ihn nicht auf falsche Gedanken kommen zu lassen, versicherte Viktoria, völlig überflüssigerweise, dass da nichts von Wert drin sei. Giuseppe zuckte nur mit den Schultern und paffte. Am Strand eine bunte Mischung von Japanern, Indern, Amerikanern, Afrikanern, ja es gab sogar einige Italiener und Slowenen. Bei einigen hätte Viktoria erwartet, dass sie zu den Wissenschaftlern aus dem renommierten meeresbiologischen Forschungsinstitut Triests gehörten. Doch an der dortigen Pforte erklärte man ihr, sie solle während der Bürozeiten wiederkommen. Von ihrer Schulfreundin Bibi keine Spur. Vielleicht war das auch keine gute Idee, nach all den Jahren.
Sie fuhren gemächlich mit offenen Fenstern. Ihre Haare vom Wind zerzaust. Giuseppe sprach vom Hafen, aus dem alles entstanden sei. ›Il punto‹, dem Herz aller Dinge. Einem Poeten ähnlich, verglich er das Leben mit einem Hafen und kurvte gleichzeitig einhändig durch enge Gassen der Stadt.
Viktoria spürte den kalten Schweiß der Erschöpfung auf ihrer Stirn, dachte daran, dass es schon wieder Zeit für ihre Tabletten und das Medizinpflaster war. Sie verbat sich jedoch, den Tablettenschieber auszupacken. Frau Doktor genierte sich, lehnte sich nur zurück, hörte Giuseppe zu und seinem älteren Freund, der die Schönheit der Altstadt und das Hotel anpries. Wie von Ferne, wie eine auf- und abklingende Suada, ein Redeschwall, ein Strom von Tönen, vertraut und fremd zugleich, drangen die Worte zu ihr. Sie lächelte dankbar, weil man sich kümmerte, keine Antworten erwartete, außer einem ›si‹ oder ›no‹. Inzwischen erfuhr sie auch, dass der andere Mann Gustavo hieß. Giuseppe und Gustavo, besser hätte man die Namen nicht erfinden können!
Nuovo Albergo Central, Via Roma – unter den einfacheren, das beste Hotel in zentraler Lage, wie ihr Gustavo versicherte. Ganz in der Nähe des Canale Grande, geradezu romantisch. Nein, auf Abenteuer dieser Art sei sie nicht aus, antwortete Viktoria. »Eine junge Frau im Frühling, Bellissima!«, war von Giuseppe, die ungefragte Bemerkung zu hören. Der Wagen hielt. Viktoria schwankte beim Aussteigen. Das Zittern hatte wieder von ihr Besitz ergriffen. Ein Doppelzimmer hätte sie ordern sollen, für sich selbst und den Fremden in ihrem Körper, spottete sie über sich selbst, während sie sich um Haltung bemühte. ›Rabatt für Mr. Parkinson …‹ Giuseppe griff nach ihrem Gepäck und verschwand in dem Hotel. Gustavo sah sie besorgt an und fragte, ob sie krank sei. Viktoria lächelte gequält: »Nein, nur übermüdet von der Fahrt. Darf ich Sie einladen?«
Hinter der Rezeption stand ein Mann mittleren Alters mit pechschwarzem Haar und einem Gesicht von solch klassischer mediterraner Schönheit, das schon Michelangelo als Profil hätte dienen können. Viktoria wunderte sich ein wenig, dass sie in ihrem Zustand für so etwas noch einen Blick hatte. Giuseppe und er gingen sehr vertraut miteinander um. Viktoria klammerte sich an das Marmorimitat des Tresens und versicherte, sie habe großes Glück gehabt, von so netten Herren hierher gefahren worden zu sein. Roberto, so hieß der Mann an der Rezeption, bemerkte jetzt ihren Zustand. Ob sie sich nicht wohlfühle? Vielleicht hielt man sie jetzt für drogensüchtig. Gestenreich zerstreute Gustavo diesen Verdacht und Viktoria war ihm mehr als dankbar dafür. Roberto klappte das Gästebuch zu, die Formalitäten könnten bis morgen warten. Er nahm einen Zimmerschlüssel vom Brett und begleitete sie zum Aufzug. »Ein sehr schönes Zimmer«, versicherte er noch einmal. Viktoria gab ihm ihren Pass. »Sie sind Ärztin, Anwältin?«, fragte er. »Ärztin«, ihre knappe Antwort. »Oh, Dottoressa! Ganz sicher werden Sie sich hier ausgezeichnet erholen.« Roberto bot zudem an, sich nach der Schulfreundin zu erkundigen. Auch hierüber hatten die Herren schon gesprochen. Sage noch einer, Männer hätten keine kommunikative Kompetenz. Die mediterrane Sonne schien, sie geradezu geschwätzig zu machen …
Dann zogen sich die Männer mit jener Diskretion zurück, die zweifelsohne zeigte, dass wahre Gentlemen nur an der Adria zu finden seien.
– 6 –
Kraftlos warf sich Viktoria auf das Bett. Koffer und Rucksack standen irgendwo im Zimmer. Die Geräusche der Stadt drangen durch die Fenster und ließen sie nicht einschlafen. Schließlich wirkte die Medizin. Zurückblieb nur dieses seltsame schwerelose Achterbahngefühl. Viktoria stand am Fenster, starrte in das Kunstlicht der Stadt und ängstigte sich. Sie fröstelte. ›Hier bin ich also‹, sagte sie sich immer wieder, kramte nach Kindheitserinnerungen, die sie früher immer beruhigt hatten, zog sich aus und legte sich erneut ins Bett. ›Alles abbrechen, alles abschalten‹ – vielleicht war das ihr Ende? Ein Fernseher, überlautes Gelächter, wahrscheinlich eine Quizsendung, dann ein paar Fetzen Oper und dann Gelächter. Das Schlimmste waren diese schwerhörigen Zapper, diese Kakerlaken der Gehörgänge. Ihr Handy wäre jetzt vielleicht doch eine Lösung gewesen. Sie sah es förmlich auf dem Küchentisch in ihrer Wohnung liegen. Früher war das Handy immer eine Brücke zur Normalität. Auf Reisen, bei Krankheit, vor Prüfungen, danach und wieder davor – doch wen sollte sie anrufen? Was mit ihr geschah, war ganz allein ihre Sache. Sie würde nicht zu feige sein, das durchzuziehen. Viktoria konnte nicht schlafen. Sie gähnte, wälzte sich, versuchte vergeblich, sich selbst zu befriedigen, und schlief nicht ein. ›Grübeln hilft nicht‹, sagte sie sich entschlossen, ›denke an nichts. Zähle rote Blutkörperchen!‹ Andere zählten vielleicht Schafe oder Wolken oder Liebhaber – Viktoria sah eine überdimensionale Ader und zählte die roten Bälle, die auf sie zuströmten. Sie hätte auch die weißen, die Abwehrzellen oder Blutplättchen zählen können, aber heute wollte sie es warm haben und leuchtend rot: also rote Blutkörperchen. Sie strömten immer schneller, schossen schließlich auf sie zu. Ihr wurde schwindlig, endlich schloss sie die Augen und entkam dem Bewusstsein.
Dieser Roberto gefiel ihr. Seine Augen fielen ihr als wach und anziehend auf. Viktoria war der letzte Gast, der den Frühstücksraum betrat. Sie war erst gegen Morgen eingeschlafen und zu spät aufgewacht. Ein Serviermädchen im schwarzen Kleid mit weißer Schürze deckte bereits für den Abend ein. Viktoria wollte keine Umstände machen, strebte schon dem Ausgang zu, um irgendwo in einem der gestern von Gustavo gelobten Wiener Kaffeehäuser zu frühstücken, da stand Roberto freundlich lächelnd vor ihr. »Signorina, per favore …« Ein Tisch am Fenster war noch eingedeckt. Kaffee stand bereit, ein kleines gefülltes Brotkörbchen, gefaltete Servietten. Roberto sprach leise mit ihr. Das war fast ein Flüstern, als wollte er vermeiden, dass andere das Gespräch belauschten. Dabei war er nur freundlich um sie bemüht. Schließlich reichte er ihr einen Zettel: ›Sabine Grün‹, stand oben mittig, darunter die Adresse des Meeresbiologischen Instituts, darunter eine private Adresse mit Telefonnummer und ganz unten ein Treffpunkt: ›Strand vor Miramare/Nähe Promenade, 15:00 Uhr!‹ »Ich wollte behilflich sein, Signorina, habe Ihre Freundin angerufen. Hoffentlich ist es Ihnen recht.«
»Non far niente. Grazie.« Sie fühlte sich ein wenig überrumpelt, war andererseits aber auch dankbar. Roberto blickte immer noch ein wenig fragend. »Wirklich, ich freue mich.« Sicherlich erwies sich Roberto als eine Art Partner, auf den sie zählen konnte. Dennoch, das Hotel war zu teuer für mehrere Wochen. Was sie brauchte: Ruhe und Sicherheit, um ihren Lebenskurs neu auszurichten.
Viktoria ließ sich stadteinwärts treiben, die von Bäumen gesäumte Viale XX Settembre entlang. Ihr Blick himmelwärts zu den wunderschönen alten Fassaden und den schlank- und hochgewachsenen Bäumen, die in dieser Fußgängerzone rechts und links mit ihren Kronen zusammenwuchsen und ein Dach bildeten. Zahllose Cafés und Eisdielen, Mode und Kunst. Weiter die leicht ansteigende Straße bis zum Giardino Publico, wo sie im Park Kindern und Enten zuschaute. Bevor sie wehmütig wurde, stieß sie in der Via Césare Battisti auf das Kaffeehaus San Marco aus dem Jahr 1914, ganz im Jugendstil errichtet. Haus und Interieur ein Schmuckstück, das Wien selbst alle Ehre gemacht hätte. Filigrane Kaffeehausstühle, Lederbänke in den Ecken, gefüllte Bücherregale, die zum Verweilen einluden und eine Batterie Likörflaschen vor einem riesigen Spiegel, die jeden Gast schließlich erinnerten, dass er sich immer noch in Italien befand. Kaffeehausmusik von einem Klavierspieler mit steifer Fliege, draußen eine flackernde Lichtreklame. Leise Klänge einer untergegangenen Monarchie zu den Nachrichtenblättern, die angesichts der Börsenkurse und Staatsfinanzen, Skandale und Klatsch den italienischen Herbst besangen.
Ein Literaturcafé sei das ›San Marco‹, verriet ihr der Kellner. Dort hinten beliebe der Triester Schriftsteller Professor Claudio Magris, jeden Mittag seinen Kaffee einzunehmen und zu schreiben. Viktoria griff nach den Büchern im Regal, begann zu blättern. Sie beherrschte die italienische Sprache zu wenig, um wirklich etwas zu lesen. Wieder kam der freundliche Kellner mit einer Empfehlung zur Hilfe. Er zog einen kleinen Roman aus dem Regal ›Wassergrün‹, von Magris’ verstorbener Frau Marisa Madiri. Viktoria wollte es als Erinnerung an diesen Ort sofort besitzen. ›Wer sich erinnern möchte, glaubt an seine Zukunft‹, war ihr spontaner Gedanke. Der Kellner machte ihr Komplimente und setzte das Buch auf die Rechnung. ›Wassergrün‹, eine Farbe, seltsam, wie ihre Empfindungen.
Draußen knatterten zwei Pärchen auf ihren Vespas vorbei und winkten fröhlich durch die Scheiben. Viktoria winkte zurück. Sie kannte die jungen Pärchen nicht und schaute sich jetzt schüchtern um, ob vielleicht jemand hinter ihr gemeint wäre. Die älteren Herren bei ihrer Zeitungslektüre regten sich jedoch nur verhalten brummend über die Verkehrsrowdys auf. Vielleicht war das Winken eine Aufforderung, es ihnen gleichzutun. Vielleicht kam es ihnen nur komisch vor, eine Frau, noch nicht so alt, hier mit einem Buch vor einer Tasse Kaffee verharren zu sehen, wo doch draußen das Leben toste.
Viktoria sah sich ganz in der Nähe in der Via San Francesco die mächtige Synagoge von Triest an, die mitten zwischen den Wohnhäusern der Geschichte zu trotzen schien. Via San Francesco – sie las immer ›Franzisco‹. Ihr Triest in Kalifornien – die Straße schien endlos geradewegs in den Himmel zu führen. Wahrscheinlich waren es nur die Sonnenstrahlen, die sie blinzeln ließen oder der Schwindel, der dem Zittern meist vorausging. Sie schluckte ihre Tabletten. Was sollte sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen? Sie war noch nicht einmal Vierzig und schon fertig mit dem Leben. Doch dann diese Reise, sie stand in dem ihr fremden Triest in einem Frühling, der zu Hause noch einem Winter glich. Sollte sie wirklich gleich ihre Schulfreundin treffen? Wie konnte das einfach so weitergehen?
– 7 –
Viktoria schlenderte die Promenade entlang. Knapp vor dem Sand des Strandabschnitts von Miramare blieb sie stehen. Einen Augenblick verharrte sie, spürte die Sonne auf der linken Wange brennen, den Wind, der ihr durch die Haare fuhr. Sie reckte sich und hielt Ausschau. Es war noch keine Saison, aber die roten und blauen Liegestühle standen schon in Reihe und Glied und hatten erste Abnehmer gefunden.
Viktoria zog ihre Schuhe aus. Der Sand fühlte sich feucht und warm zugleich an. Sie ging bis zum Meeresrand, kehrte um und suchte erneut nach ihrer Schulfreundin. Dann ging sie zurück zur Promenade und kaufte sich ein Eis. Sie beschloss, dass es keine Bedeutung mehr für sie hätte, ob Bibi noch käme, stand wieder am Meer und schaute Schiffen und Möwen hinterher. Vor ihr lag der ganze Sommer, lang wie die italienischen Strände, mit Sand in den Haaren und einem anständigen Sonnenbrand.
»Ist ziemlich nett hier, richtig hübsch. Mein Pausenareal. Leider habe ich nicht deine Figur, denn das Eis ist köstlich, Ragazza…«. Da stand sie vor ihr, Bibi Grün, der gleiche Schalk in den blauen Augen, die langen, leicht gelockten blonden Haare und doch eine völlig andere. Ihre Stimme tiefer, als sie Viktoria in Erinnerung hatte, ihre Bewegungen träger, ihr Körper fraulich. Eine blonde Vollschöne, eine, die mit Speck Mäuseriche fing. Die Italiener mussten ihr reihenweise zu Füßen liegen.
»Aber gnädige Frau«, Viktoria verdrehte ihre Stimme ein wenig ins Schrille, »wahre Schönheit kennt keine Normen. Ich sage immer, trauen Sie nicht dem Schein der dürren Zicken, alle von der billigsten Sorte – auf jeder Plakatwand zu besichtigen und an jeder Straßenecke zu haben.«
»Komm her, du knochiges Etwas!«, kreischte Bibi vor Vergnügen. Dann fielen sie sich lachend in die Arme.
›Sabine Grün, Sabine, meine Freundin‹, hämmerte sich Viktoria ein, und dann war sie wieder da, die Vertrautheit nach all den Jahren. Sie spürte ein großes Glück, sodass sie am ganzen Leib zitterte und grundlos mit ihr um die Wette lachte. Sie fühlte sich angekommen. Es wäre überwältigend gewesen, wenn nicht … Sie wollte diese Gedanken nicht zu Ende denken. Sie hakten einander unter, verschränkten ihre Arme und hielten sich bei den Händen, während sie den Strandabschnitt am Miramare rauf- und runterschlenderten und redeten, über alte Zeiten und ein klein wenig und vorsichtig über die Gegenwart.
»Nein, keine Haie, keine Delfine, die Kuscheltiere des Meeres«, Bibi lachte, »Algen. Algen sind unser Problem. Eingeschleppte Algen aus dem Südseeraum, hier ohne natürliche Feinde. Sie breiten sich unkontrollierbar aus und ersticken jede Vegetation, nehmen Kleinstlebewesen und Fischen in Küstennähe ihren Lebensraum, zerstören das ökologische Gleichgewicht. Und natürlich draußen die Schleppnetze und Dynamitfischer, Korallenhändler – viele Feinde für den Forscher, der der Natur verpflichtet ist.« Sie machte eine Bewegung weit nach draußen, als habe sie ihren Schreibtisch irgendwo dort am Horizont auf dem Meer.
»Habt ihr ein Forschungsschiff? Tauchst du noch?«
»Ja, ja, sicher doch.« Dann erklärte sie, wie die Strömung, die Meereserwärmung die Küstenvegetation beeinflusse, sprach von Sedimenten, Ultra- und Mikro-Plankton, bis sie schließlich abrupt unterbrach, verlegen lächelte: »Mein Gott, was rede ich da. Ich bin halt hier hängen geblieben, hier am Meer. Dabei weiß ich gar nichts von dir … Bist du Chirurgin geworden?«
Viktoria nickte: »Handchirurgin«, sprach von ihren Patienten, von dem Klinikalltag, so als sei das alles noch gesicherte Gegenwart und Zukunft, bis Bibi sie freundschaftlich umarmte: »Ich wusste immer, dass du es schaffen würdest. Wenn nicht du, dann keine!«
»Ach komm, lass uns über etwas anderes reden …«, Viktoria wandte ihr Gesicht verlegen ab.
»Was ist? Wie heißt der Kerl? Ich dreh ihm den Hals um! Darin bin ich verdammt gut!« Bibi machte eine furchterregende Geste, und ein entgegenkommender Jogger wich ihnen verschreckt aus.
»Und du? Bist du mit jemandem zusammen?«, Viktoria wollte nicht über Mr. Parkinson reden.
»Hin und wieder«, Bibi grinste. »Ich habe eine Tochter. Kiara, 14 Jahre alt. Du musst sie unbedingt kennenlernen.«
»Eine Tochter, 14 Jahre?«, Viktoria versuchte noch ein kleines überraschtes Lächeln, bevor ihr die Beine wegsackten. Die Nachricht erwischte sie wie ein Temperatursturz in sommerlicher Gluthitze. Es waren nur Sekundenbruchteile, aber sie sah Bibi und sich in der Schule. Ja, sie wollte immer die Bessere sein, diejenige mit dem ersten Kuss, dem großen Geheimnis um die erste Liebe, diejenige, die ihr Studium durchzog gegen alle Zweifel, es bis zur Karriere schaffte. Wie eiskalter Regen klatschte die Eiseskälte ihrer Gefühle auf sie nieder und schwemmte alles weg, alle Erfolge, die große Bühne ihres Lebens. Was blieb, war die große Leere und die Angst. Bibi hatte das Kind, ihren Traumberuf in Italien, das große Geheimnis einer verflossenen Liebe. Viktorias Kollaps war nicht gespielt. Es rauschte ihr mächtig in den Ohren, ihr wurde schlecht, sie würgte, erbrach sich aber nicht, schnappte nach Luft und kam nicht mehr hoch.
»Vic! Was ist mit dir? Bist du krank, soll ich Hilfe holen, einen Arzt? Vic!«, Bibi war aufrichtig besorgt. Viktoria versuchte, sie zu beruhigen, von wegen überarbeitet, ausgebrannt, erholungsbedürftig. Während ihr Mund nicht wusste, wie er Atem holen und gleichzeitig Worte formen sollte, blickte sie zerknirscht an Bibis linker Schulter vorbei in den Himmel eines späten Frühlingsnachmittags in Triest.
»Du kommst erst mal mit zu mir. Ich lass dich nicht eher gehen, bevor ich mir sicher bin, dass du okay bist. Lernst dann auch gleich Kiara kennen.« Bibis Blick zur Uhr: »So spät? Ich sollte sie abholen! Geht es wieder? Vielleicht auch etwas schneller?« Ja, eine unpünktliche, ungeschickte Chaotin, das war Bibi Grün auch schon immer gewesen. Viktoria trank Wasser, biss die Zähne zusammen und bemühte sich um die zivilisatorische Errungenschaft des aufrechten Ganges. Doch sie stolperte eher ihrer Freundin hinterher.
Viktoria betrachtete ihre Schulfreundin, wie sie ganz selbstvergessen und vor sich hin plappernd die alltäglichen Dinge verrichtete, sich um ihr Kind kümmerte und gleichzeitig den Gesprächsfaden zu ihr nie abreißen ließ. Viktoria wurde bewusst, wie gänzlich anders ihr bisheriges Leben ausgesehen hatte. Eine Handchirurgin: Sie war zu einer hoch entwickelten Spezialistin geworden. Was wusste sie noch von dem Rest der Medizin, wo sie in kleinsten Dingen immer perfekter wurde? Was wusste sie noch vom Leben? So sehr sie die Bewunderung genoss, so sehr war auch die Welt als Ganzes ihr abhandengekommen. Im selben Maß, wie sich ihre Aufmerksamkeit auf die Nerven, Gefäße, Anatomie der Hand reduzierte, verarmte ihr Leben zu Bruchstücken.
»Spielst du noch?«
Viktoria schreckte auf, hatte den Redefluss vor der Frage nicht mitbekommen: »Was meinst du?«
»Du hast doch Gitarre gespielt. Klassikunterricht, Guarecci und dann dein heimliches großes Vorbild: Django Reinhard! Mein Gott, was habe ich dich bewundert!«, Bibi spielte Luftgitarre und verzerrte ihr Gesicht. Ihre Tochter lachte, schaute aber jetzt auch interessiert zu Viktoria herüber, so, als ob sie sagen wollte, ›Hätte ich nicht gedacht …‹
»Das hatte ich glatt vergessen«, gestand Viktoria, erinnerte sich daran, dass ihre Gitarre noch zu Haus bei den Eltern auf dem Speicher lag. Völlig unerwartet stiegen ihr Tränen in die Augen. Sie wandte ihr Gesicht ab, wischte die ersten Tropfen verstohlen mit Zeigefinger und Handrücken aus den Augenwinkeln und von der Wange. Gegen das Versagen ihrer Stimme ankämpfend, sagte sie: »Das ist lange her. Dass du dich daran erinnerst.«
Bibi ging auf sie zu, fasste sie von hinten an ihre Schultern, so sanft, als fürchtete sie, ihre Freundin zu erschrecken. Dann schickte Bibi ihre Tochter aus dem Zimmer: »Lass uns mal allein«, legte in dem Moment des Schweigens ihren Kopf vorsichtig an Viktorias rechte Wange, ehe sie sagte: »Du hast dich unglücklich verliebt. Du bist nicht ohne Grund hier. Es geht dir schlecht, und ich texte dich zu!« Viktoria schniefte, jetzt flossen die Tränen in einem nicht aufzuhaltenden Strom. »Es ist schon gut.«
»Wie lange wirst du bleiben? Du bleibst doch. Lauf nicht weg, bekomme einen klaren Kopf.«
Für einen Moment stand Viktoria in Versuchung, ihrer Freundin alles zu erzählen. Doch dann entschied sie, ohne zu wissen warum, es bei Halbwahrheiten und Missverständnissen zu belassen.
»Klar doch! Wir sind keine Zwanzig mehr. Ich sage dir, wie das bei mir ist.« Bibi reckte ihren Busen nach vorn, schlug sich mit der Hand auf die Rundungen ihres Hinterns. »Entweder mache ich mir Sorgen oder etwas zu essen«, sie lachte herzlich. »Den Spruch habe ich vor kurzem in einem Roman von Ildikó von Kürthy gelesen – und gleich zu meinem Motto gemacht. Glaube mir, auch wenn das Ergebnis nicht immer auf den ersten Blick zu überzeugen scheint, der Appetit auf alles Ungesunde ist hier in Italien geradezu eine Religion. Wein, Likör, klebrige Kuchen, Eis, Pastasoßen, Tiramisu, Männer – Lebenselixiere. Meine Kurven sind ein Beleg für meine Lebenstüchtigkeit und meine kleinen und großen Siege über die Sorgen. Aber wenn ich dich so anschaue, Vic … Es wird höchste Zeit für ein drei Gänge Menü!«
– 8 –
Als Viktoria am nächsten Morgen pünktlich auf dem Weg zum Frühstücksraum das Foyer durchquerte, nahm sie Roberto lächelnd zur Seite und bedeutete ihr, dass draußen vor dem Hotel jemand auf sie wartete. Für einen Moment dachte sie an Bibi. Vielleicht hatte sie sich freigenommen. Doch draußen standen rauchend zwei ältere Herren, die ihre Gesichter gut gelaunt in die rötliche Morgensonne hielten. Viktoria erschrak ein wenig, denn ein Wiedersehen war in ihren Planungen nicht vorgesehen gewesen. Etwas hilflos schaute sie sich nach Roberto um, aber der lachte nur und machte Armbewegungen, als scheuche er Hühner aus dem Stall ins Freie. Viktoria stand noch immer in der Tür, als sich Gustavo und Giuseppe zu ihr umdrehten und wie aus einem Mund: »Buongiorno!« und »Bellissima!« riefen.
Bevor es noch richtig peinlich wurde, ging Viktoria raschen Schrittes auf die beiden zu. Sie zögerte noch bei dem Gedanken daran, wie eine ordentliche italienische Begrüßung ausfallen sollte, da nahmen sie beide bereits in den Arm und drückten ihr rechts und links Küsse auf die Wange. Küsse, die nach Rauch und Zuversicht schmeckten.
»Roberto hat uns schon verraten, dass du eine Langschläferin bist«, grinste Gustavo.
»Du hast etwa noch nicht gefrühstückt?«, spielte Giuseppe den Empörten. »Wie kann man nur seine Jugend so müßig verschwenden! Schlafen und dann noch allein!« Beide lachten erneut. »Wir hatten Lust, dich wiederzusehen. Geht es dir besser?«, Gustavos Interesse klang echt und berührte sie. Ein Ausflug in die Berge. Sie sprachen von einem Ausflug und frühstückten zu dritt im Hotel. Roberto hatte ihnen einen Tisch im hinteren Teil des Raumes zugewiesenen, obwohl Viktoria lieber am Fenster gesessen hätte. Dort sei es nicht so laut, die Gäste würden sich immer an den Fensterplätzen drängen. Viktoria dachte darüber nach, was er wohl damit meinte. Gustavo und Giuseppes Mitteilsamkeit kannte keine Auszeiten. Sie rissen Witze und unterhielten mit ihrer ausgelassenen Art zumindest den halben Saal. Meditative Stille war etwas anderes. Mit stiller Verzweiflung dachte Viktoria daran, dass sie in dem Alter ihrer Tischgenossen höchstwahrscheinlich ein sabbernder, hilfloser Pflegefall sein würde.
Roberto kam von der Rezeption herüber, trug Jeans und Sportfunktionskleidung, seine Schicht war offenbar beendet. Mit einem kurzen Blick bemerkte er Viktorias depressive Grundstimmung. Die Männer wechselten ein paar Worte auf Italienisch. Fast geläutert wandten sich ihr Gustavo und Giuseppe anschließend wieder zu und versprachen einen schönen Tag bei einem Ausflug ins Rosandratal. Viktoria trank ihren Cappuccino, biss in ihr Cornetto und löffelte ein Schälchen Obstsalat. Vorsichtig erkundigte sie sich nach Kletterfelsen und dachte an den jungen Deutschen vom Zug. »Klar doch! Der Karst hinter Triest ist das ideale Klettergebiet. Ein Traum, mit vielen wunderbaren Routen. Klettern Sie Dottoressa?«, Roberto begeisterte sich sofort.
»Nein, Gott bewahre! Das kann ich überhaupt nicht. Aber es interessiert mich«, antwortete Viktoria.
»Also, auf ins Rosandratal! Da gibt es sogar Kletterschulen und wunderschöne Aussichtspunkte«, entschied Gustavo.
Roberto holte sich einen Stuhl, einen Kaffee, setzte sich dazu und erkundigte sich nach ihrer Freundin, Sabine Grün. Er beobachtete Viktoria dabei, wie sie nachdenklich das angebissene Cornetto auf die Tasse legte, ein paar Krumen zusammenstrich und, als ob es für die Antwort Kraft bräuchte, kurz Luft holte: »Bibi hat eine Tochter, Kiara. Es scheint ihr gut zu gehen. Sie ist eine Frau, und ich hatte sie noch fast als Mädchen in Erinnerung. Sie ist mehr als eine halbe Italienerin geworden«, Viktoria lächelte, »aber ich bin sehr glücklich, sie wiedergesehen zu haben.«
»Sie wollen sich nicht mehr treffen?«, Roberto blickte besorgt.





























