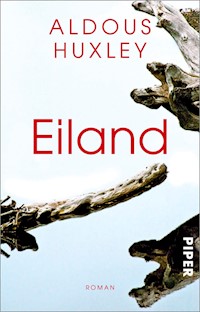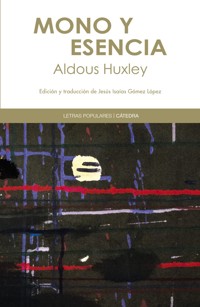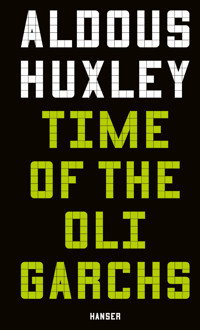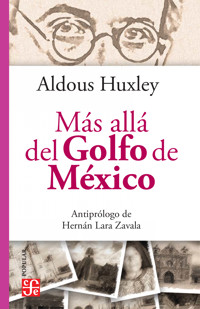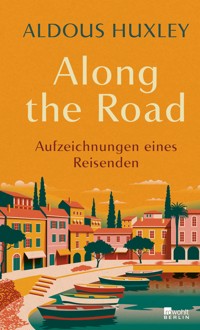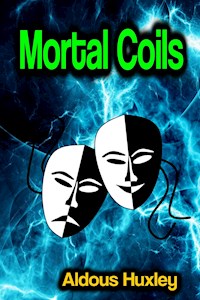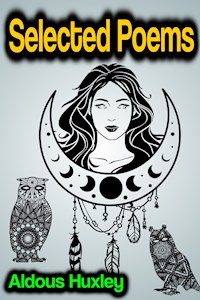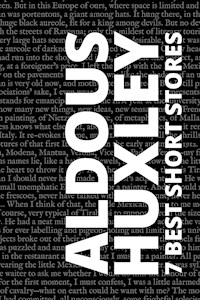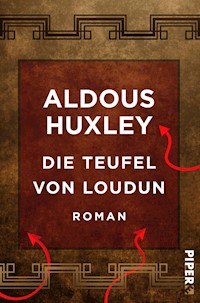
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine brillant erzählte Sittengeschichte des 17. Jahrhunderts von Aldous Huxley, dem Autor von »Schöne neue Welt«. 1634 wurde der gutaussehende und zügellose Priester Urbain Grandier verhört, gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Er wurde für schuldig befunden, mit dem Teufel im Bunde zu stehen, sowie ein ganzes Frauenkloster verführt und ins Unglück gestürzt zu haben. Huxley erzählt hier vom sensationellsten Fall von Massenbesessenheit und sexueller Hysteria im Mittelalter. Grandier selbst beteuerte stets seine Unschuld, aber noch vier Jahre nach seinem Tod wurden die Nonnen exorziert, um sie von ihren Dämonen zu befreien. »Die Phänomene von Loudun sowohl im Hinblick auf die Haßorgien und Schauprozesse unseres Jahrhunderts wie unter den Aspekten der tiefenpsychologischen Erkenntnis in ein theologisch wie philosophisch sine ira et studio entworfenes Bild der menschlichen Möglichkeiten einzuordnen, ist der im höchsten Grade produktive Sinn von Aldous Huxleys Studie.« (Christian E. Lewalter, DIE ZEIT)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Neuauflage einer früheren Ausgabe
Übersetzt aus dem Englischen von Herberth E. Herlitschka
ISBN 978-3-492-97657-2
© Piper Verlag GmbH, München 2017
© Mrs. Laura Huxley 1952
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Devils of Loudon«, Chatto & Windus, London 1952
© der deutschsprachigen Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 1955, 1992
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
ERSTES KAPITEL
Im Jahre 1605 unternahm Joseph Hall, der Satiriker und künftige anglikanische Bischof, seine erste Reise durch Flandern. »Wie viele Kirchen sahen wir an unserem Wege zerstört und nichts von ihnen übrig denn Trümmerhaufen, um dem Reisenden wie von Frömmigkeit so von Feindseligkeit zu künden. Oh, der jämmerlichen Fußspuren des Krieges! … Aber (und des verwunderte ich mich) Kirchen stürzen ein, und Jesuitenschulen erheben sich überall. Es gibt keine Stadt, in welcher diese nicht schon aufragen oder gebaut werden. Woher kommt das? Daher, dass Frömmigkeit nicht so notwendig ist wie Politik? Diese Männer fahren (wie wir vom Fuchs sagen) am besten, wann sie am meisten gehetzt werden. Niemand wird so sehr von den Seinen angefeindet; niemand so sehr von allen gehasst; niemand so sehr von den Unseren bekämpft; und dennoch gedeiht dieses Unkraut.«
Es gedieh aus einem sehr einfachen und ausreichenden Grund: Die Öffentlichkeit brauchte es. Die Jesuiten selbst zogen die »Politik«, wie Hall und seine ganze Generation sehr wohl wussten, an erster Stelle in Erwägung. Diese Kollegien waren zu dem Zweck ins Leben gerufen worden, die Römische Kirche gegen ihre Feinde zu stärken, gegen die »Libertiner« und die Protestanten. Die frommen Väter hofften, durch ihren Unterricht eine Klasse gebildeter Laien heranzuziehen, welche restlos den Interessen der Kirche ergeben wäre. Mit den Worten eines Cerutti[1] – Worten, die den entrüsteten Michelet fast außer sich brachten –: »wie wir die Glieder eines Neugeborenen in der Wiege mit Binden umwickeln, um ihnen eine richtige Proportion zu geben, so ist es notwendig, seinen Willen von frühester Jugend an in Bande zu legen, damit er sich durchs ganze Leben eine glückliche und bekömmliche Geschmeidigkeit bewahre.« Der Geist der Herrschsucht war willig genug, aber das Fleisch der propagandistischen Methode war schwach. Obwohl ihr Wille in Bande gelegt worden war, verließen einige der besten Jesuitenzöglinge die Schule, um Freidenker zu werden oder, wie Jean Labadie, sogar Protestanten. Was die »Politik« betraf, so war das System niemals so wirksam, wie seine Schöpfer gehofft hatten. Die Öffentlichkeit aber interessierte sich nicht für diese Politik; die Öffentlichkeit interessierte sich für gute Schulen, wo die Knaben alles lernen könnten, was ein Herr von Stand wissen sollte. Die Jesuiten befriedigten die Nachfrage besser als die meisten anderen Bildungslieferanten. »Was gewahrte ich während der sieben Jahre, die ich unter dem Dach der Jesuiten verbrachte? Ein Leben der Mäßigung, des Fleißes und der Ordnung. Sie widmeten jede Stunde des Tages unserer Erziehung oder der strengen Erfüllung ihrer Gelübde. Zum Beweis dessen berufe ich mich auf das Zeugnis der Tausenden, die gleich mir von ihnen erzogen wurden.« So schrieb Voltaire. Seine Worte bezeugen die Vortrefflichkeit der jesuitischen Lehrmethoden. Zugleich aber und mit noch mehr Nachdruck bezeugt seine ganze Laufbahn den Misserfolg dieser »Politik«, der die Lehrmethoden dienen sollten.
Als Voltaire zur Schule ging, waren die Jesuitenkollegien wohlvertraute Wahrzeichen auf dem Gebiet der Erziehung. Ein Jahrhundert zuvor hatten ihre Vorzüge geradezu etwas Revolutionäres. In einem Zeitalter, in welchem die Pädagogen sich nur im Handhaben der Rute als Fachmänner erwiesen, waren die Disziplinarmethoden der Jesuiten verhältnismäßig human und ihre Professoren sorgfältig gewählt und systematisch ausgebildet. Sie lehrten ein besonders elegantes Latein und das Allerneueste auf den Gebieten der Mathematik und Optik und Geografie, zusammen mit »Dramatik« (ihre Theateraufführungen waren berühmt), guten Manieren, Achtung vor der Kirche und (zumindest in Frankreich und nach der Bekehrung Heinrichs IV.) Gehorsam gegenüber der königlichen Autorität des weltlichen Herrschers. Aus allen diesen Gründen empfahlen sich die Jesuitenkollegien jedem Mitglied einer typischen Familie der Oberklasse – der zärtlichen Mutter, welche den Gedanken, dass ihr Liebling die Martern einer altmodischen Erziehung durchmachen solle, nicht ertragen konnte; dem gelehrten geistlichen Onkel, welchem an gesunder Doktrin und einem ciceronianischen Stil lag; und schließlich dem Vater, welcher als patriotischer Beamter monarchischen Prinzipien huldigte und als umsichtiger Bürger darauf zählte, dass der Hintertreppeneinfluss der Gesellschaft Jesu ihrem Zögling zu einem Posten, zu einem Platz am Hof, zu einer kirchlichen Sinekure verhelfen werde. Da haben wir zum Beispiel ein Ehepaar von sehr solidem Wohlstand – Monsieur Corneille aus Rouen, Avocat du Roy à la Table de Marbre du Palais, und seine Frau, Marthe Le Pesant. Ihr Sohn, Pierre, ist ein so vielversprechender Junge, dass sie sich entschließen, ihn zu den Jesuiten zu senden. Da haben wir ferner Monsieur Joachim Descartes, Rat beim »Parlement« von Rennes. Im Jahre 1604 bringt er seinen Jüngsten – einen aufgeweckten kleinen Kerl von acht Jahren namens René – in das vor Kurzem gegründete und mit einer königlichen Dotation versehene Jesuitenkollegium von La Flèche. Und da haben wir auch, um ungefähr die gleiche Zeit, den gelehrten Kapitular Grandier in Saintes. Er hat einen Neffen, Sohn eines anderen, nicht ganz so reichen und vornehmen Juristen wie Monsieur Descartes oder Monsieur Corneille, aber immerhin hochangesehen. Der Junge, mit Namen Urbain, ist jetzt vierzehn Jahre alt und wunderbar gescheit. Er verdient es, die bestmögliche Bildung zu erhalten, und in der Umgebung von Saintes ist die beste Bildung im Jesuitenkollegium von Bordeaux zu haben.
Diese berühmte Stätte der Gelehrsamkeit umfasste eine höhere Schule für Knaben, ein Kollegium der freien Künste, ein Seminar und eine Schule für fortgeschrittene Studien graduierter und bereits ordinierter Theologen. Hier verbrachte der bereits als Kind brillante Urbain Grandier mehr als zehn Jahre, erst als Schuljunge, später als Student der Theologie und, nach seiner Ordination im Jahre 1615, als Jesuitennovize. Er beabsichtigte nicht etwa, in die Gesellschaft Jesu einzutreten, denn er fühlte keine Berufung, sich einer so strengen Disziplin zu unterwerfen. Nein, er wollte nicht in einem religiösen Orden, sondern als Weltpriester Karriere machen. In diesem Beruf konnte ein Mann mit den angeborenen Fähigkeiten Urbains, begünstigt und beschützt von der mächtigsten Organisation innerhalb der Kirche, hoffen, es weit zu bringen. Da mochte sich eine Kaplanstelle bei einem Herrn vom hohen Adel finden, der Posten des Hauslehrers eines künftigen Marschalls von Frankreich oder knospenden Kardinals. Da mochten ihm Einladungen winken, seine bemerkenswerte Beredsamkeit vor Bischöfen, vor Prinzessinnen von Geblüt, ja sogar vor der Königin selbst zu entfalten. Da mochten ihm diplomatische Missionen blühen, Berufungen auf hohe Verwaltungsposten, einträgliche Sinekuren, saftige Pfründenhäufungen. Da wäre es – wenngleich in Anbetracht dessen, dass er nicht von adeliger Geburt war, zwar nicht sehr wahrscheinlich – immerhin denkbar, dass ein fürstliches Bistum auf ihn wartete, um seinen Lebensabend zu vergolden und zu verklären.
Am Beginn seiner Laufbahn schienen die Umstände die kühnsten dieser Erwartungen zu rechtfertigen. Denn mit siebenundzwanzig, nach zwei Jahren höherer Theologie und Philosophie, erhielt der junge Pater Grandier seine Belohnung für so viele lange Semester des Fleißes und guten Betragens. Von der Gesellschaft Jesu, welche sie zu vergeben hatte, wurde ihm die ansehnliche Pfründe von Saint-Pierre-du-Marché zu Loudun verliehen. Gleichzeitig und dank denselben Gönnern wurde er zu einem Kanonikus der Kollegiatkirche von Sainte-Croix gemacht. Sein Fuß war auf der Leiter; er brauchte nur noch zu steigen.
Loudun enthüllte sich, sobald der neue Pfarrer langsam seinem Bestimmungsort näher geritten kam, als eine kleine Stadt auf einem Hügel, von zwei schlanken Türmen überragt – dem Spitzturm von Sankt Peter am Markt und dem mittelalterlichen Bergfried des großen festen Schlosses. Als ein Symbol, als eine soziologische Hieroglyphe, war die Silhouette Louduns einigermaßen veraltet. Jener Spitzturm warf zwar noch immer seinen gotischen Schatten über die Stadt; aber ein gut Teil der Einwohner waren Hugenotten, welche die Kirche, zu der er gehörte, verabscheuten. Und der gewaltige Bergfried, einst von den Grafen von Poitiers gebaut, war noch immer eine Feste von beträchtlicher Stärke; aber bald würde Richelieu an die Macht kommen, und die Tage örtlicher Selbstverwaltung und provinzieller Festungen waren gezählt. Ahnungslos ritt der Pfarrer in den letzten Akt eines Konfessionskrieges hinein, in das Vorspiel zu einer nationalen Revolution.
Vor dem Stadttor hingen ein paar verwesende Leichen von den städtischen Galgen. Innerhalb der Mauern fanden sich die gewohnten schmutzigen Gassen, die übliche Skala der Gerüche von Holzrauch bis zu Fäkalien, von Gänsen bis zu Weihrauch, von backendem Brot bis zu Pferdemist, Schweinen und ungewaschener Menschheit.
Bauern und Handwerker, Wandergesellen und Dienstboten – die Armen waren eine belanglose und anonyme Mehrheit der vierzehntausend Einwohner. Ein Stückchen über ihnen drängten sich die Ladenbesitzer, die Handwerksmeister, die kleinen Beamten prekär auf der untersten Stufe bürgerlicher Achtbarkeit zusammen. Und noch höher oben – völlig von den unter ihnen Stehenden abhängig, aber im Genuss unangezweifelter Vorrechte und jene nach göttlichem Ratschluss beherrschend – fanden sich die reichen Kaufleute, die Männer der freien Berufe und die Personen von Stand in ihrer hierarchischen Ordnung: der Kleinadel und die größeren Landbesitzer, die Feudalmagnaten und die vornehmen Prälaten. Hier und da waren ein paar kleine Oasen von Kultur und uneigennütziger Intelligenz zu entdecken. Außerhalb dieser Oasen war die geistige Atmosphäre erstickend provinzlerisch. Unter den Reichen war die Beschäftigung mit Geld und Besitz, mit Rechten und Vorrechten eine Leidenschaft und chronische Sucht. Für die zwei- oder höchstens dreitausend, die sich Prozesse leisten konnten oder eine Rechtsberatung brauchten, gab es in Loudun nicht weniger als zwanzig Advokaten, achtzehn Sachwalter, achtzehn Gerichtsvollzieher und acht Notare.
Was an Zeit und Tatkraft bei dieser vorwiegenden Beschäftigung mit Besitztümern übrig blieb, wurde dem trauten, unwichtigen Einerlei, den immer wiederkehrenden Freuden und Leiden des Familienlebens gewidmet; dem Klatsch mit den Nachbarn; den Formalitäten der Religion und, da Loudun eine in sich gespaltene Stadt war, dem unerschöpflichen Gezänk theologischen Meinungsstreits. Von dem Vorhandensein irgendeiner echt spiritualen Religiosität ist in Loudun während der Amtstätigkeit unseres Pfarrers nichts nachzuweisen. Weitverbreitete Befassung mit dem geistlichen Leben entsteht nur in der Umgebung außergewöhnlicher Menschen, welche durch unmittelbare Erfahrung wissen, dass Gott Geist ist und im Geiste verehrt werden muss. Nebst einem ausreichenden Vorrat von Schurken besaß Loudun sein Teil Aufrechter und Wohlmeinender, Gottesfürchtiger und sogar Frommer. Aber es besaß keine Heiligen, keinen Mann, keine Frau, deren bloße Anwesenheit der sich selbst Kraft verleihende Beweis einer tieferen Einsicht in die ewige Wirklichkeit eines engeren Einklangs mit dem göttlichen Grund alles Seins ist. Erst sechzig Jahre später erschien ein solcher Mensch innerhalb der Stadtmauern. Als nach den herzzerreißendsten körperlichen und seelischen Erlebnissen Louise de Tronchay endlich ihr Wirken im Hospital von Loudun begann, wurde sie sogleich der Mittelpunkt eines inbrünstigen und eifrigen geistlichen Lebens. Leute jedes Alters und jeder Klasse drängten sich herbei, um sie über Gott zu befragen, ihren Rat, ihren Beistand zu erbitten. »Man liebt uns hier zu sehr«, schrieb Louise ihrem alten Beichtvater nach Paris. »Ich fühle mich ganz beschämt dadurch; wenn ich von Gott spreche, sind die Leute so gerührt, dass sie zu weinen beginnen. Ich scheue mich, zu der guten Meinung, die sie von mir haben, noch beizutragen.« Sie hätte am liebsten die Flucht ergriffen und sich versteckt; aber sie war die Gefangene der Ergebung einer ganzen Stadt. Wenn sie betete, wurden oft die Kranken geheilt. Zu ihrer Beschämung und Zerknirschung wurde die Ursache dieser Genesungen ihr zugeschrieben. »Wenn ich je ein Wunder getan hätte«, so schrieb sie, »hielte ich mich für verdammt.« Nach ein paar Jahren wurde ihr von ihren Oberen befohlen, Loudun zu verlassen. Für die Menschen dort war nun kein lebendiges Fenster mehr vorhanden, durch welches das Licht scheinen konnte. Nach einer kleinen Weile kühlte sich die Inbrunst ab; das Interesse für das Leben im Geiste erlosch. Loudun kehrte zu seinem normalen Zustand zurück – dem Zustand, in dem es sich befunden hatte, als, zwei Generationen früher, Urbain Grandier durch das Stadttor geritten kam.
Von Anfang an war die Meinung der Öffentlichkeit hinsichtlich des neuen Pfarrers scharf geteilt. Von dem frömmeren Geschlecht waren die meisten für ihn eingenommen. Der verstorbene Curé war ein tatteriger Niemand gewesen. Sein Nachfolger war ein Mann in voller Jugendkraft, hochgewachsen, athletisch gebaut, mit einem Aussehen von ernster Autorität, ja, sogar (nach der Aussage eines seiner Zeitgenossen) von Majestät. Er hatte große dunkle Augen und unter seiner Biretta eine Fülle krauser schwarzer Haare. Seine Stirn war hoch, seine Nase kühn geschwungen, seine Lippen waren rot, voll und beweglich. Ein elegantes Van-Dyck-Bärtchen zierte sein Kinn, und auf der Oberlippe trug er einen schmalen Schnurrbart, beflissen so gezwirbelt und pomadisiert, dass die einwärts gebogenen Enden zu beiden Seiten der Nase einander gegenüberstanden wie ein Paar koketter Fragezeichen. Nachfaustische Augen gemahnt sein Porträt an einen fleischigeren, nicht unliebenswürdigen und nur ein klein wenig unintelligenteren Mephistopheles im Maskenkostüm eines Pfarrers.
Zu dieser verführerischen Erscheinung kamen bei Grandier die gesellschaftlichen Vorzüge guter Manieren und lebhafter Konversation hinzu. Er konnte auch mit ungezwungener Anmut ein Kompliment drechseln, und der Blick, mit dem er seine Worte begleitete, war, wenn die Dame nur einigermaßen präsentabel aussah, schmeichelhafter denn die Worte selbst. Der neue Pfarrer, das war nur zu offenkundig, nahm ein mehr als seelsorgerisches Interesse an seinen weiblichen Pfarrkindern.
Grandier lebte in der grauen Morgendämmerung dessen, was man die Ära der Respektabilität nennen könnte. Während des Mittelalters und des frühen Teils der Neuzeit war die Kluft zwischen der offiziellen katholischen Theorie und der tatsächlichen Praxis der einzelnen Kleriker ungeheuer, unüberbrückt und anscheinend unüberbrückbar gewesen. Es ist schwer, irgendeinen Schriftsteller des Mittelalters oder der Renaissance zu finden, welcher es nicht für ausgemacht hält, dass vom höchsten Prälaten bis zum niedersten Klosterbruder die Mehrheit der Geistlichen durch und durch verderbt ist. Kirchliche Korruption zeugte die Reformation, und die Reformation hinwieder brachte die Gegenreformation hervor. Nach dem Konzil von Trient wurden skandalöse Päpste immer seltener, bis endlich, um die Mitte des 17. Jahrhunderts, dieser Schlag völlig ausstarb. Und sogar einige der Bischöfe, deren einzige Qualifikation für eine Rangerhöhung darin bestand, dass sie jüngere Söhne hoher Adeliger waren, machten nun eine gewisse Anstrengung, sich zu benehmen. Unter dem niederen Klerus wurde Missbräuchen nun von oben her durch eine wachsamere und wirksamere kirchliche Verwaltung und von innen her durch den von solchen Organisationen wie der Gesellschaft Jesu und der Kongregation des Oratoriums ausstrahlenden Eifer Einhalt getan. In Frankreich, wo die Monarchie aus der Kirche ein Werkzeug zur Vergrößerung der Zentralgewalt auf Kosten der Protestanten, des Hochadels und der Traditionen provinzieller Autonomie machte, war die Sittlichkeit der Geistlichen Gegenstand der königlichen Aufmerksamkeit. Die Massen wollen eine Kirche nicht achten, deren Diener sich skandalöser Lebensführung schuldig machen. In einem Land aber, wo nicht nur gilt, l'Etat, sondern auch, l'Eglise, c'est moi, ist Missachtung der Kirche Missachtung des Königs. »Ich erinnere mich«, schreibt Bayle in einer der endlosen Fußnoten zu seinem großen Dictionnaire, »ich erinnere mich, dass ich eines Tages einen Herrn von Stand, der mir von unzähligen Verfehlungen des venezianischen Klerus erzählte, fragte, wie es komme, dass der Senat solche Dinge dulde, die der Ehre von Religion und Staat so abträglich seien. Er antwortete, das öffentliche Wohl verpflichte den Souverän, nachsichtig zu sein; und um das Rätsel zu erklären, fügte er hinzu, dem Senat sei es sehr recht, dass das Volk die äußerste Verachtung für Priester und Mönche hege, da sie aus ebendiesem Grund weniger fähig seien, einen Aufstand hervorzurufen. Einer der Gründe, sagte er, dass die Jesuiten dort dem Dogen unangenehm sind, sei der, dass sie das Dekorum ihres Standes wahren und so, da sie vom niederen Volk mehr geachtet werden, fähiger seien, eine Erhebung anzuzetteln.« In Frankreich war während des ganzen 17. Jahrhunderts die staatliche Politik gegenüber Verfehlungen Geistlicher das genaue Gegenteil derjenigen, die vom Senat Venedigs befolgt wurde. Dieser sah es, weil er sich vor kirchlichen Machtübergriffen fürchtete, gern, wenn seine Geistlichen sich wie Schweine aufführten, und konnte die achtbaren Jesuiten nicht leiden. Politisch machtvoll und stark gallikanisch, hatte hingegen die französische Monarchie keinen Grund, den Papst zu fürchten, und fand die Kirche als ein Regierungswerkzeug sehr nützlich. Aus diesem Grund begünstigte sie die Jesuiten und verpönte priesterliche Unkeuschheit oder zumindest die Außerachtlassung von Diskretion dabei.[1]
Der neue Pfarrer hatte seine Laufbahn zu einer Zeit begonnen, in welcher Skandale der Geistlichkeit, wenngleich sie noch häufig vorkamen, den vorgesetzten Behörden in zunehmendem Maß unliebsam wurden.
Grandiers jüngerer Zeitgenosse Jean-Jacques Bouchard hat uns in seinem autobiografischen Bericht von einer im 17. Jahrhundert verlebten Knabenzeit ein so klinisch-objektives Dokument hinterlassen, ein so völlig von allen Ausdrücken des Bedauerns, von jeder Art moralischen Urteils freies, dass Gelehrte des 19. Jahrhunderts es nur als Privatdruck und mit emphatischen Bemerkungen über die unaussprechliche Verderbtheit des Verfassers veröffentlichen konnten. Für eine mit Havelock Ellis und Krafft-Ebing, mit Hirschfeld und Kinsey aufgezogene Generation hat Bouchards Buch nichts Empörendes. Aber wenn es auch nicht mehr schockiert, muss es einen doch noch verblüffen, denn wie erstaunlich ist es, einen Untertan Ludwigs XIII. zu finden, welcher über die weniger achtbaren Formen des Geschlechtsverkehrs in dem flachen, sachlichen Stil einer heutigen Studentin schreibt, wenn sie den Fragebogen eines Anthropologen beantwortet, oder in dem eines Psychiaters, wenn er die Anamnese eines Falls vermerkt! Descartes war um zehn Jahre älter als Bouchard; aber lange bevor der Philosoph begann, diese zuckenden Automaten zu vivisezieren, denen die Ungebildeten die Namen Hund und Katze beilegten, hatte Bouchard schon eine Reihe psychochemisch-physiologischer Experimente an der jungen Kammerzofe seiner Mutter vorgenommen. Sie war, als er zum erstenmal auf sie aufmerksam wurde, fromm und fast aggressiv tugendhaft. Mit der Geduld und dem Scharfsinn eines Pawlow rekonditionierte Bouchard dieses Produkt eines blinden Kirchenglaubens, so dass das Mädchen zuletzt eine Anhängerin der Naturphilosophie wurde und sich ebenso bereit zeigte, beobachtet und als Versuchsobjekt benutzt zu werden, wie, auf eigene Rechnung Forschungen anzustellen. Auf dem Tischchen neben Jean-Jacques' Bett waren ein halbes Dutzend Folianten der Anatomie und Medizin aufgestapelt. Zwischen zwei Stelldichein oder sogar zwischen zwei experimentellen Liebkosungen öffnete dieser seltsame Vorläufer von Ploss und Bartels sein Exemplar von De Generatione, seinen Fernelius oder seinen Ferandus und schlug die betreffenden Kapitel, Unterabschnitte und Absätze nach. Aber im Unterschied zu seinen Zeitgenossen ließ er nichts auf bloße Autorität hin gelten. Lemnius und Rodericus a Castro mochten über die seltsamen und beunruhigenden Eigenschaften des Menstruationsbluts schreiben, was sie wollten. Jean-Jacques war entschlossen, sich selber davon zu überzeugen, ob es wirklich alles das tat, was ihm nachgesagt wurde. Sekundiert von der nun willigen Kammerzofe, machte er eine Reihe von Versuchen, nur um zu entdecken, dass seit undenklichen Zeiten die Ärzte, die Philosophen und die Theologen unter ihren Baretten und Birettas Unsinn geredet hatten. Menstruationsblut machte kein Gras welken, trübte keinen Spiegel, brachte die Rebenknospen nicht zum Verdorren, löste keinen Asphalt auf und erzeugte keine unentfernbaren Rostflecke auf einer Messerklinge. Die biologische Wissenschaft verlor einen ihrer meistversprechenden Forscher, als Bouchard, um seine Mitarbeiterin und zugleich corpus vile nicht heiraten zu müssen, überstürzt Paris verließ und sein Glück am päpstlichen Hof suchte. Alles, was er wollte, war ja nur ein Bistum in partibus oder notfalls sogar in der Bretagne – irgendeine kleine, unansehnliche Pfründe von jährlich sechs- oder siebentausend Livres; weiter nichts. (Sechstausendfünfhundert Livres waren das Einkommen, das wohlüberlegte Anlage seines väterlichen Erbteils Descartes abwarf. Es war nicht fürstlich; aber zumindest erlaubte es einem Philosophen, wie ein Herr von Stand zu leben.) Der arme Bouchard erhielt nie eine Pfründe. Seinen Zeitgenossen nur als der lächerliche Autor einer Panglossia oder Sammlung von Versen in sechsundvierzig Sprachen einschließlich des Koptischen, Peruanischen und Japanischen bekannt, starb er, bevor er vierzig wurde.
Louduns neuer Pfarrer war zu normal und besaß einen zu herzhaften geschlechtlichen Appetit, als dass ihm der Gedanke gekommen wäre, sein Bett in ein Laboratorium zu verwandeln. Aber gleich Bouchard war Grandier der Sproß einer achtbaren bürgerlichen Familie; gleich Bouchard war er in einem geistlichen Internat erzogen worden; gleich Bouchard war er gescheit, gelehrt und ein begeisterter Humanist; und gleich Bouchard hoffte er, in der Kirche eine brillante Karriere zu machen. In sozialer und kultureller, wenn nicht in temperamentlicher Beziehung hatten die beiden Männer viel gemein. Daher lässt sich, was Bouchard über seine Kindheit, seine Schulzeit und seine Ferienfreuden im Elternhaus zu sagen hat, als mittelbar beweiskräftig hinsichtlich Grandiers betrachten. Die von den Confessions enthüllte Welt ist der uns von modernen Sexualwissenschaftlern enthüllten sehr ähnlich – aber, wenn möglich, noch ein wenig ähnlicher. Wir sehen das kleine Kroppzeug sich im geschlechtlichen Spiel vergnügen – ungehindert und häufig; denn die Erwachsenen scheinen sich äußerst wenig in seine Betätigungen eingemischt zu haben. In der Schule, unter der Leitung der frommen Patres, gibt es keine anstrengenden sportlichen Spiele, und die überschüssige Energie der Knaben kann in nichts anderem als unaufhörlichem Masturbieren und, an halbfreien Tagen, homosexueller Betätigung Auslass finden. Erbauliche Ermahnungen und Kanzelberedsamkeit, Beichten und Andachtsübungen wirken wenig einschränkend. Bouchard verzeichnet, dass er an den vier großen Festen der Kirche sich bis zu acht oder zehn Tagen hintereinander von seinen gewohnten sexuellen Praktiken zurückhielt. Aber so sehr er es auch versucht haben mag, es gelang ihm nie, diese Zwischenzeiten von Keuschheit bis zu vollen zwei Wochen auszudehnen, quoy que la dévotion le gourmandast assez – trotz der Tatsache, dass er durch Devotion nicht wenig zurückgehalten und getadelt wurde. Unter jeder gegebenen Serie von Umständen entspricht unser tatsächliches Verhalten der Diagonalen eines Kräfteparallelogramms, dessen Basis von Begierde oder Interesse und dessen Höhe von unseren ethischen oder religiösen Idealen gebildet wird. Bei Bouchard und, wie wir annehmen dürfen, bei den anderen Knaben, die er als seine Amüsierpartner nennt, war die devotionale Höhe so gering, dass der Winkel zwischen der langen Basis und der Diagonalen offenkundigen Verhaltens nur sehr wenige Grade betrug.
Wenn er über die Ferien daheim war, wiesen seine Eltern ihm eine Schlafstätte in ein und demselben Zimmer mit einem halbwüchsigen Stubenmädchen an. Diese junge Person war ganz Tugend, solange sie wach war, konnte aber, das war klar, nicht verantwortlich sein für das, was geschah, während sie schlief. Und gemäß ihrem Privatsystem von Kasuistik machte es keinen Unterschied, ob sie wirklich schlief oder bloß so tat. Später, als Jean-Jacques' Schulzeiten vorbei waren, gab es dann eine kleine Bauerndirne, welche die Kühe im Obstgarten hütete. Für einen halben Sou war sie bereit, jede Gunst zu gewähren, die ihr junger Herr fordern mochte. Eine andere Zofe jedoch, welche den Dienst verlassen hatte, weil Bouchards Halbbruder, der Prior von Cassan, sie zu verführen versucht hatte, trat jetzt wieder in den Dienst der Familie und wurde bald Jean-Jacques' Versuchskaninchen und Mitarbeiterin bei den sexuellen Experimenten, die im zweiten Teil seiner Confessions beschrieben werden.
Die Kluft, welche Bouchard vom Erben des französischen Throns trennte, war breit und tief, und doch ist die sittliche Luft, in der der künftige Ludwig XIII. erzogen wurde, in vieler Hinsicht derjenigen ähnlich, die sein tieferstehender Zeitgenosse atmete. In dem Journal des Dr. Jean Héroard, Leibarzt des kleinen Prinzen, besitzen wir einen langen und ins Einzelne gehenden Bericht über eine Kindheit des 17. Jahrhunderts. Gewiss, der Dauphin war ein sehr außergewöhnliches Kind – seit mehr als achtzig Jahren der erste Sohn eines Königs von Frankreich. Aber gerade die Kostbarkeit dieses einzigarten Kindes gibt gewissen, für uns ganz außerordentlichen Zügen seiner Erziehung ein noch schärferes Relief. Wenn dergleichen gut genug war für ein Kind, für welches der Definition nach nichts gut genug war, was war dann, so mögen wir uns wohl fragen, gut genug für gewöhnliche Kinder? Zunächst einmal wurde der Dauphin zusammen mit einer ganzen Schar der illegitimen Kinder aufgezogen, welche sein Vater von drei oder vier verschiedenen Müttern hatte. Einige dieser Geschwister zur linken Hand waren älter als er, einige jünger. Mit drei Jahren – und vielleicht noch früher – wusste er sehr genau, was Bastarde waren und auf welche Weise sie erzeugt wurden. Die Sprache, in der diese Aufklärungen erteilt wurden, war so ausnahmslos unflätig, dass der Kleine davon oft angewidert war. »Fi donc«, sagte er dann von seiner Gouvernante, Mme de Montglat, »wie abscheulich sie ist!«
Heinrich IV. hatte eine große Vorliebe für zotige Lieder, und seine Höflinge und Diener kannten deren eine große Zahl, die sie immerfort sangen, während sie im Palast ihren Pflichten nachgingen. Und wenn die dem Prinzen zugeteilten diesen Unflat nicht laut werden ließen, so scherzten sie, männliche wie weibliche, mit dem Kleinen gern obszön über die Bastarde seines Vaters und – denn er war bereits so gut wie verlobt – über seine eigene Zukünftige, die Infantin Anna von Österreich. Überdies vollzog sich die Sexualerziehung des Dauphins nicht nur in Worten. Nachts wurde der kleine Knabe oft von seinen Kammerfrauen in ihre Betten genommen – Betten, welche sie (ohne Nachthemden zu tragen) mit anderen Frauenspersonen oder mit ihren Ehemännern teilten. Es ist anzunehmen, dass der Kleine, als er vier oder fünf Jahre alt war, alle »Tatsachen des Lebens« kannte, und nicht nur vom Hörensagen, sondern von Augenschein. Das ist umso wahrscheinlicher, als ein Palast des 17. Jahrhunderts ein Ungestörtsein unmöglich machte. Die Architekten hatten noch nicht den Korridor erfunden. Um von einem Teil des Gebäudes in einen anderen zu gelangen, durchschritt man einfach eine Flucht von Gemächern anderer Leute, in welchen buchstäblich alles Mögliche vorgehen konnte. Und dann gab es auch das, was Etikette genannt wurde. In dieser Hinsicht weniger vom Glück begünstigt als Niedrigergestellte, war es einer Person von königlichem Geblüt nie erlaubt, allein zu sein. Wenn man blaues Blut hatte, wurde man in einem Gewühl von Menschen geboren, man starb in einem Gewühl von Menschen, ja man erleichterte sich in Anwesenheit einer Menschenmenge, und bei gewissen Gelegenheiten musste man sogar in ihrer Anwesenheit der Liebe pflegen. Und die einen umgebende Architektur war so beschaffen, dass man den Anblick, wie andere geboren wurden, starben, der Natur freien Lauf ließen und das Liebesspiel trieben, kaum vermeiden konnte. Im späteren Leben entfaltete Ludwig XIII. eine unverkennbare Abneigung gegen Frauen, eine entschiedene, wenngleich wahrscheinlich platonische Neigung zu Männern und einen ausgesprochenen Widerwillen gegen alle Arten körperlicher Missbildung und Krankheit. Das Benehmen der Mme de Montglat und der anderen Damen am Hof mag leicht der Grund des ersten und auch, durch eine natürliche Reaktion, des zweiten dieser Züge gewesen sein. Und was den dritten betrifft – wer weiß, in welche abstoßenden Ausschweifungen der Kleine in den allzu öffentlichen Schlafkammern von Saint-Germain-en-Laye hineingestolpert sein mag?
Dies also war die Welt, in der der neue Pfarrer erzogen worden war – eine Welt, in welcher die herkömmlichen geschlechtlichen Tabus sehr leicht auf den Schultern der unwissenden und mit Armut geschlagenen Mehrheit und nicht allzu schwer auf denen der über ihr stehenden Minderheit lagen; eine Welt, in welcher Herzoginnen spassten wie Julias Amme und das Gespräch großer Damen ein hässlicheres und stumpfsinnigeres Echo der Frau aus Bath[2] war; wo ein Mann von Vermögen und guter gesellschaftlicher Stellung (wenn er nicht allzu heikel in Bezug auf Schmutz und Läuse war) sein Gelüst fast ad libitum befriedigen konnte; und wo sogar unter den Kultivierten und Besonnenen die Lehren der Religion in einem zumeist eher pickwickischen Sinn[3] aufgefasst wurden, so dass die Kluft zwischen Theorie und offenkundigem Benehmen, wenn auch ein wenig schmäler als in den mittelalterlichen Zeiten des Glaubens, noch immer reichlich breit war. Als Kind dieser Welt betrat Urbain Grandier seine Pfarre mit der unverhohlenen Absicht, sich das Beste aus beiden Welten zu nehmen, aus dieser und auch aus jener anderen, dem himmlischen Universum jenseits des verabscheuten Abgrunds. Ronsard war sein Lieblingsdichter. Und Ronsard hatte gewisse Strophen geschrieben, welche restlos die Anschauungen des jungen Pfarrers ausdrückten.
Quand au temple nous serons,
Agenouillés nous ferons
Les dévots selon la guise
De ceux qui, pour louer Dieu,
Humbles, se courbent au lieu
Le plus secret de l'église.
Mais quand au lit nous serons,
Entrelacés nous ferons
Les lascifs selon les guises
Des amants qui librement
Pratiquent folâtrement
Dans les draps cent mignardises.[2]
Es war eine Beschreibung des »wohlgerundeten Lebens«, und ein wohlgerundetes, das war das Leben, das dieser gesunde, junge Humanist zu führen entschlossen war. Aber vom Leben eines Priesters wird nicht vorausgesetzt, dass es wohlgerundet sei. Es wird vorausgesetzt, dass es einspitzig sei – ein Kompass, nicht eine Wetterfahne. Und um sein Leben so zu gestalten und einstrebig zu halten, übernimmt der Priester gewisse Pflichten, legt er gewisse Gelübde ab. In Grandiers Fall war die Übernahme der Pflichten und die Ablegung der Gelübde mit einem geistigen Vorbehalt erfolgt, welchen er in einem etwa zehn Jahre nach seiner Ankunft in Loudun – aber nur für ein einziges Augenpaar – geschriebenen kleinen Traktat vom Zölibat der Geistlichkeit veröffentlichen sollte.
Gegen das Zölibat führt Grandier zwei Hauptgründe an. Der erste lässt sich im folgenden Schluss zusammenfassen. »Ein Versprechen, das Unmögliche zu vollbringen, ist nicht bindend. Für einen jungen Menschen männlichen Geschlechts ist Enthaltsamkeit unmöglich, und daher ist kein Gelübde, das eine solche Enthaltsamkeit bedingt, bindend.« Und wenn dies nicht genügte, so gab es ein zweites Argument, welches sich auf die allgemein anerkannte Maxime gründete, dass wir durch uns abgepreßte Versprechungen nicht gebunden sind. »Der Priester nimmt das Zölibat nicht um des Zölibats willen auf sich, sondern einzig und allein, damit er in den Klerus aufgenommen werde.« Sein Gelübde »entspringt nicht seinem Willen, sondern wird ihm von der Kirche auferlegt, die ihn zwingt, nolens volens auf diese harte Bindung einzugehen, ohne die er den Priesterberuf nicht ausüben darf.« Das Ergebnis all dessen war, dass Grandier sich völlig frei fühlte, letztlich zu heiraten und inzwischen das wohlgerundete Leben mit jeder hübschen Frau zu führen, die bereit war, dabei mitzuwirken.
Den Prüden in seiner Gemeinde erschienen die buhlerischen Neigungen des neuen Pfarrers als der entsetzlichste Skandal; aber die Prüden waren in der Minderheit. Für die Übrigen, auch für diejenigen, die vollauf die Absicht hatten, tugendhaft zu bleiben, war etwas angenehm Aufregendes an der Situation, die durch die Besetzung der Pfarre mit einem Mann von Grandiers Erscheinung, Gewohnheiten und Ruf geschaffen worden war. Geschlechtlichkeit vermischt sich leicht mit Religion, und die Mischung hat eins von diesen ein wenig abstoßenden und doch köstlichen und durchdringenden Aromen, die den Gaumen überraschen wie eine Offenbarung – wovon? Das eben ist die Frage.
Grandiers Beliebtheit bei den Frauen genügte selber schon, ihn bei den Männern äußerst unbeliebt zu machen. Von Anfang an waren die Ehemänner und Väter seiner weiblichen Pfarrkinder von tiefem Misstrauen gegen diesen gescheiten jungen Gecken mit seinen feinen Manieren und seiner Suada erfüllt, und auch wenn der neue Pfarrer ein Heiliger gewesen wäre, warum hatte eine so saftige Pfründe wie die von Saint-Pierre einem Fremden in den Schoß fallen müssen? Was war denn an den einheimischen jungen Leuten nicht recht? Der Zehnte von Loudun sollte doch einem von Louduns eigenen Söhnen zufließen! Und um die Sache noch schlimmer zu machen, war der Fremde nicht allein gekommen. Er hatte eine Mutter, drei Brüder und eine Schwester mitgebracht. Für einen dieser Brüder hatte er bereits einen Posten in der Kanzlei des obersten Richters der Stadt gefunden. Ein zweiter, welcher Priester war, war zum Hauptvikar von Saint-Pierre gemacht worden. Der dritte, ebenfalls Geistlicher, besaß kein Amt, sondern schlich gierig auf der Suche nach Gelegenheitsarbeiten für einen Kleriker umher. Es war eine Invasion.
Doch auch die Nörgler mussten zugeben, dass Monsieur Grandier eine gewaltig gute und donnernde Predigt halten konnte und ein sehr fähiger Priester war, voll der reinen Lehre und sogar weltlicher Gelehrsamkeit. Aber gerade diese Verdienste sprachen gegen ihn. Weil er ein Mann von Witz und großer Belesenheit war, wurde Grandier gleich zu Anfang von den aristokratischsten und kultiviertesten Persönlichkeiten der Stadt empfangen. Türen, welche den reichen Landlümmeln, den ungehobelten Beamten, den Flegeln von adeliger Geburt, aus denen die höhere, aber nicht die höchste Gesellschaft von Loudun bestand, verschlossen waren, öffneten sich unverzüglich diesem jungen Springinsfeld aus einer anderen Provinz. Und bitter war der Groll der ausgeschlossenen Notabeln, als sie erst von seinem vertrauten Umgang mit Jean d'Armagnac, dem neu ernannten Gouverneur der Stadt und des Schlosses, hörten und dann, dass er bei Louduns berühmtestem Einwohner, dem betagten Scévole de Sainte-Marthe, verkehrte, dem ebenso hervorragenden Rechtsgelehrten und Staatsmann wie Geschichtsschreiber und Dichter. D'Armagnac hielt so viel von den Fähigkeiten und der klugen Umsicht des Pfarrers, dass er während der Zeiten, in denen er am Hof zu sein hatte, Grandier mit der ganzen Führung seiner Geschäfte betraute. Dem Sieur de Sainte-Marthe empfahl sich der Curé vor allem als Humanist, welcher die Klassiker kannte und daher das virgilische Meisterstück des alten Herrn nach seinem wahren Wert zu schätzen wusste, die Paedotropbiae Libri Tres – ein didaktisches Gedicht über die Aufzucht und Ernährung von Kleinkindern, welches so beliebt war, dass zu Lebzeiten des Verfassers zehn Auflagen erforderlich waren, und zugleich so elegant, so korrekt, dass Ronsard sagen konnte, »er ziehe den Urheber dieser Verse allen anderen Dichtern unseres Zeitalters vor und wolle für ihn eintreten, wie groß auch immer das Ärgernis wäre, das er hiedurch Bembo, Navagero und dem göttlichen Fracastoro gäbe«. Ach, wie vergänglich ist der Ruhm, wie völlig vergeblich sind menschliche Anmaßungen! Für uns ist Kardinal Bembo kaum mehr als ein Name, Anderea Navagero eher weniger, und jene Unsterblichkeit, deren sich der göttliche Fracastoro erfreut, verdankt er einzig der Tatsache, dass er der Lustseuche einen höflicheren Spitznamen gab, indem er in makellosem Latein eine medizinische Ekloge über den unseligen Prinzen Syphilus schrieb, welcher nach vielem Leiden vom morbus gallicus durch ausgiebiges Trinken eines Absuds von Gouajakharz befreit wurde. Die toten Sprachen werden immer toter, und die drei Bücher der Paedotrophia behandeln eine weniger dramatische Phase des Sexualzyklus als die libri tres der Syphiliade. Einst von jedermann gelesen, einst für göttlicher als die Göttlichen gehalten, ist Scévole de Sainte-Marthe nun ins Dunkel verschwunden. Aber zur Zeit, als Grandier seine Bekanntschaft machte, umgab ihn noch sein Abendglanz. Er war der Nestor aller Nestoren, eine Art von Nationaldenkmal. In den Kreis seiner Vertrauten aufgenommen zu werden, das war wie mit Notre-Dame de Paris zu Abend zu essen oder eine kleine Plauderei mit dem Pont du Gard zu haben. In dem prächtigen Haus, in das sich dieser verdiente Staatsmann und Doyen der humanistischen Literatur zurückgezogen hatte, unterhielt sich Grandier familiär mit dem großen Mann und seinen kaum weniger hervorragenden Söhnen und Enkeln, und es fanden sich dort Berühmtheiten zu Besuch ein – der Prinz von Wales, inkognito; Théophraste Renaudot, unorthodoxer Physiker, Philanthrop und Vater des französischen Journalismus; Ismaël Boulliau, der künftige Verfasser der monumentalen Astronomia Philolaica und erste Beobachter, der mit Genauigkeit die Periodizität eines veränderlichen Sterns bestimmte. Zu diesem kamen noch solche Ortsgrößen wie Guillaume de Cerisay, der Bailli oder oberste Stadtrichter von Loudun, und Louis Trincant, der Staatsanwalt, ein frommer und gelehrter Mann, welcher ein Schulkamerad Abels de Sainte-Marthe gewesen war und die Vorliebe dieser Familie für Literatur und Altertumsforschung teilte.
Kaum weniger schmeichelhaft als die Freundschaft dieser erlesenen Geister war die von allen anderen gegen den Außenseiter entfaltete Feindschaft. Das Misstrauen der Dummen auf sich zu ziehen, weil er so gescheit war; von den Ungeschickten beneidet zu werden, weil er etwas erreicht hatte; von den Stumpfsinnigen wegen seiner Witzigkeit verabscheut, von den Rüpeln wegen seiner guten Manieren und von den Uneinnehmenden wegen seiner Erfolge bei Frauen gehasst zu werden – welch ein Tribut für seine allgemeine Überlegenheit! Und der Hass war nicht nur einseitig. Grandier waren seine Feinde so herzlich zuwider wie er ihnen. »Zum Teufel mit den Hemmungen, wie schön, sich gehen zu lassen!«[4] Es gibt viele Leute, welchen Hass und Wut höhere Dividenden augenblicklicher Befriedigung tragen als Liebe. Aus angeborener Angriffslust verfallen sie sehr bald ihrem Nebennierenhormon und frönen als Adrenalinsüchtige mit voller Absicht ihren hässlichen Leidenschaften, um des Lustgefühls willen, das sie ihren psychisch stimulierten endokrinen Drüsen abgewinnen. Da sie aus Erfahrung wissen, dass jede Selbstüberhebung immer mit dem Hervorrufen anderer und feindseliger Selbstüberhebungen endet, ziehen sie geflissentlich ihre zornige Grobheit groß. Und wie nicht anders zu erwarten, sehen sie sich sehr bald mitten in einem Streit. Aber ein Streit ist gerade das, woran sie den meisten Genuss finden, denn eben während sie streiten, lässt sie die chemische Beschaffenheit ihres Bluts sich am intensivsten selbst fühlen. Und da ihnen das »ein gutes Gefühl« gibt, nehmen sie natürlich an, dass sie gut sind. Adrenalinsucht wird zu gerechter Entrüstung rationalisiert, und zuletzt sind sie wie der Prophet Jonas unerschütterlich davon überzeugt, dass sie gut daran tun, zornig zu sein.
Fast vom Augenblick seiner Ankunft in Loudun an war Grandier in unziemliche, aber für ihn herzerfreuende Streitereien verwickelt. Einer seiner Gegner zog tatsächlich gegen ihn, den Pfarrer, vom Leder. Mit einem anderen dieser Herren, dem Lieutenant Criminel, welchem die Ortspolizei unterstand, schwelgte er in einem öffentlichen Schimpfduell, das bald in körperliche Gewalttätigkeit ausartete. An Zahl unterlegen, mussten sich der Pfarrer und seine Akolythen in der Schlosskapelle verbarrikadieren. Am nächsten Tag beklagte sich Grandier beim kirchlichen Gerichtshof, und der Lieutenant Criminel erhielt den gebührenden Verweis für seinen Anteil an der skandalösen Affäre. Für den Curé war sie ein Triumph – aber sie kostete ihren Preis. Ein einflussreicher Mann, welcher bloß eine unbegründete Abneigung gegen ihn gefühlt hatte, war nun sein eingefleischter Todfeind geworden und wartete nur auf eine Gelegenheit, sich zu rächen.
Aus elementarster Klugheit nicht weniger als nach christlichem Grundsatz hätte der Pfarrer sein Äußerstes tun müssen, die feindlichen Gesinnungen, von welchen er umgeben war, zu versöhnen. Aber trotz all der bei den Jesuiten verbrachten Jahre war Grandier noch immer sehr weit davon entfernt, ein Christ zu sein. Und trotz alles guten Rats, den er von d'Armagnac und seinen anderen Freunden erhielt, war er, wo seine Leidenschaften mit im Spiel waren, unfähig, mit kluger Umsicht zu handeln. Eine lange religiöse Übungszeit hatte seine Selbstliebe nicht beseitigt oder auch nur gemindert; sie hatte nur dazu gedient, sein Ich mit einem theologischen Alibi zu versorgen. Der ununterrichtete Ichsüchtige will bloß, was er will. Man gebe ihm eine religiöse Erziehung, und es wird für ihn selbstverständlich, es wird ein Axiom für ihn, dass, was er will, Gott will; dass sein Anliegen das Anliegen dessen ist, was eben er für die wahre Kirche hält; und dass jeder Kompromiss ein metaphysisches München, eine Beschwichtigung des radikal Bösen ist. »Sei willfähig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist.« Menschen wie Grandier scheint Christi Rat eine blasphemische Aufforderung zu sein, einen Pakt mit Beelzebub zu schließen. Statt zu versuchen, sich mit seinen Feinden zu vertragen, ging der Pfarrer daran, ihre Feindschaft nach bestem Vermögen zu verschärfen. Und sein Vermögen in dieser Hinsicht kam fast Genialität gleich.
Die gute Fee, die sich an der Wiege der Bevorrechteten einstellt, ist oft die böse Fee in einer leuchtenden Verkleidung. Sie kommt mit Geschenken beladen; aber ihre Freigebigkeit ist nur allzu oft verhängnisvoll. Diesem Urbain Grandier zum Beispiel hatte die gute Fee, zusammen mit sehr gediegenen Geschenken, die blendendste und auch gefährlichste aller Gaben in die Wiege gelegt: Beredsamkeit. Von einem guten Schauspieler gesprochen – und jeder gute Prediger, jeder erfolgreiche Anwalt und Politiker ist unter anderm ein vollendeter Schauspieler – können Worte eine fast magische Gewalt über ihre Hörer ausüben. Weil diese Gewalt ihrem Wesen nach irrational ist, stiften auch die von den besten Absichten beseelten in der Öffentlichkeit Sprechenden wahrscheinlich mehr Schaden als Nutzen. Wenn ein Redner durch die bloße Magie seiner Worte und einer berückenden Stimme seine Zuhörer von der Rechtlichkeit einer schlechten Sache überzeugt, sind wir, ganz wie es sich gehört, bestürzt. Wir sollten die gleiche Bestürzung empfinden, sooft wir entdecken, dass die gleichen irrelevanten Kniffe angewendet werden, um Leute zum Glauben an die Rechtlichkeit einer guten Sache zu überreden. Der so erzeugte Glaube mag wünschenswert sein, aber seine Ursachen sind ihrem Wesen nach schlecht, und wer die Mittel der Redekunst dazu benutzt, anderen einen, und sei es auch richtigen, Glauben einzuflößen, macht sich schuldig, den unrühmlichsten Elementen der menschlichen Natur Kupplerdienste zu leisten. Indem er von seiner unheilvollen Redegabe Gebrauch macht, vertieft er die gleichsam hypnotische Trance, in welcher die meisten Menschen leben und aus welcher sie zu befreien das Ziel und der Zweck jeder wahren Philosophie, jeder echt geistlichen Religion ist. Überdies ist wirksame Beredsamkeit ohne übermäßige Vereinfachung nicht möglich. Aber man kann nicht übervereinfachen, ohne die Tatsachen zu entstellen. Auch wenn er sein Möglichstes tut, die Wahrheit zu sagen, ist der erfolgreiche Redner ipso facto ein Lügner. Und die meisten erfolgreichen Redner, das braucht man kaum hinzuzufügen, versuchen nicht einmal, die Wahrheit zu sagen. Sie versuchen, Sympathie für ihre Freunde und Antipathie für ihre Gegner zu erwecken. Grandier gehörte leider zu der Mehrheit. Sonntag für Sonntag gab er auf der Kanzel von Saint-Pierre seine berühmten Nachahmungen des Jeremias und Ezechiel, des Demosthenes, des Savonarola und sogar des Rabelais – denn er war ebenso tüchtig im Verspotten wie in gerechter Entrüstung, in Ironie wie in apokalyptischem Wettern.
Die Natur verabscheut ein Vakuum, sogar im Geist. Heutzutage wird die schmerzhafte Leere der Langeweile durch Kino und Rundfunk, Fernsehen und Bilder ohne Worte gefüllt und immer wieder erneuert. Glücklicher daran, oder vielleicht (wer weiß?) unglücklicher als wir, waren unsere Vorfahren für die Milderung der Langeweile auf die allwöchentliche Vorstellung angewiesen, die ihr Sprengelpfarrer gab, welche von Zeit zu Zeit durch Diskurse gastierender Kapuziner oder durchreisender Jesuiten ergänzt wurde. Predigen ist eine Kunst, und in dieser wie in allen anderen Künsten übertrifft die Zahl der schlechten bei Weitem die der guten Künstler. Die Pfarrkinder von Saint-Pierre konnten sich dazu beglückwünschen, in Hochwürden Grandier einen glänzenden Virtuosen zu besitzen, welcher bereit und fähig war, höchst unterhaltsam wie über das hehrste christliche Mysterium so über die heikelste, die wundeste und unsauberste parochiale Angelegenheit zu improvisieren. Wie rund heraus prangerte er Missbräuche an! Wie furchtlos tadelte er sogar Hochgestellte! Die chronisch gelangweilte Mehrheit war entzückt. Ihr Beifall diente nur dazu, die Wut derjenigen zu steigern, die zu Opfern der Beredsamkeit des Pfarrers gemacht worden waren.
Zu diesen Opfern gehörten die Mönche der verschiedenen Orden, die, seit offene Feindseligkeiten zwischen Hugenotten und Katholiken aufgehört hatten, daran gegangen waren, Klöster in der einst protestantischen Stadt zu errichten. Grandiers vornehmlichster Grund, die Mönche nicht zu mögen, war der, dass er selbst Weltpriester war und so treu zu seiner Kaste hielt wie der gute Soldat zu seinem Regiment, der gute Student zu seiner Schule, der gute Kommunist oder Faschist zu seiner Partei. Ergebenheit für die Organisation A bringt immer ein gewisses Maß von Argwohn, Verachtung oder unumwundenem Abscheu gegenüber den Organisationen B, C, D und allen Übrigen mit sich. Und das trifft sogar auf die einzelnen Gruppen innerhalb eines größeren, übergeordneten Ganzen zu. Die Geschichte der Kirchen zeigt eine Hierarchie von Hassgefühlen in geordneten Abstufungen, vom offiziellen und ökumenischen Hass der betreffenden Kirche gegen Häretiker und Ungläubige bis herab zu den besonderen Hassgefühlen des einen Ordens gegen den anderen, der einen Schule gegen die andere, zwischen Provinz und Provinz, zwischen Theologe und Theologe.
»Es wäre gut«, so schrieb der heilige Franz von Sales 1612, »es wäre gut, durch das Einwirken frommer und kluger Kirchenfürsten eine Einigung und ein gegenseitiges Verstehen zwischen der Sorbonne und den Jesuiten herbeizuführen. Bestünde in Frankreich eine durchgehende Einigung der Bischöfe, der Sorbonne und der geistlichen Orden, wäre es in zehn Jahren um die Ketzerei getan« (Œuvres, XV, 188). Es wäre um die Ketzerei getan, weil, wie der Heilige an einer anderen Stelle sagt, »wer immer mit Liebe prediget, prediget genugsam gegen Ketzerei, so er auch nie das strittige Wort gebrauche« (Œuvres, VI, 309). Eine Kirche, welche durch innere Regungen von Hass uneins ist, kann nicht systematisch Liebe praktizieren und sie nicht ohne offenkundige Heuchelei predigen. Aber statt Einigkeit gab es beständigen Zwist; statt Liebe das odium theologicum und den aggressiven Patriotismus der Kasten, Schulen und Orden. Zu der Fehde zwischen den Jesuiten und der Sorbonne kam bald die Fehde zwischen den Jansenisten und einem Bund der Jesuiten mit den Salesianerinnen hinzu. Und danach kam der sich lange hinziehende Streit über Quietismus und selbstlose Liebe. Am Ende wurden die Zwistigkeiten der gallikanischen Kirche, die inneren und die äußeren, nicht durch Liebe oder Überredung beigelegt, sondern durch autoritäre Ukasse. Für die Ketzer gab es die Dragonaden und zuletzt die Widerrufung des Edikts von Nantes. Für die zankenden Kleriker gab es päpstliche Bullen und Androhungen der Exkommunikation. Die Ordnung wurde wiederhergestellt, aber auf die denkbar unerbaulichste Weise, durch die gröblichst ungeistlichen, die wenigst religiösen und humanen Mittel.
Parteitreue ist für die Gesellschaft verderblich; für den Einzelnen aber kann sie reichlich lohnend sein – auf viele Weise lohnender als sogar Sinnengier und Geiz. Hurentreiber und Geldraffer finden es schwer, auf ihre Tätigkeit sehr stolz zu sein. Parteifanatismus aber ist eine komplexe Leidenschaft, welche den in ihr Schwelgenden erlaubt, sich das Beste aus beiden Welten zu holen. Weil sie alles um einer Gruppe willen tun, welche der Definition nach gut und sogar geheiligt ist, können sie sich selbst bewundern und ihren Nächsten verabscheuen, sie können nach Macht und Geld streben, können die Freuden der Aggression und Grausamkeit genießen, und dies nicht nur ohne sich schuldig zu fühlen, sondern mit einem geradezu glühenden Bewusstsein von Tugendhaftigkeit. Treue zu ihrer Gruppe verwandelt diese angenehmen Laster in Heldentaten. Parteifanatiker sind sich ihrer selbst nicht als Sünder und Verbrecher bewusst, sondern als Altruisten und Idealisten. Und mit gewissen Einschränkungen sind sie es tatsächlich. Der einzige Haken daran ist der, dass ihr Altruismus bloß ein ganz naher Verwandter des Egoismus und das Ideal, für das ihr Leben hinzugeben sie in vielen Fällen bereit sind, nichts anderes ist als die Rationalisierung korporativer Interessen und parteilicher Leidenschaften.
Wenn Grandier die Mönche von Loudun kritisierte, geschah das, dessen können wir sicher sein, mit einem Gefühl gerechten Eifers, einem Bewusstsein, Gottes Werk zu tun. Denn Gott war, das verstand sich von selbst, auf der Seite der Weltpriesterschaft und der guten Freunde Grandiers, der Jesuiten. Karmeliter und Kapuziner waren ganz am Platz innerhalb der Mauern ihrer Klöster oder wenn sie Missionen in abgelegenen Dörfern durchführten. Aber es kam ihnen nicht zu, ihre Nase in die Angelegenheiten einer Stadtbürgerschaft zu stecken. Es war Gottes Ratschluss, dass die Reichen und Angesehenen von der Weltpriesterschaft geleitet werden sollten – vielleicht mit ein wenig Unterstützung durch die frommen Väter der Gesellschaft Jesu. Eine der ersten Taten des neuen Pfarrers war es, von der Kanzel zu verkünden, dass die Glaubenstreuen die Verpflichtung hätten, ihrem Sprengelpfarrer zu beichten und keinem Außenseiter. Die Frauen, die eifrigsten Beichtkinder, waren nur allzu bereit, zu gehorchen. Ihr Sprengelpfarrer war nun ein gepflegter, hübscher junger Gelehrter mit den Manieren eines Herrn von Stand. Das konnte man von dem durchschnittlichen Kapuziner- oder Karmeliter-Beichtvater nicht behaupten. Fast über Nacht verloren die Mönche die meisten ihrer schönen Pönitentinnen und mit ihnen den größten Teil ihres Einflusses in der Stadt. Grandier ließ dieser ersten Salve ein Einzelfeuer wenig höflicher Anspielungen auf die Haupteinnahmequelle der Karmeliter folgen – auf ein wundertätiges Bildnis, genannt Notre-Dame de Recouvrance. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ein ganzes Stadtviertel fast nur aus Gasthöfen und Logierhäusern für die Unterbringung von Pilgern bestand, welche das Gnadenbild um Gesundheit oder um einen Ehemann, um einen Leibeserben oder um mehr Glück bitten kamen. Nun aber hatte Notre-Dame de Recouvrance eine gewaltige Rivalin in Notre-Dame des Ardilliers, deren Kirche sich in Saumur befand, nur ein paar Meilen von Loudun. Es gibt genauso Moden in Heiligen, wie es Moden in Heilmethoden und Damenhüten gibt. Jede große Kirche hat ihre Geschichte von Emporkömmlingen unter ihren Bildern und Statuen, von Parvenüreliquien, welche rücksichtslos die älteren Wundertäter beiseitegestoßen haben, nur um ihrerseits wieder aus der Gunst des Publikums durch irgendeinen neueren und im Augenblick anziehenderen Thaumaturgen verdrängt zu werden. Warum schien Notre-Dame des Ardilliers fast plötzlich Notre-Dame de Recouvrance so gewaltig überlegen zu sein? Der offenkundigste der zweifellos sehr zahlreichen Gründe war der, dass sich Notre-Dame des Ardilliers in der Obhut der Oratorianer befand und, wie Aubin, der erste Biograf Grandiers, bemerkt, »alle Welt ist darin einer Meinung, dass die Priester vom Oratorium fähige Männer und gerissener sind als die Karmeliter«. Die Oratorianer, daran muss man sich erinnern, waren Weltpriester. Vielleicht hilft dies zur Erklärung der skeptischen Kühle Grandiers gegenüber Notre-Dame de Recouvrance. Treue zu seiner Kaste trieb ihn, zu Nutz und Ruhm der Weltpriesterschaft zu wirken und zur Herabsetzung und zum Ruin der Mönche.
Notre-Dame de Recouvrance wäre gewiss, auch wenn Grandier nie nach Loudun gekommen wäre, in Vergessenheit geraten. Die Karmeliter aber zogen es vor, da anderer Meinung zu sein. Von Ereignissen realistisch zu denken, in Begriffen multipler Kausalzusammenhänge, ist schwer und fürs Gefühl wenig lohnend. Wie viel leichter, wie viel angenehmer, jede Wirkung auf eine einzige und womöglich persönliche Ursache zurückzuführen! Zur Illusion des Verstehens gesellt sich in diesem Fall, wenn die Umstände günstig sind, die Lust der Heldenverehrung und, wenn sie ungünstig sind, das noch größere Lustgefühl, einen Sündenbock zu verfolgen.
Zu diesem Kleinzeug von Feinden erwarb sich Grandier bald einen anderen hinzu, welcher ihm unermesslich mehr zu schaden vermochte. Anfang des Jahres 1618, auf einem von allen kirchlichen Würdenträgern der Gegend besuchten Konvent, ließ Grandier es sich eigens angelegen sein, den Prior von Coussay zu kränken, indem er grob den Vortritt vor ihm in einer feierlichen Prozession durch die Straßen von Loudun beanspruchte. Sachlich war die Haltung des Pfarrers unangreifbar. In einer Prozession, welche in seiner eigenen Kirche ihren Anfang nahm, hatte ein Chorherr von Sainte-Croix ein gutes Recht, dem Prior von Coussay voranzuschreiten. Und dieses Recht galt auch dann, wenn, wie hier der Fall, der Prior zugleich ein Bischof war. Aber es gibt so etwas wie Höflichkeit; und es gibt auch so etwas wie umsichtige Klugheit. Der Prior von Coussay war Bischof von Luçon, und der Bischof von Luçon war kein anderer als Armand-Jean du Plessis de Richelieu.
Im Augenblick – und das wäre ein zusätzlicher Grund gewesen, sich mit großmütiger Courtoisie zu betragen – war Richelieu in Ungnade. Im Jahre 1617 war sein Gönner, der italienische Gangster Concini, ermordet worden. Dieser Staatsstreich war von Luynes bewerkstelligt und von dem jungen König gebilligt worden. Richelieu wurde aller Macht entkleidet und unzeremoniös vom Hof vertrieben. Aber gab es irgendeinen Grund zu der Annahme, diese Verbannung werde eine dauernde sein? Ganz und gar keinen. Und tatsächlich wurde ein Jahr später, nach einem kurzen Exil in Avignon, der unentbehrliche Bischof von Luçon nach Paris zurückgerufen. Im Jahre 1622 war er schon Erster Minister des Königs und Kardinal.
Mutwillig, um des bloßen Genusses willen, sich zur Geltung zu bringen, hatte Grandier einen Mann beleidigt, welcher sehr bald der absolute Herrscher Frankreichs werden sollte. Später sollte der Pfarrer Grund haben, sein unhöfliches Benehmen zu bereuen. Inzwischen erfüllte ihn dieser Streich mit kindischer Befriedigung. Er, ein Bürgerlicher, ein obskurer Gemeindepfarrer, hatte den Stolz eines Günstlings der Königin gebeugt, eines Bischofs, eines Adeligen. Er empfand das Hochgefühl eines kleinen Jungen, welcher seinem Lehrer eine Nase gedreht hat und ungeschoren davongekommen ist.
Richelieu selbst fand in späteren Jahren einen ebensolchen Genuss daran, sich gegenüber Prinzen von Geblüt genauso zu benehmen, wie Urbain Grandier sich ihm gegenüber benommen hatte. »Zu denken«, sagte der alte Onkel des Kardinals, als er ihn seelenruhig dem Herzog von Savoyen vorantreten sah, »zu denken, dass ich es noch erlebt habe, den Enkel des Advokaten La Porte vor dem Enkel Karls V. ein Zimmer betreten zu sehen!« Wieder einmal war ein grässlicher kleiner Junge ungeschoren davongekommen.
Die Schablone für Grandiers Leben in Loudun war nun geschnitten. Er erfüllte seine priesterlichen Pflichten und besuchte in den Pausen diskret die hübscheren Witwen, verbrachte gesellige Abende in den Häusern seiner intellektuellen Freunde und stritt mit einem immer größer werdenden Kreis von Feinden. Es war ein durch und durch angenehmes Dasein, gleichermaßen für Herz und Hirn befriedigend, für die Keimdrüsen und die Nebennieren, für die soziale persona und sein privates Ich. Bis jetzt hatte sich noch kein grobes oder offenkundiges Missgeschick in seinem Leben ereignet. Er konnte sich noch immer einbilden, dass seine Genüsse unentgeltlich seien, dass er straflos begehren und folgenlos verabscheuen dürfe. Tatsächlich hatte das Schicksal freilich schon begonnen, seine Rechnung zu präsentieren, aber unauffällig. Er hatte keine Verwundung erlitten, welche er spüren konnte, nur eine unmerkliche Vergröberung und Verhärtung des Wesens, nur eine zunehmende Verdunkelung des inneren Lichts, eine allmähliche Verengung des auf die Ewigkeit gehenden Fensters der Seele. Einem Mann vom Temperament Grandiers – dem sanguinisch-cholerischen, gemäß der medizinischen Konstitutionslehre seiner Zeit – schien es noch immer selbstverständlich zu sein, dass mit der Welt alles gut stand. Und wenn mit der Welt alles gut stand[5], dann musste Gott in seinem Himmel sein. Der Pfarrer war glücklich. Oder, um es ein bisschen genauer auszudrücken, unter seinen wechselnden Stimmungen war es die manische, die noch immer vorherrschte.
Im Frühjahr 1623, in der Fülle seiner Jahre und Ehren, starb Scévole de Sainte-Marthe und wurde mit allem gebührenden Pomp in der Kirche von Saint-Pierre-du-Marché beigesetzt. Sechs Monate später, bei einer Gedächtnismesse, an welcher alle Notabeln von Loudun und Châtellerault, von Chinon und Poitiers teilnahmen, hielt Grandier dem großen Mann die Leichenrede. Es war eine lange und glänzende oraison funèbre, in der noch nicht altmodischen (denn die erste Auflage von Balzacs[6] stilistisch revolutionären Lettres erschien erst im folgenden Jahr) Manier der »frommen Humanisten«. Die lang gesponnenen Sätze glitzerten von Zitaten aus den Klassikern und der Bibel; eine protzige und überflüssige Gelehrtheit stellte sich selbstgefällig an jeder möglichen Stelle zur Schau; die Perioden rumpelten mit künstlichem Donner dahin. Für diejenigen, denen dergleichen gefiel – und wem gefiel es 1623 nicht? –, war das ganz entschieden etwas, das ihnen gefallen musste.
Grandiers Rede wurde denn auch mit allgemeinem Beifall aufgenommen. Abel de Sainte-Marthe war von der Beredsamkeit des Pfarrers so tief bewegt, dass er auf sie ein lateinisches Epigramm schrieb und es veröffentlichte. Nicht weniger schmeichelhaft waren die Verse, die Monsieur Trincant, der Staatsanwalt, in der Volkssprache schrieb.
Ce n'est pas sans grande raison
Qu'on a choisi ce personnage
Pour entreprendre l'oraison
Du plus grand homme de son âge;
Il fallait véritablement
Une éloquence sans faconde
Pour louer celuy dignement
Qui n'eut point de second au monde.[3]
Der arme Monsieur Trincant! Seine Leidenschaft für die Musen war echt, aber hoffnungslos. Er liebte sie, aber sie, das ist unverkennbar, liebten ihn nicht. Doch wenn er keine Poesie zu schreiben vermochte, konnte er immerhin über sie reden. Nach 1623 wurde der Salon des Staatsanwalts zum Mittelpunkt des geistigen Lebens von Loudun. Es war ein recht schwächliches Leben, nun, da Sainte-Marthe dahin war. Trincant selbst war ein wohlbelesener Mann; aber die meisten seiner Freunde und Verwandten waren das nicht. Aus dem Hôtel Sainte-Marthe ausgeschlossen, hatten diese Leute leider ein gewohnheitsmäßiges Anrecht, von dem Staatsanwalt eingeladen zu werden. Aber wenn sie zur Tür hereinkamen, flogen Gelehrsamkeit und gebildetes Gespräch zum Fenster hinaus. Wie hätte es anders sein können bei diesen Kränzchen gackelnder Weiber; diesen Juristen, die von nichts anderm als Statuten und Prozessordnungen wussten; diesen Landjunkern, deren einziges Interesse Hunden und Pferden galt? Und schließlich fanden sich hier noch Monsieur Adam, der Apotheker, und Monsieur Mannoury, der Wundarzt, ein – der langnasige, hagere Adam, der mondgesichtige, dickbäuchige Mannoury. Gravitätisch wie nur je ein Doktor der Sorbonne ließen sie sich über die Vorzüge des Antimons und der Schröpfköpfe aus, über den Wert von Seife in Klistieren und des Kauterisierens bei der Behandlung von Schusswunden. Und mit gesenkter Stimme sprachen sie sodann (natürlich immer in strengstem Vertrauen) von der Lustseuche der Marquise, von der zweiten Fehlgeburt der Frau des königlichen Rats, von der Bleichsucht der jungen Nichte des Gerichtsvollziehers. Zugleich albern und anmaßend, feierlich ernst und grotesk, waren der Apotheker und der Chirurg geradezu vorbestimmte Zielscheiben, welche zu Sarkasmus reizten und die Pfeile des Spottes herausforderten. Mit der erbarmungslosen Grausamkeit eines witzigen Mannes, welcher um eines Gelächters willen vor nichts zurückschreckt, gab ihnen der Pfarrer, wonach sie verlangten. In sehr kurzer Zeit hatte er zwei neue Feinde.
Mittlerweile erstand ihm noch ein anderer. Der Staatsanwalt war ein Witwer in mittleren Jahren mit zwei heiratsfähigen Töchtern, von welchen die ältere, Philippe, so auffallend hübsch war, dass der Pfarrer sich im Winter 1623 immer häufiger dabei ertappte, wie er seine Blicke auf ihr ruhen ließ.
Wenn er das junge Ding so beobachtete, wie es sich zwischen den Gästen ihres Vaters umherbewegte, verglich er es abschätzend mit seinem geistigen Bild von der munteren jungen Witwe, welche er damals jeden Dienstagnachmittag über den vorzeitigen Tod ihres armen, lieben Ehegemahls, des Weinhändlers, zu trösten pflegte. Ninon war völlig ungebildet, konnte kaum ihren Namen schreiben. Aber unter dem untröstlichen Schwarz ihrer Trauerkleider begann das üppige Fleisch nur gerade erst seine Festigkeit zu verlieren. Es fanden sich da wahre Schätze von Wärme und Weiße, ein unerschöpflicher Vorrat von zugleich verzückter und wissenschaftlicher, toller und doch bewundernswert gelehriger und geübter Sinnlichkeit. Und Gott sei Dank waren keine Schranken von Prüderie mühsam niederzureißen, keine öden Präliminarien platonischen Idealisierens und petrarkistischen Werbens zu erledigen gewesen! Bei ihrer dritten Zusammenkunft hatte er es gewagt, die Anfangsverse eines seiner Lieblingsgedichte zu zitieren.
Souvent j'ai menti les ébats
Des nuits, t'ayant entre mes bras,
Folâtre, toute nue,
Mais telle jouissance, hélas!
Encor m'est inconnue![4]
Es hatte darauf keinen Widerspruch gegeben, sondern nur das unverhüllteste Lachen und einen sehr kurzen, aber unzweideutigen Blick aus dem Augenwinkel. Am Ende seines fünften Besuchs war er in der Lage, Tahureau abermals zu zitieren.
Adieu, ma petite maîtresse,
Adieu, ma gorgette et mon sein,
Adieu, ma délicate main,
Adieu, donc, mon téton d'albâtre,
Adieu, ma cuissette folâtre,
Adieu, mon œil, adieu, mon cœur,
Adieu, ma friande douceur!
Mais avant que je me départe,
Avant que plus loin je m'écarte,
Que je tâte encore ce flanc
Et le rond de ce marbre blanc![5]
Adieu, aber nur bis übermorgen, wo sie zu ihrer wöchentlichen Beichte in Saint-Pierre erscheinen würde – er war ein Pedant, was allwöchentliches Beichten betraf –, und zu der käme die übliche Buße hinzu. Und dann, bis zum nächsten Dienstag, würde er die Predigt, die er nun für das Fest der Reinigung der Jungfrau Maria vorbereitete, gepredigt haben – seine beste oratorische Leistung seit der Leichenrede auf Monsieur de Sainte-Marthe. Welche Beredsamkeit, welch erlesene und tiefe Gelehrsamkeit, welche subtile, aber ungemein solide Theologie! Beifall, Beglückwünschungen! Der Lieutenant Criminel wäre wütend, die Klosterbrüder würden gelb und grün vor Neid. »Monsieur le Curé, Sie haben sich selbst übertroffen! Hochwürden sind unvergleichlich!« Zu seinem nächsten Stelldichein ginge er in einer Gloriole von Ruhm, und als Siegeskranz empfinge er die Umschlingung ihrer Arme, als Siegerlohn ihre Küsse, ihre Liebkosungen, diese letzte Vergötterung im Himmel ihrer Umarmung. Mochten die Karmeliter von ihren Ekstasen reden, ihren himmlischen Berührungen, ihren außerordentlichen Begnadungen und geistlichen Hochzeiten! Er hatte seine Ninon, und Ninon genügte ihm. Wenn er jedoch abermals auf Philippe blickte, fragte er sich jedesmal, ob Ninon am Ende wirklich genügte. Witwen waren eine große Tröstung, und er sah keinen Grund, seine Dienstagnachmittage aufzugeben; aber Witwen waren ganz entschieden keine Jungfrauen, Witwen wussten zu viel, Witwen begannen Fett anzusetzen. Wogegen Philippe noch die dünnen, knochigen Arme eines kleinen Mädchens, die apfelrunden Brüstchen und den glatten, säulenhaften Hals einer Halbwüchsigen hatte. Und wie hinreißend war diese Mischung aus jugendlicher Anmut und jugendlicher Unbeholfenheit! Wie rührend und dabei wie herausfordernd und aufregend waren diese Übergänge von einer kecken, fast tollkühnen Koketterie zu jähem panischen Schrecken! Die Rolle einer Kleopatra übertreibend, lud sie jeden Mann förmlich dazu ein, einen Antonius aus sich zu machen. Aber es mochte bloß irgendein Mann merken lassen, dass er bereit war, die Einladung anzunehmen, dann verschwand die Königin von Ägypten; nur ein erschrockenes Kind blieb zurück und bat um Gnade. Und dann, sobald die gewährt war, kam die Sirene zurück, sang Lockungen, ließ verbotene Früchte baumeln, alles mit einer Keckheit, deren nur die völlig Verderbten oder die völlig Unschuldigen fähig sind. Unschuld, Reinheit – welch eine herrliche Predigt hatte er über dieses erlesenste aller Themen verfasst! Die Frauen würden weinen, wenn er sie – bald donnernd, bald im zartesten Flüsterton – von der Kanzel seiner Kirche herab hielte. Sogar die Männer wären von ihr gerührt. Die Reinheit der betauten Lilie, die Unschuld von Lämmern und kleinen Kindern! Ja, die Klosterbrüder würde der Neid fressen. Aber alle Lilien, nur nicht die in Predigten und im Himmel, welken früher oder später und verfaulen; das Lämmlein ist zunächst für den unermüdlich lustvollen Widder, dann für den Schlächter vorbestimmt; und in der Hölle schreiten die Verdammten auf einem lebendigen Fußboden dahin, welcher mit winzigen Leibern ungetaufter Neugeborener ausgelegt ist. Seit dem Sündenfall ist völlige Unschuld für alle praktischen Zwecke mit völliger Verderbtheit identisch. Jedes junge Mädchen ist der Anlage nach die wissendste aller Witwen, und dank der Erbsünde ist jede erdenkliche Unreinheit sogar in den Allerunschuldigsten schon mehr als halb verwirklicht. Ihr zur völligen Verwirklichung zu verhelfen, die noch jungfräuliche Knospe sich zur geil geöffneten Blüte entfalten zu sehen – das wäre ein Genuss nicht nur für die Sinne, auch für den reflektierenden Verstand und den Willen. Es wäre ein moralischer und sozusagen metaphysischer Triumph der Sinnlichkeit.