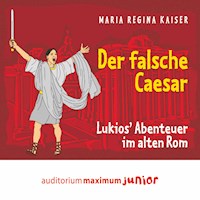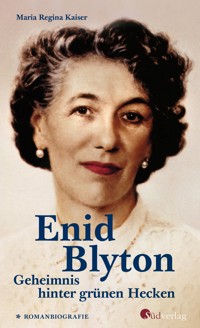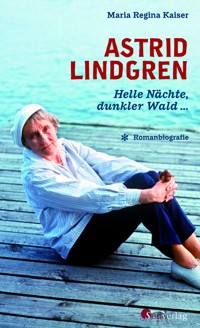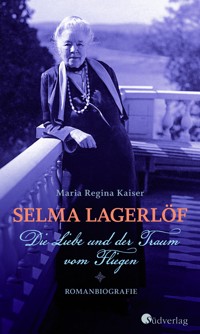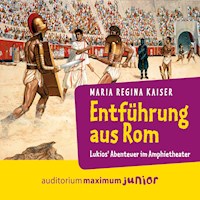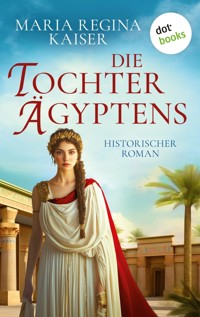
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender Historienroman über den legendären Machtkampf zwischen Ägypten und Rom Sie war das Schicksal Ägyptens, Geliebte Caesars, Widersacherin Roms – und Kleopatras Schwester … Als Tochter des ägyptischen Königs wächst Arsinoë im prachtvollen Palast von Alexandria auf. Als Thronanwärterin ist ihr ein Leben voller Machtkämpfe und politischer Intrigen vorherbestimmt – doch es ist ausgerechnet ihre Schwester Kleopatra, die zu ihrer erbittertsten Feindin wird: Als diese sich mit dem römischen Reich verbündet, bleibt Arsinoë keine andere Wahl – sie ruft zur Rebellion gegen die Besatzer aus dem Norden auf. An der Seite des Feldherrn Achillas zieht sie gegen Caesar und ihre Schwester in den Krieg, um ihre Vision eines freien Ägyptens zu verwirklichen. Doch wer alles riskiert, der fällt umso tiefer … »Jeder Leser, der sich wirklich für Ägypten interessiert, sollte zu ›Die Tochter Ägyptens‹ greifen.« DIE WELT Ein opulenter und mitreißender historischer Roman über die Frau, die Kleopatra und Caesar als Gegenkönigin die Stirn bot – ein farbenprächtiges Antikengemälde für die Fans von Juliane Stadler und Mika Waltari. In der lose zusammenhängenden Reihe »Töchter der Antike« sind erschienen: Band 1: »Die Tochter Ägyptens« Band 2: »Die Erbin der Pharaonen« Die Bände sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie war das Schicksal Ägyptens, Geliebte Caesars, Widersacherin Roms – und Kleopatras Schwester … Als Tochter des ägyptischen Königs wächst Arsinoë im prachtvollen Palast von Alexandria auf. Als Thronanwärterin ist ihr ein Leben voller Machtkämpfe und politischer Intrigen vorherbestimmt – doch es ist ausgerechnet ihre Schwester Kleopatra, die zu ihrer erbittertsten Feindin wird: Als diese sich mit dem römischen Reich verbündet, bleibt Arsinoë keine andere Wahl – sie ruft zur Rebellion gegen die Besatzer aus dem Norden auf. An der Seite des Feldherrn Achillas zieht sie gegen Caesar und ihre Schwester in den Krieg, um ihre Vision eines freien Ägyptens zu verwirklichen. Doch wer alles riskiert, der fällt umso tiefer …
eBook-Neuausgabe August 2025
Dieses Buch erschien bereits 1998 unter dem Titel »Arsinoë – Königin von Ägypten« im Europa Verlag und 2000 bei Bastei Lübbe.
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Europa Verlag, München — Wien
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/TheGoldTiger, Sol Revolver
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-98952-886-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Maria Regina Kaiser
Die Tochter Ägyptens
Historischer Roman
SOMA SEMA – FÜR RICK
Wer zum Tyrannen hingeht,
wird immer Sklave sein,
und käm er noch so frei.
SOPHOKLES
Prolog
Über dem östlichen Himmel stieg die Sonne langsam auf, der Himmel war jetzt glutrot. Glutrot war auch das Meer, über dem morgendlicher Dunst schwebte. Die Wachen grüßten uns, als wir den Königspalast durch das östliche Tor verließen. Die Fischer, von der Arbeit ausgemergelte, sonnenverbrannte Gestalten in schmutzigen Lendenschurzen, hockten an der Kaimauer und flickten ihre Netze mit den hastigen Bewegungen der Armen, die es eilig haben. Ganz kurz nur sahen sie von der Arbeit auf, um uns mit den Augen zu folgen. Ich trug den offenen Korb mit duftendem Brot, das auf Rosenblättern lag.
Vor mir ging Arsinoë in einem weißen Leinenkleid. Die tiefschwarzen glänzenden Locken fielen lose auf ihren Rücken herab. Sie war gerade acht Jahre alt geworden und sehr stolz darauf, Priesterin der Isis zu sein. Arsinoë trug sattgelben Käse in ihrem Binsenkörbchen. Vor uns schritt der kahlköpfige Eunuch Ganymedes, unser Erzieher. Wir stiegen mit langsamen, gemessenen Bewegungen in die Barke, deren Außenwände mit Blumenkränzen behängt waren. Die Ruderer tauchten ihre silberbeschlagenen Blätter ins Wasser. Das Boot bewegte sich auf den Isistempel bei Kap Lochias zu. Das Meer unter uns war kristallklar, dunkle schmale Fische schnellten in der Tiefe vorbei. Man hätte sie mit den Händen fangen können.
Wenig später erreichten wir den mächtigen Vorbau des Tempels. Im Innenhof waren weißgekleidete Tempeldiener damit beschäftigt, zu kehren und Wasser zu sprengen. Auch Thutmosis, der blinde Sänger mit den verkrüppelten Füßen, war schon im Innenhof an seinem gewohnten Platz auf dem Beduinenteppich. Er schlug seine Holzklappern durch die Luft und sang den Morgengesang für die Göttin Isis.
Die Besucher des Tempels trafen ein, fast alle waren sie Hofbeamte, Sklaven und Eunuchen, die zum Palast gehörten. Die Tempeltür war weit geöffnet. Die goldglänzende Göttin auf ihrem Thron war für alle sichtbar. Auf ihrem Kopf trug sie einen Schmuck aus Kuhhörnern, auf ihrem Schoß saß der nackte Horusknabe, um ihren Arm wand sich eine züngelnde Kobra, ihr Fuß stand auf einem Krokodil.
Vor dem Treppenaufgang zum Tempel blieben wir stehen. Die Priester, alle mit kahlgeschorenen Köpfen, weißen Leinengewändern und Sandalen aus Palmstroh, besprengten uns mit heiligem Wasser. Andere Priester beteten mit ausgebreiteten Händen auf den Stufen des Tempels, den Blick auf die Göttin mit dem Kind gerichtet.
Der heilige Bittgesang wurde angestimmt. Die Priester sangen vor. Die Menschen im Vorhof des Tempels schwangen ihre Sistra und antworteten mit dem Refrain: »Dich rufen wir an, große Herrin, zu dir erheben wir unsere Stimme.«
Dann trat Stille ein. Plötzlich erhob sich die reine Kastratenstimme des Thutmosis durch den Hof:
»Große Mutter, einzige
mit den tausend Namen,
Allwisserin,
Heilerin der Schmerzen!
Die Getrennten fuhrst du zusammen!
Licht in der Dunkelheit!
Öffne unsere blinden Augen
gib uns Kraft und Erkenntnis!«
Jetzt durften wir hochgehen, um der Göttin ihr Frühstück zu reichen. Wir verneigten uns ehrfurchtsvoll vor Isis mit dem Horusknaben und legten ihr unsere Opfergaben vor die Füße. Die Tempeldiener zogen einen leuchtendblauen Vorhang vor die Statue, um ihr Mahl nicht zu stören. Der Gottesdienst war damit beendet.
Arsinoë und ich verharrten noch einige Augenblicke auf der obersten Treppenstufe im Gebet, ehe wir den Rückweg antraten.
Unten im Hof des Heiligtums umarmte Ganymedes einen Mann, der gerade erst durch das Tor zwischen den Pylonen eingetreten war. Auch er trug das ärmellose weiße Leinengewand und Schuhwerk aus Palmstroh. Um seinen Hals aber lagen auf der tiefdunklen Haut schwere goldene Ketten und Amulette. Zwei wüstenfarbene Löwinnen, noch junge, verspielte Tiere, umschmeichelten ihn und leckten seine Hände. Wir zögerten kurz, ehe wir näher traten.
»Das ist der Feldherr eures Vaters, der ihm treu ergeben blieb in der Zeit des Exils«, stellte Ganymedes uns den Fremden vor. »Er hat die zahmen Löwinnen für die Göttin mitgebracht.«
Der Mann roch nach Schweiß. Ich erinnere mich daran, daß er nach Schweiß roch. Neben ihm stand eine Frau mit dem krausen Haar einer Nubierin und noch dunklerer Haut. Sie lachte ein kupfernes Lachen und lächelte mir und Arsinoë zu.
»Achillas, du Löwe von Ägypten. Wo hast du dich so lange versteckt gehalten?« fragte Ganymedes.
»Da, wo sich die Löwen versteckt halten, in der Wüste«, sagte Achillas.
»Das war sehr klug von dir«, sagte Ganymedes.
Achillas trat auf uns zu. Er nahm Arsinoë in die Arme, hob sie hoch und küßte sie. Er stellte sie wieder auf den Boden, warf sich vor ihr nieder und küßte ihre Kinderfüße. Sie kicherte verlegen.
»Du wirst Königin sein«, sagte Achillas.
»Du verwechselst sie mit ihrer Schwester Kleopatra. Sie ist die jüngere Tochter unseres Königs, die Tochter Nysas, die Enkelin des großen Mithradates. Sie heißt Arsinoë.«
»Ich erinnere mich an den Tag ihrer Geburt. Auch auf sie habe ich einen Treueeid schwören müssen. König Ptolemaios Auletes wollte es so. Ich werde ihn halten. Sie ist unglaublich schön geworden, diese Tochter Nysas. Sie wird sich in acht nehmen müssen vor Kleopatra. Es wird Männer geben, die sich nach ihr verzehren werden. Bei allen Göttern Ägyptens«, sagte Achillas. »Ich habe jahrelang auf diesen Tag gewartet. Jetzt werde ich zu meinem König gehen und ihn begrüßen.«
»Tu das«, sagte Ganymedes. »Du wirst sein erster Feldherr sein.«
»Sie ist ein Kind«, sagte Achillas. »Aber sie ist schon jetzt von berückender Schönheit. Wie soll das gutgehen?«
»Es ist ihr Schicksal«, sagte Ganymedes. »Sie wurde so geboren. Die Götter gaben ihr diesen Körper.«
»Ja, ich kann es bezeugen. Schon als neugeborenes Kind besaß sie diese Anmut«, sagte Achillas. »Männer werden ihretwegen den Verstand verlieren.« Er schwieg, dann setzte er erneut an: »Sie ist so schön wie ihre ältere Schwester häßlich ist.«
»Das ist das Schicksal Ägyptens«, sagte Ganymedes.
Der Truppenführer Achillas war an diesem Tag aus seinem Versteck in der libyschen Wüste zurückgekehrt, um seinem König Auletes zu dienen. Achillas stammte in direkter Linie von dem ägyptischen König Nektannebos ab. Die Frau an seiner Seite war seine Halbschwester Akra. Er hatte sich an den Eid gehalten, den er Ptolemaios Auletes geschworen hatte. Als Auletes ins Exil gegangen war, war Achillas nicht auf die Seite der neuen Herrscherinnen getreten, sondern hatte es vorgezogen, für ungewisse Zeit ins Exil in die Wüste zu gehen.
Es gab nicht viele Männer, die so waren wie Achillas, so entschlossen, so kühn, so verrückt. Achillas war unter dem griechischen Namen bekannt, den ihm seine Eltern gegeben hatten. Er führte jedoch noch einen anderen, wovon nur wenige Menschen wußten, einen ägyptischen Namen, den des einstigen Königs Nektannebos. Achillas war stolz darauf, dieser Mann Achillas Nektannebos mit dunkler Haut zu sein, Grieche, Ägypter, Afrikaner. Arsinoë mit ihrer weißen Haut und den grünen Augen war die Tochter eines syrisch – griechischen Vaters und einer Mutter asiatischer Herkunft. In der Hafenstadt Alexandria lebten fast nur solche Menschen aus unklaren gemischten Verhältnissen, keine richtigen Griechen mehr, keine richtigen Afrikaner, fragwürdige Ägypter, Juden, die sich mit einheimischen Frauen verheiratet hatten, Syrer, die kein Aramäisch mehr, Perser, die kein Persisch mehr sprachen.
»Und diese da?« Achillas deutete auf mich.
»Vergiß sie. Sie ist das Staubkorn. Das einzige Bastardkind unseres Königs«, erklärte Ganymedes.
Ich spürte Akras Blick auf mir. Wohlwollende Neugier und einen Hauch von Mitleid schien er mir zu enthalten.
Teil 1 »JEDE DEINER TÖCHTER WIRD KÖNIGIN SEIN«
Kapitel 1: Das Staubkorn
Ein helles Schmettern, das durchdringend helle Quieken einer Elefantenherde weckte mich heute morgen. Einen Moment lang empfand ich Glück und Freude darüber, in meinem Turmzimmer über der Hafenbucht von Alexandria zu erwachen und die Geräusche aus dem Tierpark zu hören.
Neben mir atmete Metellus gleichmäßig und zufrieden. Der römische Tribun Metellus gehörte nicht in das Turmzimmer. Plötzlich wußte ich es wieder. Ich lebte jetzt an einer anderen Bucht, am Strand nicht weit von einem römischen Städtchen, hier in Spanien, und es gab keine Elefanten mehr.
Das Quieken setzte sich fort. Ich sprang auf, stolperte über meinen tauben Zeh, fing mich wieder und trat ans dunkle Holzgitter des Fensters. Ich zog die gelben Vorhänge auf. Etwa ein Dutzend Elefanten, jüngere und ältere, afrikanische und indische, zogen gemächlich die Straße zum Municipium entlang. Ein indischer Elefantentreiber saß auf dem breiten Kopf des vordersten Tiers. Römische Soldaten folgten am Rand des Zuges.
Elefanten waren bei allen großen Ereignissen meines Lebens aufgetaucht. Kesa oder Zesa ist das afrikanische Wort für Elefant, und so hießen diese königlichen Tiere bei uns. Sie trugen die Bahre mit der Leiche meines Vaters. Hundert Elefanten aus der königlichen Zucht führten später Arsinoës und Achillas’ Hochzeitszug an. Die gleichen Tiere begleiteten wenige Jahre später den Triumphzug, in dem der göttliche Caesar uns durch Rom gehen ließ. Caesar nämlich hatte die Elefantenherde der Ptolemäerkönige nach Rom bringen lassen und weder Kosten noch Aufwand dafür gescheut. Nicht alle der empfindlichen Dickhäuter hatten die lange Seereise von Alexandria nach Ostia überstanden.
Bis zu hundert Jahre alt kann ein Elefant werden. Ich betrachtete die Tiere, während sie mit tänzelnden Fußbewegungen ihre schweren Körper bewegten, und dachte, daß sie vielleicht alte Bekannte aus Alexandria waren, deren Namen ich längst vergessen hatte. Nur einen wußte ich noch. Kylas, den unseres einstigen Leitelefanten. Ich rief. Ein alter grauer Koloß in der Mitte des Zugs blieb stehen und trompetete mir zu. Ich senkte den Kopf. Er trottete weiter. Es war vielleicht nur ein Zufall.
Die Elefanten im Tierpark von Alexandria waren ausgewählt worden wegen ihrer Gelehrigkeit. Man konnte sie auch für militärische Einsätze gebrauchen. Bei allen festlichen Ereignissen im Königshaus wurden sie eingesetzt. Kylas war der Liebling von uns Kindern. Die beiden Maios pflegten auf ihm zu reiten unter der Aufsicht des indischen Wärters und den wachsamen Augen des Eunuchen Potheinos, der für den großen Maio zuständig war. Der große Maio bat manchmal darum, daß ich zu ihm hinaufgehoben wurde. Aus irgendeinem Grund hatte er schon als Junge eine Zuneigung zu mir gefaßt. Dabei war er der ausersehene Thronfolger, der, so war es bestimmt, unsere älteste Schwester Kleopatra heiraten würde, sobald er dafür alt genug wäre. Ich hatte Angst, auf dem Rücken des Elefanten zu sitzen. Ich umklammerte Maios schlanken braunen Rücken und drückte mein Gesicht zwischen seine Schulterblätter. Er war ein Gott und ich ein Staubkorn.
Ich werde noch einmal in meine Stadt zurückkehren, nach Alexandria. Einmal noch möchte ich den Pharos, das Museion und den Königspalast sehen, die zwei Libanonzedern vor meinem vergitterten Fenster. Ich möchte die Treppe des Turms hochsteigen und Arsinoës Gemächer betreten. Auf ihrem Bett liegt das bis zu den Knöcheln reichende Gewand aus hauchdünner Seide mit den eingewebten blauen, roten und gelben Längsstreifen auf gebrochenem Weiß, das ich mir manchmal überzog. Wir tauschten ab und zu zum Spaß unsere Kleider. Das mit den farbigen Streifen trug sie als fünfzehnjähriges Mädchen, als sie heimlich den Palast verließ. Ich sehe sie vor mir, zartgliedrig, schlank, helle, fast blasse Haut, das ebenmäßige Gesicht mit den großen grünlichen Augen eingerahmt von welligen Haarflechten. Sie war immer selbstbewußter und klüger als ich, manchmal eine Spur hochnäsig, aber auch immer wieder voller Mitgefühl und Zärtlichkeit für Mensch und Tier. Schon als kleines Kind war sie daran gewöhnt, sich zu beherrschen, Haltung zu bewahren, aber dann konnte sie wieder überschwenglich und großzügig sein, die künftige Königin. Arsinoë war die geborene Königin. Sie erfüllte jede Voraussetzung, um über Ägypten oder ein anderes Land zu herrschen. Sie war das nächste nach Kleopatra geborene Kind unseres Vaters, etwas älter als Ptolemaios und paßte insofern viel besser zu ihm als die acht Jahre ältere Kleopatra, die zudem von einer anderen Mutter abstammte.
Ich möchte mit nackten Füßen am Meer entlanglaufen und die Namen Ptolemaios und Arsinoë in den Sand schreiben. Ich werde sie erst in griechischen Buchstaben schreiben und dann dahinter die ägyptischen Königskartuschen der beiden Namen zeichnen.
Keine Stadt der Welt kann sich mit Alexandria messen. Die vorgelagerte Insel Pharos mit dem größten Leuchtturm der Welt ist mit der Altstadt durch einen Damm verbunden. Dieser Damm verbindet zwei Kalksteinrücken, die parallel zur Küste verlaufen. Das innere Riff schützt Alexandria vor dem sich ausdehnenden Schwemmland Ägyptens, das äußere bricht die Wellen und bildet die Hafenmole der Stadt. Tief in der Stadt, in ihrem Herzen, unter der Erde liegt der große Alexander begraben in seinem gläsernen Sarg. Nicht weit von dort beging Kleopatra Selbstmord. Oh, Alexandria, einzige Stadt, mit dem Tanggeruch und dem Meerwasserduft, mit der ewigen Brise, die von Norden her Kühlung bringt. Die Fassaden der Häuser in Alexandria sind braun und mit einer Salzschicht aus der salzhaltigen Meerluft überkrustet.
Ich bin Baryllis, die jüngste Tochter des Königs Ptolemaios Auletes, sein einziges Bastardkind. Auletes, der selbst als illegitimes Kind geboren war, hatte die Angewohnheit, seine Bastardkinder gleich nach der Geburt zu töten. Dies war politisch dringend geboten, da illegitime Söhne in jedem Fall das Leben seiner legitimen Kinder bedroht hätten. Auletes war ein weiser Mann, der seit seinen Jugendjahren um den Thron Ägyptens hatte kämpfen müssen. Wie seine lüsternen Vorväter liebte er die Frauen. Doch als er älter wurde, beschränkte er seine körperliche Leidenschaft auf Eunuchenknaben. Es war die sicherste Methode, unerwünschte Nachkommen zu verhindern.
Ich hatte also das besondere Glück, von einem königlichen Vater abzustammen und von ihm nach der Geburt ausdrücklich zum Leben bestimmt zu werden. Er vertraute mir vom ersten Augenblick meines Lebens, das muß es gewesen sein.
Meine Vorfahren kamen aus den verschiedensten Ländern, aus Griechenland, aus dem steinigen Syrien und dem fruchtbaren Ägypten. Den Männern und Frauen, die sich in Liebe und Brunst vereinigten, damit eines fernen Tages ich, ein zartes Wesen mit dunkelgoldener Haut, geboren würde, war nur eines gemeinsam. Sie liebten die Schrift und das Wort. Sie schrieben Bücher und Denkschriften, komponierten Lieder und Gesänge oder handelten mit Schriftrollen aus ägyptischem Papyrus und fleckiger Ziegenhaut.
Vieles, was ich getan und gelassen habe, würden sie nicht billigen, hätten sie je davon erfahren. Aber ich bin mir gewiß, sie würden lächelnd zustimmen, daß ich hier in diesem kühlen Zimmer vor einem Holztisch sitze wie einer von den bezahlten Schreibern am Markt der großen Städte und die Geschichte meines Lebens zögernd niederschreibe.
Ich zögere, denn entscheidende Dinge sind unklar geworden, als hätte der Wind feinsten gelben Sand über sie hinweggetrieben. Sand, so tödlich wie das Wasser, in dem Menschen ertrunken sind. Ich zögere auch, weil es anstrengend und schmerzlich ist, diese vergangenen Dinge von Sandschichten zu befreien. Ich zögere, weil ich alt und manchmal müde bin und auch das, was mein Herz damals für richtig hielt, sich gewandelt hat.
Mein Gang ist unsicher geworden, bei längeren Gängen benutze ich einen Stock aus Ebenholz. Meine Augen haben ihre einstige Schärfe verloren. Heute bin ich, was ich in den stolzen Tagen meiner jugendlichen Schönheit, meiner erhabenen Herkunft, in der Zeit des äußersten Reichtums, damals in meiner Heimat, im üppigen fruchttragenden Ägypten nicht war. Ich bin ruhig und zufrieden. Meine Augen lächeln, mein Körper lächelt. Meine Ohren freuen sich. Dort drüben, nicht mehr weit entfernt, dort am Tor, steht Anubis, der hundeköpfige Gott, er wartet. Bald bin ich bereit, mein Freund. Ich werde mit dir gehen. Warte ein bißchen, solange, bis die Kammerfrauen mir das Haar gerichtet haben. Ich will noch ein Bad nehmen und das große Fest feiern, wie es sich gehört.
Ich bin Baryllis, Tochter des Königs Ptolemaios Auletes und der ägyptischen Schreibsklavin Kipa. Ich hatte eine Puppe aus Goldblech und eine zahme Spielschlange mit einem smaragdverzierten Kettchen. Aufgezogen wurde ich nach dem Verschwinden meiner Mutter in den Palästen und Villen, die mein Vater in der Hauptstadt und den Stationen unseres Exils bewohnte, gemeinsam mit Arsinoë, der älteren Halbschwester, die ich gern hatte, mit unserer großen Schwester Kleopatra, die ich als Kind haßte und, als ich älter wurde, fürchtete wie keinen Menschen sonst auf der Welt. Kleopatra war zur Königin geboren. Unser Vater Auletes liebte sie, mehr noch als seine letzte Frau Nysa, die zugleich seine erste gewesen war. Kleopatra war ihm am ähnlichsten. Sie besaß seine Intelligenz, seine Sprachbegabung, sein Verhandlungsgeschick und sein Gesicht mit den verkniffenen, kleinteiligen Zügen. Sie hatte die gleichen kleinen Hände und das melodiöse Timbre beim Sprechen, mit dem man Menschen gewinnt.
Ich sehe auch sie wieder vor mir, die gerade erwachsene junge Frau am Tag nach der Leichenfeier unseres Vaters. Zum Tag ihres Regierungsantrittes hatte sie sich Perlen in ihr dunkles Haar flechten lassen. Das weiße griechische Diadem war um ihre Stirn und die Schläfen gebunden und gab ihr ein strenges, ehrfurchtgebietendes Aussehen. Sie trug die purpurne Chlamys, den Mantel der makedonischen Könige, über der Brust mit einer goldenen Brosche zusammengehalten. Mit gefalteten Händen knieten wir vor ihr nieder, Ganymedes, Arsinoë und ich. Ptolemaios schritt hinter ihr, ein selbstbewußter Neunjähriger, ebenfalls mit dem Diadem, das seinen Lockenschopf zusammenhielt, der roten Chlamys und makedonischen goldenen Stiefeln bekleidet. Nachdem sie die Huldigungen der engsten Familie entgegengenommen hatten, gingen sie gemessenen Schrittes in die Audienzhalle, um die Antrittshuldigungen der Hofbeamten, der Vertreter der Stadt und der ägyptischen Gaue und der Gesandten der fremden Staaten entgegenzunehmen. Jeder, der sie sah, wußte, daß die beiden neuen Könige, sie und er, Feinde waren und daß sie Ägypten nicht auf Dauer in Eintracht miteinander regieren würden. Während sie auf dem Doppelthron nebeneinander Platz nahmen, verlas der oberste Minister des Landes, der Eunuch Potheinos, ihre neuen Titel: Theoi neoi Philopatores Philadelphoi. Die neuen Götter, vaterliebend, geschwisterliebend ...
Schon ihr Alter trennte die neuen Herrscher voneinander. Arsinoë und ich waren dagegen mit unseren Brüdern, dem älteren Ptolemaios und dem jüngeren Ptolemaios, ständig zusammengewesen. Sie neckten und kitzelten mich. Der große Ptolemaios, den wir nur Maio nannten, nahm mich in Schutz, wenn Kleopatra und der kleine Maio es wieder einmal zu schlimm mit mir getrieben hatten. Ich sehe sein ernsthaftes Kindergesicht vor mir, als er mir Sand und Tränen mit einem purpurnen Tuch aus dem verheulten Gesicht rieb. Auch der große Maio hatte eine starke äußere Ähnlichkeit mit seinem Vater. Den Lockenkopf und die Hakennase hatte er von ihm. Die grünlichen Augen aber waren die Nysas und Arsinoës. Er hatte auch die Großzügigkeit seiner Mutter Nysa geerbt. Er war verträumt und verspielt. Er sang gerne die neuesten Lieder, dachte sich Spottverse auf unsere Lehrer und seinen Oberaufseher Potheinos aus und dichtete selbst kleine Gedichte in der Art des Kallimachos.
»Sie dürfen dich nicht so behandeln«, sagte er. »Ich werde befehlen, daß sie dich nicht mehr im Sand eingraben dürfen.«
Ich schwieg.
»Ich werde es befehlen«, wiederholte er. Tatsache ist, sie versuchten nie wieder, mich im Sand einzugraben.
Der große Maio gehörte zu den guten Dingen in meinem Leben. An ihn zu denken, war das Beste, war Trost, wenn ich ganz traurig war. Zugleich war mir bewußt, daß diese heimlichen Gedanken an den großen Maio etwas Verbotenes und Gefährliches waren. Sie waren die ersten Gedanken, die ich Arsinoë verschwieg, die sonst alles von mir erfuhr.
Wir, die fünf Kinder des Auletes, hatten zusammen Unterricht. Ich war das Ergebnis dieser bedeutungslosen Liebschaft meines Vaters mit dem Schreibmädchen Kipa aus Nysas Kanzlei. Die anderen vier entstammten dem Schoß legitimer Mütter. Arsinoë und die beiden Maios waren Kinder der pontischen Prinzessin Nysa. Der Vorname und ihr Geburtsdatum bedeuteten für Arsinoë, daß sie nicht die erstrangige Tochter war. So wie Kleopatra dem erstgeborenen Ptolemaios als Mitkönigin und zukünftige Ehefrau zugeordnet war, so ordnete Auletes Arsinoë und den kleinen Ptolemaios einander zu. Wie im einzelnen er sich ihre Zukunft vorstellte, sprach er nicht aus. Vermutlich dachte er sich Arsinoë und ihren jüngsten Bruder als Ersatzkönige, falls den Großen etwas zustoßen sollte, oder als Unterkönige in einem noch zu gründenden Großreich Ägypten.
Arsinoë, sechs Jahre nach Kleopatra geboren und zwei Jahre vor dem großen Maio, hatte nicht den Ehrgeiz ihrer älteren Schwester und auch nicht den ihres Vaters. Mit ihren grünlichbraunen Augen und den Locken zog sie die Blicke auf sich. Sie war ein liebenswürdiges, freundliches Kind, voller Mitgefühl, wenn Ganymedes’ Katze Saitis krank war. Sie hatte nicht die Selbstsicherheit Kleopatras. Sie fürchtete sich vor Skorpionen und Spinnen und vor Geistern. Im Gegensatz zu Kleopatra liebte sie das Meer und fuhr gerne auf Schiffen, während die ansonsten furchtlose Kleopatra schon seekrank war, wenn sie nur den Fuß auf ein Schiff setzte. Ganymedes witzelte, daran könne man sehen, daß Arsinoë eigentlich eine Griechin sei und Kleopatra eine Ägypterin. Die Griechen hatten immer ein besonderes Verhältnis zum Meer.
Kleopatra war die Tochter einer vornehmen Ägypterin namens Tebenefer aus dem Priestergeschlecht von Memphis, die Auletes auf dem Höhepunkt eines Aufstands der Ägypter gegen sein Regime geheiratet hatte. Dies war seine zweite offizielle Ehe gewesen. Die erste war die Zwangsehe mit der Halbschwester Kleopatra Tryphaina gewesen. Zuletzt heiratete er endlich Nysa, mit der er schon in jungen Jahren verlobt worden war.
Von den Königen, die damals in den Ländern um das Mittelmeer herrschten, waren die Ptolemäer in Ägypten die klügsten und die wißbegierigsten. Dies ist eine allgemein bekannte Tatsache. Sie hatten nicht zufällig das Museion und die Bibliothek gegründet. Das Museion und die Bibliothek mit ihren Hunderttausenden von Bücherrollen gehörten zum Palast. Nur einigen wenigen zugänglich war die Geheimsammlung im innersten Raum des Museions. Es gab dort steinerne Abdrücke von Fischen und Muscheln aus den Steinbrüchen von Syrakus in Sizilien und aus dem Inneren der Wüste.
Ich selbst durfte sie mit meinen Geschwistern sehen. Ganymedes zeigte sie uns. Er zeigte uns auch die gewaltigen Knochen eines Ungeheuers, das ebenfalls tief in der Wüste aufgefunden worden war.
»Nichts ist unter der Sonne unmöglich«, war der Satz, den er zu uns sagte. »Sprecht zu niemandem über das, was ihr gesehen habt. Es ist das Geheimwissen der Könige dieses Landes.«
Während wir schwiegen, ergriffen und fassungslos über das, was uns vor Augen gebracht worden war, faßte Kleopatra es in Worte. Sie sprach kühl und sachlich.
»Da, wo heute Land ist, war schon einmal Meer. Das ist das eine. Und irgendwo auf der Erde gibt es Ungeheuer mit riesigen Knochen.«
»Der König läßt sie im Inneren Afrikas suchen«, sagte Ganymedes. »Er wird sie finden und in künftigen Kriegen einsetzen, so wie der große Alexander die Elefanten Indiens für den Krieg benutzt hat.«
Solche Macht besaß unser Vater. Solche Macht lag in Afrika. Kein Land der Erde besaß diese Reichtümer. Da war das Gold, da waren die Riesentiere, die uns zur Verfügung standen. Wir fühlten uns wie Verschwörer. Wir waren eingeweiht worden in das tiefste Wissen des ägyptischen Reiches, zu dem außer uns und einigen Gelehrten nur Könige und Priester Zugang hatten.
Der Leiter des Museions stand zahlreichen Gelehrten vor, die auf Kosten der Könige ein üppiges Leben führen konnten und für ihre Forschungen zur Medizin, zur Mathematik und den Sprachwissenschaften jede nur denkbare finanzielle Unterstützung erhielten. Das Land war reich. Seine Könige und Priester hatten seit Jahrtausenden schon auf der Seite der Wissenschaft, der Forschung und der verfeinerten Lebenskunst gestanden. Einige von ihnen hatten Gedichte geschrieben, andere umfangreiche Geschichtswerke. Ausnahmslos liebten sie geistreiche Wortspiele und witzige Unterhaltungen. Mein Vater war außerdem musikalisch. Er blies den Doppelaulos wie die besten Musiker seiner Zeit. Deswegen hatten ihm die Alexandriner den Spitznamen Auletes, »der Flötenbläser«, verpaßt.
Von ihrer frühen Kindheit an war Kleopatra mehr als die anderen Geschwister auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorbereitet worden. Sie war zwar nicht das älteste Kind unseres Vaters, aber das älteste von denen, die er anerkannte. Die älteste war die aufständische Berenike, die mit ihrer Mutter, Auletes’ Schwestergattin, das Unglück über ihn und uns gebracht hatte. Es gab schließlich diese einstimmigen, unzweifelhaften Prophezeiungen über Kleopatras Zukunft, auf die mein Vater vertraute. Es gab noch eine weitere, dunklere Auskunft einer griechischen Wahrsagerin aus dem ersten Regierungsjahr meines Vaters, die schriftlich niedergelegt und versiegelt worden war und vermutlich noch heutigentages irgendwo im Archiv des Museions in Alexandria schlummert: »Alle deine Töchter werden Basilissa. Alle deine Söhne werden gewaltsam sterben. Alle bis auf den einen, der kein Mann ist.«
Es war leicht zu sehen, daß diese Prophezeiung kein Glück verhieß, nicht einmal in bezug auf die Töchter.
Zehn Jahre nach seinem Regierungsantritt war es Auletes endlich gelungen, die Schwesterkönigin zu vertreiben. Mit ihr war auch die älteste Tochter Berenike in Ungnade gefallen. Mein Vater hatte eine besondere Abneigung gegen dieses ihm abgezwungene Kind. Immerhin ließ er seine Schwester nicht töten. Er war erst dreißig Jahre alt, und er hielt sich für unersetzbar. Auletes besaß noch nicht die Härte, mit der er ein paar Jahre später um seinen Thron kämpfen würde. Über das heranwachsende Mädchen Berenike dachte er nicht weiter nach. Wahrscheinlich nahm er sich vor, sie dann, wenn es soweit war, mit einem seiner Feldherren zu verheiraten. Damit war der Feldherr mit der königlichen Familie verbunden, Berenike aber für immer oder zumindest fürs erste in die dynastische Bedeutungslosigkeit geschoben.
Tochter und Mutter bewohnten einen kleinen Palast an einer der Wasserstellen in der westlichen Wüste, irgendwo zwischen Alexandria und der Oase Siwa, weitab genug, wie mein Vater fand. Viel zu nahe allerdings, wie die Zukunft zeigen sollte.
Kleopatra Tryphaina war zäh und geduldig. In Alexandria schätzte man sie und das Kind, das in der Stadt geboren war. Auletes’ göttliche Schwester wartete lange genug, aber auch wiederum nicht zu lange, auf den Tag, den sie jahrelang vorbereitet hatte. Mit einem gewissen Dion, den sie schon in ihrer Kindheit gekannt hatte, einem der Stadträte, zugleich ein angesehener Rhetorikprofessor, hatte sie lange Zeit ständig Briefe gewechselt.
Dieser Dion war in gewisser Weise von Anfang an Auletes’ persönlicher Feind gewesen. Er stammte aus einer alteingesessenen griechischen Familie, war von athletischem Körperbau und hatte melancholische, nachtdunkle Augen unter schweren Lidern. Er war ein glänzender Redner mit vielen Freunden unter den Reichen und Mächtigen. Wenn er sich auch als Hellene fühlte und gab, so unterhielt er auch Kontakte zu einigen handverlesenen einheimischen Intellektuellen und Priestern. Bis nach Memphis reichten seine Beziehungen. Dion vertrat eigenartige Ansichten über Demokratie nach griechischem Vorbild in der Stadt Alexandria. Und es war ausgerechnet Dion, der Philosoph, Gymnasiarch und elegante Liebhaber der Frauen aus den ersten Kreisen der Hauptstadt, zu dem Auletes’ zweite offizielle Frau, die schöne Tebenefer, in jener Unglücksnacht aus dem Palast geflohen und bei dem sie geblieben war. Nach Memphis, der Stadt ihres Priestervaters, zu flüchten, war ihr nicht möglich gewesen. Außerdem wollte sie nicht den Zorn des Königsgemahls auf ihre Familie ziehen. Es war einfacher, das Unerwartete zu tun und im Haus des Gymnasiarchen Zuflucht zu suchen. Am folgenden Tag hielt jedenfalls Dion die flammende Rede, nach der Auletes in einem Teigtrog verborgen aus der Stadt hatte flüchten müssen.
Tebenefer hatte ihre Tochter Kleopatra im ins Meer hinausgebauten Palast zurückgelassen, was naheliegend war, da das kleine Ding mit abgöttischer Liebe an seinem Vater hing. »Kleopatra« bedeutet »Ruhm des Vaters«, und genauso fühlte sie sich. Sie hatte die verkniffenen Gesichtszüge unseres Vaters und seine spitze Nase, war aber ägyptischer Abstammung und trug somit zum Frieden mit der einheimischen Bevölkerung bei. Ägypten hatte in der kleinen Kleopatra die erste makedonisch – ägyptische Ptolemäerprinzessin. Kleopatra war beides, Alexandria und Memphis, die neue und die alte Hauptstadt des Landes. Dieses Kind hielt von der Stunde seiner Geburt an die beiden Länder in der Hand. Wichtigtuerisch und in seltener Klarheit verkündeten die Astrologen, das Schicksal des kleinen Mädchens sei, eine große Herrscherin über ein großes Reich zu werden. Bessere Vorzeichen waren über Jahrhunderte bei keiner Geburt im ägyptischen Königshaus erkannt worden. Glücklichere Aussichten hatten nie bestanden. Mein Vater war ein paar Tage lang hocherfreut, wenn es auch ein Schönheitsfehler sein mochte, daß dieses Kind ein Mädchen war. Sie war jedenfalls von allen Göttern und Gottheiten zur Herrscherin bestimmt. Auletes glaubte es bis in die Tiefen seiner Seele.
Jahre später im Exil, vertrieben von der erstgeborenen Berenike und der ersten Frau unseres Vaters, lernte Tebenefers Tochter, dieses blitzgescheite, schlagfertige kleine Mädchen mit dem ehrwürdigen Königinnennamen Kleopatra, die Sprachen der afrikanischen Welt, obwohl nicht mehr viel dafür sprach, daß sie jemals in Ägypten herrschen würde. Die Astrologen und Wahrsager von einst waren auf den höchsten Befehl der neuen Herrscherinnen in Alexandria unverzüglich in die Schlangengruben geworfen worden. Somit waren Auletes und Kleopatra mit ihrem engsten Kreis, allen voran der Eunuch Uriasippa, vermutlich die einzigen, die damals noch daran glaubten. Auletes, vom Asthma geplagt, ein vertriebener König, träumte von einem Großreich Ägypten, vereinigt mit den reichen Ländern des tiefen Afrikas, einem Reich, das so noch nie bestanden hatte. Er und seine Kinder würden es beherrschen. Großägypten würde so mächtig sein wie das Imperium Romanum. Je länger unser Exil andauerte, desto kühner wurden die Träume unseres Vaters. Wenn er nicht völlig betrunken war, schwadronierte er vor den Eunuchen Potheinos und Ganymedes von diesem zukünftigen Königreich. Der Tag würde kommen, an dem Ägypten nicht mehr vor Roms Ansprüchen zu zittern brauchte. Wenn Auletes die Doppelflöte blies, sang Ganymedes das Lied vom großen Ägypten, das seine Feinde bezwingen würde. Aneinandergekauert hörten wir zu. Kleopatra etwas abseits, Arsinoë und ich wie Zwillingsschwestern aneinandergeschmiegt. Der kleine und der große Maio. Der große Maio und ich wechselten keinen Blick miteinander. Nur dann, wenn niemand dabei war, streichelte er meine Hand oder meinen Rücken. Es gab dieses geheime Einverständnis zwischen uns, von dem wir trotz unseres kindlichen Alters schon wußten, daß es Gefahr brächte, sobald Dritte unsere Komplizenschaft erkannt hätten.
Vielleicht messe ich diesem besonderen Einverständnis zwischen mir und dem großen Bruder zu große Bedeutung bei. Es gab andere Beziehungen und Querverbindungen in unserer Kernfamilie, die wichtiger waren als die unsere.
Da war Nysa. Nysa war immer dabei. Stets im Hintergrund, halbverschleiert, mit wachem Blick. Sie liebte taubengraue seidene Gewänder. Nysa war wie das Salz im Brot, wie die Säure im Wein. Hat sie jemals in meiner Gegenwart gesprochen? Es muß so gewesen sein. Doch ich erinnere mich an kein Wort, keinen Satz aus ihrem Mund. Selbst ihre Stimme ist in mir vollständig ausgelöscht.
Auch sie sprach dem Wein zu und suchte die Ekstase im Rausch des Dionysos. Sie tanzte am Ende des abendlichen Trinkgelages mit Ganymedes und den Hofdamen, wenn Auletes den Doppelaulos blies. Ihr Tanz war völlig leidenschaftslos, inmitten der bacchantischen Schreie, der Entrückung der anderen, die stampfend und johlend den Thiasos tanzten und in Orgiasmos verfielen. Unsere Erzieher durften uns, die wir ihnen anvertraut waren, niemals aus den Augen lassen. Deshalb waren wir Kinder auch bei den abendlichen Gelagen fast immer dabei. Zusammengekauert hockten wir dann zu dritt oder zu viert auf einem Ruhebett mit unseren Spielschlangen und dem Spielaffen, Kleopatra, Arsinoë und ich, und später auch der große Maio. Da wir zu jung waren, um schon eingeweiht und Mysten des Gottes zu sein, nahmen wir am Thiasos, dem Umzug durch den großen Saal und den nächtlichen Park, nicht teil. Wir hörten nur die Schreie von draußen, die immer spitzer, immer ekstatischer wurden. Der eigenartige Seufzer Nysas, der irgendwann abschließend folgte, ist mir noch in Erinnerung. Still hörten wir zu und schliefen irgendwann ein, nachdem auch die Erwachsenen auf dem Mosaikboden oder in den Außenlauben eingeschlafen waren. Sklaven trugen uns und sie dann in die Schlafzimmer, wo wir spät am nächsten Morgen wach wurden.
Nysa und Kleopatra. Eine Spannung lag im Raum, wenn die beiden aufeinandertrafen. Sie gingen sich aus dem Weg, so gut es eben möglich war. Sie führten manchmal sachliche Gespräche miteinander über ein Thema. Über indische und afrikanische Elefanten. Ich höre noch Kleopatras Stimme, die die Klugheit und Gelehrigkeit der afrikanischen Elefanten verteidigte. Nysas Stimme ist jedoch wie ausgeblendet.
Tatsache ist, Kleopatra wagte nicht, gegenüber Nysa aufzutrumpfen. Kleopatra unterwarf sich Nysa und dem, was sie anordnete. Nysa wiederum ließ keinerlei Ressentiment gegenüber der älteren Halbschwester ihrer Kinder erkennen. Sie akzeptierte sie als zukünftige Schwiegertochter. Ich erinnere mich an eine wortlose Geste. Kleopatra ging barfuß über den gräserbedeckten Boden im kleinen Privatzoo, wir alle sahen, wie eine Schlange emporzüngelte. Ehe noch einer der Diener eingreifen konnte, hatte Nysa schon Kleopatras Arm gepackt und sie aus der Gefahrenzone gezerrt. Es war eine harmlose Spielschlange, wie sich schnell herausstellte, doch Nysas entschiedener Griff nach Kleopatras Arm war ein Beschützerverhalten gewesen, ein Bekenntnis zu dieser ältesten Tochter ihres Mannes, das viele von uns nicht erwartet hatten. Die Gesetze des Hofes waren andere, aber Nysa stand gleichsam über ihnen. Sie tat unerwartete Dinge, die sie vielleicht von den Philosophenfreunden gelernt hatte, mit denen sie sich umgab.
Arsinoë und Kleopatra. Arsinoë war ein auffallend hübsches Kind mit dunklen Locken und grünlichen Augen. Sie fiel besonders auf, wenn sie neben ihrer älteren Halbschwester stand. Kleopatra hatte die gewaltige Hakennase unseres Vaters mitbekommen. Wer sie sah, begriff sofort, daß sie seine Tochter war. Alle Augen glitten unwillkürlich auf den Liebreiz der kleineren. Arsinoë hatte überdies die melodische Stimme mit Kleopatra gemeinsam. Sie sprach nicht viel, weil sie ein vorsichtiges Kind war, aber wenn sie den Mund einmal aufmachte, waren alle bezaubert. Der Gegensatz zwischen den Schwestern wurde immer deutlicher, je älter wir wurden.
Pompeius, unser Patron, unser Gastgeber, machte irgendeine liebenswürdige Bemerkung über Arsinoës Schönheit. Selbst der ernste Cato, damals in Rhodos, erlaubte sich den kleinen Witz: »Paß auf, Kleopatra, Arsinoë wird dir die Männer wegnehmen.« Das war römische Taktlosigkeit, die Instinktlosigkeit unserer schlecht erzogenen Sieger. Kein Sterblicher in Ägypten hätte gewagt, so in Anwesenheit von Kleopatra zu sprechen. Die römischen Männer begriffen nicht, was eine Königin in Ägypten bedeutete. Kleopatra sagte auf aramäisch zu Auletes: »Wir sollten ihn foltern lassen.« Cato verstand kein Aramäisch.
Ich bin Baryllis. Wahrscheinlich hatte mein Vater auch mit mir einen Plan. Und vermutlich hatte er ihn mit Ganymedes besprochen. Mir war damals nicht bewußt, daß auch ich einer von den Spielsteinen meines Vaters war. Ich hielt mich daran fest, daß ich die Dienerin, das Staubkorn sei.
Jeder Mensch, hätte er auch sonst nichts auf der Welt, hat einen Namen und Eltern. Wenn ich allein bin, murmle ich es in ägyptischer, in griechischer und in aramäischer Sprache: Ich bin Baryllis.
Die Geschichte aber, die ich niederschreibe, ist hauptsächlich die meiner Schwester Arsinoë. Sie ist untrennbar verbunden mit der meiner erfolgreicheren Schwester Kleopatra, es ist damit auch die Geschichte von Caius Julius Caesar und Marcus Antonius. In einem weiteren Sinn ist es die Geschichte vieler Männer und vieler Frauen. Ich schreibe sie nieder für dich, Selene, für dich, Afrahat, und auch für die toten und verschollenen Kinder meiner Schwestern, also für Ptolemaios Caesarion mit Caesars Gang und Caesars Augen, für den krausköpfigen dunklen Sohn meiner Schwester Arsinoë und des Achillas, der vor meinen Augen aus dem Palast getragen wurde. Wenn ich es genauer bedenke, dann für ihn, den für immer in Alexandria Zurückgebliebenen, am meisten. Die früh verstorbenen Kinder meiner Familie wurden sonst in den Rang von Göttern erhoben, und unsere Astronomen benannten einen Stern nach ihnen. Arsinoës Kind erhielt nicht einmal einen Namen.
Gabal kommt den Weg vom Municipium herunter zu unserem Haus. Er geht barfuß und trägt dieses einfache Gewand. Gabal ist der Sohn des Hofeunuchen Ganymedes, der sich mit seiner Frau Akra im Municipium niedergelassen hat. Er hat Gabal vor vielen Jahren noch in Ägypten adoptiert, ein dunkelhäutiges Mischlingskind, das irgendwer ausgesetzt hatte und das Ganymedes bei einem seiner Spaziergänge am Mareotis-See hinter einem Schilfbusch gefunden hatte. Die Götter hätten ihn damals auf diesen Weg geführt, den er sonst nie gegangen war, so beschrieb er es uns Jahre später, als er Arsinoë darum bat, dem Kind, das er an Sohnes statt angenommen hatte, auch den königlichen Namen Ptolemaios geben zu dürfen. Fortan hieß der Junge also Ptolemaios Gabal. Sein Vater Ganymedes platzte vor Stolz auf die außergewöhnliche Intelligenz des Kleinen, sein Sprachtalent, seinen Humor und seine Tanz- und Musikbegabung. Ich glaube, er verschwendete sein gesamtes Vermögen für die Erziehung Gabals. So verrückt sind wahrscheinlich nur Eunuchen, wenn sie auf ihre alten Tage noch eine Familie gründen.
Gabal litt unter der erdrückenden Zuneigung seines alten Vaters. Es wäre für jedes Kind zuviel gewesen, aber Gabal mit seinem hellen Geist, seiner Unternehmungslust, seinem verblüffenden Wagemut hielt es nicht mehr aus. Und eines Tages war er einfach verschwunden. Gabal war ungefähr achtzehn, es hatte eine Auseinandersetzung gegeben, weil er zu spät nach Hause gekommen war. Am anderen Tag ging er und kam nicht zurück. Ganymedes wurde fast wahnsinnig. Auch Akra litt, aber sie trug es bei weitem gefaßter. Ganymedes zerriß sich die Kleider, lag auf dem Boden seines Hauses und schlug schreiend den Kopf auf die Steinplatten. Akra berichtete es uns. In der ersten Zeit dachten alle an ein Verbrechen, dem Gabal zum Opfer gefallen war. Auf den Gedanken, daß er nur bis zum Hafen gegangen war und sich vom ersten Schiff, das nach Ägypten fuhr, hatte mitnehmen lassen, kam keiner von uns. Ungefähr ein Jahr später kam ein Bote und richtete Grüße von Gabal aus. Er befinde sich in Ägypten, um dort seine Studien fortzusetzen. Doch Gabal blieb nicht lange dort. Er reiste weiter bis nach Indien, wo er etwa zehn Jahre verbrachte. Eines Tages stand er, bärtig und mager geworden, wieder vor unserer Tür. Er gedenke jetzt, zu seinem Vater und seiner Mutter in das kleine Haus im Municipium zurückzukehren, hatte er verlegen gesagt.
Seit er zurückgekommen ist, trägt er dieses einfache Gewand aus rauher Ziegenwolle und betreibt seine Forschungen wie in alten Zeiten. Meine Tochter Selene macht ihm schöne Augen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gabal kommt oft zu mir und befragt mich für das Buch, das er schreiben will. Wenn ich ihn recht verstanden habe, soll es so eine Art Geschichte des Ptolemäerreiches werden.
Ich muß abbrechen, Gabal steht am Tor. Wir werden zusammen Pfefferminztee trinken, und ich werde versuchen, seine Fragen zu beantworten. Wenn er kommt, verschwendet er keinen Blick an meine arme liebe Selene, die den ganzen Vormittag auf ihn gewartet hat. Vielleicht ist er zu stolz, sich etwas anmerken zu lassen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hat sie auch gar nicht auf ihn gewartet. Ich bin ihre Mutter, was weiß ich schon von ihr.
Kapitel 2: Gabal
Ich werde Gabal immer um diese Eltern beneiden. Es gibt keinen geeigneteren Vater als Ganymedes und keine bessere Mutter als die dunkelhäutige Akra mit ihren Zauberkräften. Möglicherweise bin ich etwas eifersüchtig. Es war schließlich Ganymedes, der über Arsinoës und meine Kindheit wachte. Jeder Mensch hält seine eigene Kindheit für den Normalfall des Lebens. Unsere Kindheit wurde überragt von der Denkmalsgestalt des Eunuchen Ganymedes. Ganymedes, so empfanden wir es, war die Grundlage unseres Lebens, er war das Normale. Nysa, Arsinoës Mutter, war mit geheimnisvollen anderen Dingen befaßt und blieb im Hintergrund. Meine Mutter wiederum war verschwunden, vielleicht tot, vielleicht verbannt, niemand sprach mit mir über sie, und ich wagte nicht, nach ihr zu fragen. Ganymedes aber war immer um uns, seit ich denken kann. Er war für uns zuständig.
Er war sehr selbstbewußt und mit großer Macht ausgestattet. Formal gesehen war er unser Erzieher, zugleich aber hatte er den Rang eines Ministers in der Regierung unseres Vaters.
»Ich werde heute über Ganymedes sprechen«, schlug ich vor. »Du weißt nicht, wieviel er in meinem Leben bedeutet hat.«
Gabal sah mich höflich und fragend an.
Es ist immer wieder schwer, diese Vergangenheit in Worte zu fassen. Die Zeit der mächtigen Eunuchen der hellenistischen Königshöfe wird nicht wiederkommen, und ein junger Mann wie Gabal kann die Strukturen der Macht meines Vaters nicht recht begreifen. Das heutige Rom mit seinem matten Princeps ist nichts als ein schwacher Abglanz des Königtums der Ptolemäer.
Meine Gedanken wandern zurück in die Stadt am Meer. Es war kurz nachdem unser Vater seine zweite Regierungszeit in Alexandria angetreten hatte. Wir hatten jetzt das Alter, das Grab des göttlichen Alexander und die Sarkophage all unserer Ahnen namens Ptolemaios, Kleopatra und Arsinoë zu besichtigen. Es war Ganymedes, der uns zum ersten Mal in die Soma führte, die königliche Gruft. Wir stiegen eine marmorne Treppe hinunter, hinab in den tiefsten Kellerraum der Stadt, wie mir schien, in eine Kühle, die mir das Herz fast stehenbleiben ließ. Ich überlegte, ob ich es aushalten würde. Ich fürchtete mich vor den Geistern der Toten. Ganz besonders fürchtete ich die ruhelosen Geister all derjenigen Könige und Prinzessinnen, die im Palast von Alexandria ermordet worden waren.
»Ist er das?« fragte Arsinoë in die Stille.
Wir standen vor dem gläsernen Sarg, in dem König Alexander lag, der Gründer der Stadt. Er war sehr bleich. Spitz stand die Nase in seinem Gesicht. Ich gruselte mich vor der einbalsamierten, konservierten Leiche.
»Ohne ihn –«, flüsterte Arsinoë und brach ab.
»Ohne ihn stünden wir nicht hier. Er schuf die Voraussetzungen für die Könige, unsere Väter, die hier herrschten –«
Ich erinnere mich genau. Ganymedes sagte: Unsere Väter.
Mir war kalt. Ich war nicht gerne hier. Aber ich mußte es durchstehen. Ich mußte ihn ansehen, diesen fernen kalten Alexander in seinem goldbestickten königlichen Gewand. Von irgendwo, aus der Tiefe der Kellergruft, tropfte Wasser, unablässig.
Der große Maio stand neben mir. Ich spürte seinen Atem in meinem Haar. Ich genoß seine Nähe und war wieder fast versöhnt damit, hier in der Gruft zu stehen. Wir waren Kinder in dem Alter, in dem man alles wissen will, Kinder, die anfangen, den Geheimnissen der Erwachsenen nachzuspüren, Kinder kurz vor der unsichtbaren Schwelle. Kleopatra war an diesem Tag nicht dabei.
Ganymedes erklärte uns, warum der große Alexander die Stadt an dieser Stelle gegründet hatte. Ich hörte nicht zu. Ich wünschte, daß Maio mich anfassen sollte, daß er mir ein Zeichen gäbe.
»Er hatte mehrere Frauen«, sagte Maio hinter mir. »War es nicht so?«
»Ja«, sagte Ganymedes. »Da gab es diese Perserprinzessin namens Roxane. Mit ihr –«
»Seine letzte Frau hieß Baryllis«, unterbrach ihn Maio. »Als er starb und die makedonischen Soldaten noch einmal an ihm vorbeizogen, saß sie neben ihm.«
Maio erzählte manchmal verrückte Sachen, die er sich ausgedacht hatte, um Ganymedes unsicher zu machen. Aber diesmal widersprach Ganymedes ihm nicht. Maio sprach weiter. Ganymedes spielte mit Arsinoës Haarflechten und hörte ihm nicht zu.
Als wir wieder hochstiegen, stolperte ich. Es war Maio, Ptolemaios, der mich auffing. Einen Moment berührte sein Mund mein Haar, meine Stirn, und ich wußte, daß es für immer und ewig sein würde, daß wir unsterbliche Götter waren, füreinander geschaffen, daß wir auf der Treppe dieser Gruft zusammengehörten und oben im königlichen Palast und dann für alle Zeiten, die kommen würden, einbalsamiert in einem Sarkophag aus Stein nebeneinander, umschlungen liegen würden, all das wußte ich für den Bruchteil eines Wimpernschlags, ich, das Staubkorn, Baryllis.
»Wir müssen mit deinem Vater Auletes anfangen«, sagte Gabal. Er saß auf dem Boden vor mir mit untergeschlagenen Beinen in der Art, wie es bei den barbarischen Völkern des Ostens üblich ist. Ich sagte ihm lachend, daß kein Grieche sich jemals so hinkauern würde. »Es ist eine typische Sklaven- und Barbaren-Sitzstellung.«
»Ich bin schließlich beides, Herrin«, sagte er und nahm einen Schluck Pfefferminztee aus der Tonschale.
Er ist nicht davon abzubringen, mich »Herrin« zu nennen.
»Du bist beinahe mein Sohn«, sagte ich. »Ich meine, du stehst mir sehr nahe. Du bist Ganymedes’ Kind. Ich bin dir verpflichtet.«
Er senkte den Blick und schwieg einen Moment lang. Die Papyrusrolle lag vor ihm auf dem Boden, und er kritzelte gleich wieder emsig, als ich zur Sache kam.
»Wir müssen mit Kleopatra anfangen«, sagte ich und seufzte. »Nein, nicht mit meiner Schwester. Mit der Großmutter meines Vaters. Sie hieß Kleopatra. Es war nämlich so –«
Die Königinnen hießen immer Kleopatra, die Könige Ptolemaios. Und wenn sie nicht von Geburt an diesen Namen getragen hatten, nahmen sie ihn bei der Thronbesteigung an. Sie sahen sich alle sehr ähnlich, weil sie vorzugsweise innerhalb der Familie heirateten. Das hatten schon die Könige der alten Ägypter mit gutem Grund so gehalten. Es ging darum, Rivalen um den Thron auszuschalten. Thronanwärter kamen im allgemeinen aus der königlichen Familie selbst: der Sohn der Schwester, der jüngere Bruder, ein Cousin. Es war von daher gesehen sehr weise, wenn der Bruder seine Schwester heiratete. Das Haus der Ptolemäer mit seinem strengen dynastischen Bewußtsein hat die Dynastien der anderen hellenistischen Reiche überlebt, das Haus des Seleukos in Syrien, Antigonos und seine Erben in Makedonien, die Attaliden in Pergamon.
»Kleopatra hatte zwei Söhne, Ptolemaios und Ptolemaios Alexander.«
»Ich habe sie in meinem Buch Kleopatra die Dritte genannt.«
Ich rechnete kurz und kam darauf, daß meine Schwester nach dieser Zählung Kleopatra die Siebte wäre. All diese austauschbaren Menschen namens Kleopatra und Ptolemaios, was interessierten sie ihn? Alle diese Könige und Königinnen hatten in etwa das gleiche getan. Mit Erlassen und Dekreten hatten sie versucht, den Reichtum Ägyptens nach Möglichkeit zu vermehren, zu verwalten und wenn möglich in ihre eigenen Taschen zu lenken. Sie hatten aber auch Tempel erbauen und ausschmücken lassen, Priesterämter besetzt und sich dem Volk gegenüber huldvoll erwiesen. Die Menschen um sie herum, die Höflinge, die Hofdamen, die Händler auf dem Markt, die Dattelverkäuferinnen, die Fischverkäufer am Hafen machten ihre kleinen und großen Geschäfte, lebten ihre Intrigen, zogen Kinder auf, wurden irgendwann krank und starben oder verfielen dem Alterswahnsinn. Die Ptolemäerkönige und ihre Königinnen waren höchst selten krank, sie starben durch Dolch oder Erdrosselung oder Gift in ihrem Abendtrunk. Mit den Leiden des Alters hatten sie selten zu kämpfen.
Tatsächlich war mein Vater wohl der einzige Ptolemäerkönig, der an einer Krankheit im fortgerückten Alter starb. Jede und jeder hatte versucht, an der Macht zu bleiben, Rivalen und Rivalinnen auszuschalten, die eigenen Kinder abzusichern. In der nächsten Generation hatte das Spiel aufs neue begonnen. Die Kinder waren nach dem Tod ihrer Erzeuger mit Gift und Dolch aufeinander losgegangen, immer mit dem Ziel, die Sicherheit ihrer eigenen Nachkommen zu gewährleisten. Geht es in Wolfsrudeln, in Löwenrudeln so zu? Ich weiß es nicht. Aber sicherlich gibt es in der Bibliothek von Alexandria gelehrte Untersuchungen über das Verhalten von Löwen und Wölfen. Ich habe die starke Vermutung, daß die tödlichen Grundsätze meiner Familie zu allen Zeiten an allen Höfen, in allen Palästen galten. Am meisten da, wo es um viel ging. Also am Hof des Perserkönigs, überall da, wo Gold, Wein und Honig fließen. Und daß es so ähnlich wie am Hofe in Alexandria schon an den Höfen des alten Ägyptens zuging, an denen in Äthiopien und in Persien, in Indien und überall auf der Welt, wo Könige die Menschen beherrscht haben. Unterhalb der königlichen Familie und in manchen Fällen auf einer Ebene oder sogar über ihr hatten mächtige Eunuchen das Sagen. Oft waren sie die eigentlichen Regenten. Umsichtig, bienenfleißig und klug versahen sie die Regierungsgeschäfte für unfähige oder müde Herrscher. Im Gegensatz zu den Geschwistern des verstorbenen Herrschers überlebten sie die Übergänge von einer Königsherrschaft zur nächsten. Ihre Namen wurden in vielen Fällen nicht genannt. Sie hatten keine persönlichen Nachkommen und keinen persönlichen Ruhm. Sie lebten für ihre Ämter und ihre Arbeit. Manche waren grausam und raffgierig, aber das waren Ausnahmen. Bei der Bevölkerung waren sie unbeliebt. Zu sehr unterschied sich ihr Leben von dem der einfachen Menschen, die eine Familie zu ernähren hatten. Dem einfachen Bauern, der sich jeden Tag, dem Verhungern nahe, auf seinen Feldern abrackerte, standen die fernen göttlichen Könige in ihrem Glanz innerlich näher als die Eunuchen im Palast, die dort die Geschäfte führten und die Bittschriften lasen.
»Du warst zehn Jahre in Indien. Du hast Städte und Flüsse, Dinge, Tiere und Menschen gesehen, die ich nie sehen werde. Warum willst du unbedingt diese Geschichte eines Königsgeschlechts schreiben, dessen Zeit vorbei ist?«
»Die Ptolemäer waren klüger und grausamer als andere Könige. Deshalb konnten sie sich länger halten als jede andere Dynastie. Männer und Frauen standen sich in nichts nach. Die Frauen waren gleichberechtigt, sie waren nicht dümmer und ärmer, wie es meistens ist, wenn ein König eine Frau aus einem anderen Haus heiratet.«
Ich dachte, daß er ein kluger Mann war und daß er recht hatte. Ich mochte ihn. Trotz meines Alters empfand ich sehr deutlich, wie schön er war. Männliche Schönheit wird mich bis zum letzten Atemzug faszinieren. Ein scharfkantig geschnittenes Gesicht mit angegrautem Bart, sehnige starke sonnengebräunte Arme, die feinen, körperlicher Arbeit entwöhnten Hände eines Gelehrten oder eines Redners werden mich immer wieder mein Alter vergessen lassen.
Von Geburt an war ich von Eunuchen umgeben. Die ersten wirklichen Männer, die ich sah, waren ein Ereignis. Jeder einzelne dieser ersten, wirklichen hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Der dunkelhäutige Achillas, der aufrichtige, tiefernste Cato, der charmante junge Pompeius mit seinem abgehackten römischen Sprachrhythmus. Ich bin sicher, Arsinoë und Kleopatra empfanden diese Unruhe genauso stark wie ich. Diese wirklichen Männer besaßen eine unglaubliche, eine verbotene Ausstrahlung, eine Lebendigkeit, die uns für Augenblicke stumm machte. Sie rochen verboten. Auch dann, wenn sie gerade vom Bad kamen, geölt und gesalbt bis zu den Zehenspitzen, umgab sie immer dieser typische Schweißgeruch. Ich habe früh verstanden, daß hochgestellte Mädchen und Frauen von Eunuchen umgeben, abgeschirmt wurden. Bei der ersten Begegnung verfällt ein junges Mädchen einem solchen Mann, sei er Krieger oder Kaufmann oder was auch immer. Sie verfällt unweigerlich diesem Feuer, das ihn umglüht, ohne ihn näher zu kennen, ohne etwas von ihm zu wissen.
»Ich habe heute nicht viel Zeit«, sagte ich. »Wir sollten uns ein anderes Mal treffen.«
Ich hatte keine Lust, ihm zu sagen, daß auch ich an einem Buch arbeite. Der eigentliche Grund war allerdings, daß ich Gabal nur in kleinen Dosen vertrage. Für heute war es einfach genug. Er sieht zu gut, zu erotisch aus. Meine Gedanken schweifen ab, wenn er hereintritt. Er erinnert mich an zu vieles. Ich bin fest entschlossen, Metellus treu zu bleiben. Sogar in Gedanken. Diesen Pakt habe ich mit mir selbst geschlossen. Mag Metellus tun, was er will, es hat keine Bedeutung. Das wissen wir beide. Ich werde ihm jedenfalls treu bleiben.
Ich nickte ihm also zu, Gabal verstand es. Geschmeidig erhob er sich. Er küßte den Ring an meiner rechten Hand.
»Kennst du den Ring?« fragte ich. Irgend etwas in mir zwang mich, den Ring abzustreifen und ihn ihm zu geben.
Er betrachtete ihn schweigend. Die Frau mit dem Krug am Brunnen, die Palme, das Schiff.
»Ich wollte ihn dir schon lange schenken«, sagte ich. »Er hat in meinem Leben eine wichtige Rolle gespielt. Arsinoë hat ihn mir gegeben, damals in Ephesos.«
Er schwieg. Dann zog er ihn langsam über seinen Finger.
»Er sieht gut aus an deiner Hand.«
»Nefr nub sieht immer gut aus auf dunkler Haut.«
Er war zu betroffen, um mir zu danken. Ich wußte, er würde mir ein paar Tage später einen kleinen Brief in seiner klaren großen Wissenschaftlerhandschrift schicken, um mir zu danken. Gabal ist ein Forscher, ein Gelehrter. Anders als die meisten Politiker und Feldherren ist er auch dann höflich und korrekt, wenn er es nicht sein muß. Ja, er ist auch anders als Ganymedes ihn erzogen hat. Er gehört einer Generation an, die nicht am strengen ägyptischen Hof großgeworden ist. Auf seinen langen Reisen hat Gabal irgendeine Art von Freiheit kennengelernt, die vielleicht darin besteht, daß er nie irgendwo seßhaft und abhängig geworden ist. Ich denke oft über Gabal nach, weil er so anders ist.
Nefr nub, gutes Gold, sagen die Menschen in Libyen. Die alten Ägypter nannten Gold »Fleisch der Götter«. Aus Silber stellten sie sich das Skelett der Götter vor.
»Du bist mir nicht böse, Gabal, daß ich allein sein will?«
Er lächelte. Einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, ihn an mich zu ziehen und ihn zu küssen. Ich ließ es lieber.
»Sag mir, wann ich wiederkommen soll«, bat er. »Ich brauche deine Hilfe, Herrin.«