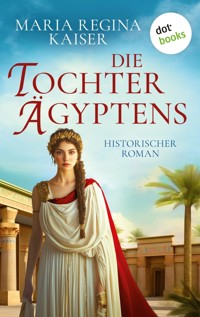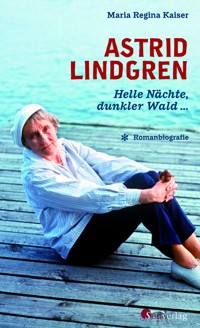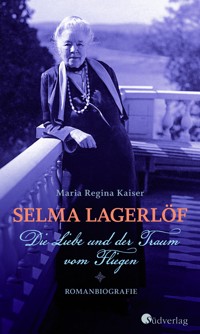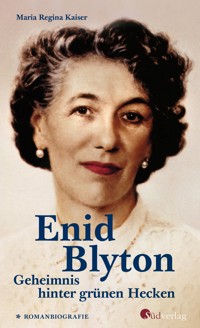
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Südverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Die erste deutschsprachige Romanbiografie über die britische Erfolgsautorin. - Empathisch-respektvolle Hommage an eine Autorin, die mit ihrem Werk Millionen von Kinderherzen erobert und ganze Bibliotheken füllt. - Leidenschaftliche Vielschreiberin, clevere Unternehmerin, engagierte Kinderversteherin: das facettenreiche Porträt einer Frau mit vielen Gesichtern. - Kenntnisreich und einfühlsam erzählt, mit einem klugen Nachwort und einem ausführlichen Anhang. "Die Urteile irgendwelcher Menschen über zwölf Jahre interessieren mich nicht", bemerkt Enid Blyton (1897-1968), der es mit ihren Geschichten gelingt, Generationen von Kindern zum Lesen zu motivieren. Eine aussichtsreiche Ausbildung zur Pianistin bricht Enid ab, sie wirkt als Lehrerin und Kolumnistin für Kinderzeitschriften. Schließlich macht sie ihre Schreibleidenschaft zur Profession, wird eine der international erfolgreichsten SchriftstellerInnen. Denn die Britin nimmt Kinder ernst, weiß, wovon sie träumen. Mit ihren millionenfach verkauften Büchern bietet Enid Blyton attraktive Fluchtwelten, vor allem spannendes Lesefutter: Begeistert tauchen Mädchen und Jungen seit Jahrzehnten ein in die Abenteuer der "Fünf Freunde" oder der "Schwarzen Sieben". Die leidenschaftliche Vielschreiberin ist zudem eine umtriebige Geschäftsfrau, befördert auf geniale Weise die Vermarktung ihrer Titel. Zeitlebens engagiert sie sich auch karitativ, kümmert sich um vernachlässigte, schutzlose Kinder. Mehr als fünfzig Jahre nach ihrem Tod polarisiert sie noch immer, denn viele Erwachsene stempeln Blytons Werke als trivial ab, kritisieren Sprache und Moral ihrer Texte. Bis heute umwabert die Autorin Rätselhaftes und Geheimnisvolles. Nahezu jeder kennt ihren Namen, hat etwas von ihr gelesen. Doch verstanden wird Enid Blyton von den wenigsten ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maria Regina Kaiser
Enid Blyton
Geheimnis hintergrünenHecken
*Romanbiografie
Contents
Prolog
Teil I
Ein Beet für Enid
Ein Strandausflug und dichter Nebel
Kindern die Welt erklären
Chippy, mein Chippy, und die wilden Bären
Zu Besuch bei den Großeltern
Nähen, Kochen, Ausfegen
Teil II
Alles vorbei!
Lernen und Schreiben gegen die Traurigkeit
Schwere Zeiten
Enid alias George und Alfred Tennyson
Schmerzen und Träume
Lernen mit Begeisterung
Hilf mir, es selbst zu tun!
Eine kleine Privatschule und ein Gartenfest
Nein! und: Neue Freude
Ein Treffen mit Hilda und die erste Kolumne
Teil III
Der Schotte und ein Versprechen
Glück und noch mehr Glück
Maschinenwelten
Ein neues Zuhause
Wir wollen nicht mehr davon sprechen
Nie wieder Krieg?
Gillian, Imogen und Bobs
Green Hedges
Teil IV
Bomben und denkwürdiges Tennis
Durchatmen am Meer
Die Zeiten ändern sich
Das Mädchen George
Wie geht es Thomas?
Entwicklung und Lähmung
Die Schwarze Sieben und Noddy
Plötzlich alles zu viel
Harte Worte und üble Gerüchte
Ein Magazin, zwei Stücke, ein Theater
Gillians Hochzeit
Keep calm and carry on, Carey!
Bücher in der Kritik
Zu viele Namen und komische Wörter
Ein ungezogener Junge
Nebel
Nachwort der Autorin
Anhang
Zeittafel
Glossar
Enids Menschen
Enids Orte
Enids Werke
Quellennachweis
Quellen im Internet
Dank
Landmarks
Cover
»Eine Lawine kann man nicht aufhalten.«
George Greenfield, Enid Blytons Agent
»Unsere Bücher sind Facetten von uns selbst.«
Enid Blyton in einem Brief an Peter McKellar
Prolog
Beaconsfield, Ende September 1967
Wespen schwirrten zwischen den Teetassen umher und machten sich an der Erdbeermarmelade zu schaffen. Trotz der Nebelschwaden, die über den Büschen hingen, schien die Septembersonne erstaunlich stark auf die Terrasse, wo Enid auf dem Gartenstuhl vor dem gedeckten Tisch saß, ihr gegenüber der Fremde.
Sie war jetzt siebzig Jahre alt, doch in der letzten Zeit fühlte sie sich viel jünger. Die Briefe des Königlichen Finanzamts, die Rechnungen des Krankenhauses und die Anrufe ihrer Verleger interessierten sie nicht mehr. Den Namen ihres freundlichen Literaturagenten hatte sie vergessen. Auch der Name des Ortes, an dem sie wohnte, war ihr entfallen. Umso deutlicher sah sie das wilde Mädchen George vor sich, an das sie nun ununterbrochen dachte.
Träumte sie oder schrieb sie gerade diese Geschichte, die sich mit ihr und dem Mann im Tweedjackett und der Stimme ihres Vaters abspielte? Hier im Garten von Green Hedges?
Enid hielt den Mohairschal in den Händen. Rot war ihre Lieblingsfarbe, und von ihren zahlreichen roten Schals war dieser der wärmste. Er hielt sie warm, wenn sie abends am Kamin saß. Sie fror jetzt ununterbrochen, und ihre Hände zitterten. Mit dem schützenden Schal ließ sich das verbergen.
Sie versuchte ein Lächeln, obwohl ihr unbehaglich zumute war. Doris war so eigenwillig geworden. Was auch immer Enid zu ihr sagte, das Hausmädchen führte es nicht korrekt aus. Oft tat sie genau das Gegenteil von dem, worum Enid sie gebeten hatte. Der Mann war gekommen, obwohl sie streng verboten hatte, Besucher zu ihr zu lassen. Doris hatte sogar Tee mit Sandwiches und Gebäck zum Gartentisch gebracht und Tassen und Teller für zwei aufgedeckt. Dabei wollte Enid auf keinen Fall mit diesem Fremden sprechen. Und jetzt auch noch Tee mit ihm trinken. Warum hatte sie sich nur darauf eingelassen?
»Ich fühle mich heute gar nicht wohl«, sagte sie und lächelte erneut.
»Ich bin Hanly«, wiederholte der Mann. »Erkennst du mich nicht, Enid?«
Was für ein Unsinn! Hanly trug doch kein Tweedjackett und keine Krawatte! »Sie stören mich bei der Arbeit. Sehen Sie nicht, dass ich ein Buch schreibe?« Beinahe fertig war es, sie musste es zur Post geben, am besten noch heute Nachmittag, die Zeit drängte, und das Postamt schloss um fünf Uhr. Alle warteten auf das Manuskript. Ja, das war das Gute, das Buch war beinahe fertig. Sie hielt einen Zettel Papier in der Hand, auf dem ein paar Wörter in ungelenken Buchstaben hingekritzelt waren.
»Das ist doch kein Buch, Enid«, widersprach der Mann.
Sie schüttelte den Kopf. Sie war Enid Blyton. Jede ihrer Erstauflagen betrug fünfundzwanzigtausend Exemplare, was er natürlich nicht wissen konnte. Dann kam Enid ein Gedanke: Vielleicht hieß der Mann ja nur zufällig Hanly und bildete sich deswegen ein, er sei ihr Bruder. Ein Verrückter. Doris hätte ihn niemals hierher lassen dürfen!
»Es tut mir so leid, dass dein Mann gestorben ist«, sagte er jetzt und nahm sich ein Sandwich.
Der Besucher war offenbar wirklich verrückt. »Mein Mann ist nicht gestorben. Wie kommen Sie darauf? Er spielt Golf. Gegen Abend kommt er nach Hause.«
Nachmittags war ihr Schatz stets auf dem Golfplatz. Nichts und niemand konnte ihn von seinem Lieblingssport abhalten. Kenneth hielt sich immer so lange dort auf. Meistens kam er erst zurück, wenn Enid schon eingeschlafen war. Und morgens ging er gleich in den Garten, ohne vorher mit ihr zusammen zu frühstücken. Was sollte sie nur tun? Es war immer so schön gewesen, mit ihm gemeinsam das Frühstücksei und den in Streifen geschnittenen gebutterten Toast zu verzehren.
»Der Verlag wird allmählich unruhig«, sagte sie zu dem Besucher. »Ich sollte schon vor einer Woche abliefern. Und in dieser Situation halten Sie mich bei der Arbeit auf. Das ist sehr ärgerlich.«
»Ach, Enid.«
Dem Mann war offensichtlich nicht zu helfen. Er wollte unbedingt mit ihr Tee trinken. Man sah, dass er hungrig war. Enid gab auf. »Lassen Sie es sich schmecken«, sagte sie. »Aber wenn Sie satt sind, muss ich Sie bitten, auf der Stelle den Garten und mein Haus zu verlassen.«
»Enid«, wiederholte der Besucher, und dann lachte er plötzlich, glucksend, so wie vor langer Zeit ihr Daddy. Das war seltsam.
Enid rückte ihren Stuhl ein Stück zurück. »Ich sage dem Gärtner Bescheid. Er soll die Polizei anrufen. Wir haben Telefon im Haus. Wollen Sie das?«
»Yvonne lässt dich grüßen«, begann der Mann aufs Neue.
Was wollte er nur von ihr? Und wer, um Himmels willen, war »Yvonne«? Endlich kam sie darauf. »Ich verstehe, Sie und Yvonne möchten Autogrammkarten von mir haben. Aber bitte, Doris wird uns welche bringen. Und dann können Sie endlich gehen.« Enid griff nach der bronzenen Glocke und läutete entschieden.
»Das ganze Theater nur, um zwei Autogrammkarten zu bekommen«, erklärte sie dem Hausmädchen. »Holen Sie bitte zwei meiner Karten, Doris, Sie wissen ja, sie sind in der obersten Schreibtischschublade, alle schon unterschrieben. Und am besten wäre, wenn Sie den Herrn gleich mit zum Gartentor nehmen.«
»Yes, Madam«, stammelte Doris.
»Bald komme ich wieder, Schwesterchen«, verabschiedete sich der Mann und küsste Enid auf die Stirn. Das fand sie übertrieben, ließ es aber über sich ergehen. Als erfolgreiche Autorin musste man so manches ertragen.
Angestrengt schaute sie ihn nochmals an. Ein bisschen sah er ihrem Vater ähnlich. Was für Zufälle es doch gab!
Als Doris ihn fortführte, blieb er noch einmal stehen, sah zurück und winkte ihr. Die Autogrammkarten hatte er ohne ein Wort des Dankes in der Brusttasche seines Jacketts versenkt. Dass er aber auch »Hanly« hieß, gerade wie ihr Bruder, und diese Ähnlichkeit mit Daddy hatte, das machte ihn ihr fast sympathisch.
Enid lehnte sich zurück in ihren Gartenstuhl und träumte vor sich hin.
Wie schön es doch wäre, wenn einer mit dem Aussehen ihres Daddys den Weg zu ihr in den Garten von Green Hedges fände. Das wäre doch möglich, oder? »Komm Enid, wir gehen los«, würde er sagen. »Wir müssen ganz leise sein. Da drüben im Gebüsch gibt es eine Füchsin, die fünf Welpen hat. Mit ein bisschen Glück lassen sie sich auf der Wiese sehen.«
Teil I
Als noch alles gut war
Ein Beet für Enid
Beckenham, Frühsommer 1902
Beckenham war ein ruhiger kleiner Ort am Rande von London mit guten Bahnverbindungen zum Zentrum der Großstadt. Im Jahr 1902 hatte Familie Blyton in der Clock House Road Nr. 35 ein größeres Reihenhaus mit einem großen Garten bezogen.
»Jetzt bekommst du dein eigenes Beet, Enid, da drüben an der Mauer«, verkündete Thomas Blyton.
»Kann ich es ganz voll mit Erdbeeren pflanzen?«, fragte Enid.
»Wenn du willst.« Er freute sich über den Eifer seiner Tochter.
»Aber ich habe kein Geld, um Pflanzen zu kaufen«, überlegte Enid dann. Jedes Tütchen mit Samen kostete im Laden einen Penny.
»Hm. Du könntest mein Fahrrad putzen. Dafür würde ich dir einen Lohn zahlen«, schlug der Vater vor. »Wenn du es ordentlich machst, sodass das Rad glänzt und blitzt, und du außerdem auf meinem Beet Unkraut zupfst, gebe ich dir Sixpence. Was hältst du davon?«
Ein Sixpence-Stück reichte aus, um sechs Samentüten zu erwerben! Enid strahlte vor Glück.
»Aber erst musst du arbeiten, Enid. So geht es allen Menschen. Wer etwas haben will, muss sich vorher mit Arbeit quälen.« Bei diesen Worten sah Thomas Blyton sehr ernst aus.
~
Einen ganzen Nachmittag brauchte Enid, um das Fahrrad zu säubern. Am nächsten Tag kümmerte sie sich um das Unkraut auf Daddys Beet. Als er von der Arbeit nach Hause kam, erhielt sie ihren Lohn, eine neue silberne Sixpence-Münze. Enid betrachtete mit Stolz das glänzende Stück Metall, das jetzt ihr gehörte.
»Schau dir die Münze genau an. Was siehst du?« Thomas Blyton lächelte.
Auf der einen Seite las Enid zögernd die Worte SIX PENCE, über denen eine Krone abgebildet war. Die andere Seite zeigte den Kopf eines alten Mannes im Profil mit spitzer Nase. »Der ist hässlich«, meinte Enid.
»Das ist unser König. Sprich mit Respekt von ihm«, mahnte ihr Vater.
Wieder begann Enid zu buchstabieren: »EDWARDVS VII ...«
»Edward der Siebte, von Gottes Gnaden König von Großbritannien und Irland.« Thomas Blyton erklärte seiner Tochter, dass der König, der im Londoner Buckingham Palace wohnte, zugleich Kaiser des weit entfernten Indien war.
Enid war so beeindruckt von ihrem kleinen Münzschatz, dass sie noch einen Tag abwartete, bevor sie ihn im Laden gegen Samentütchen eintauschte.
~
Enid hatte verschiedene Pflanzensamen gekauft. Und jetzt war es endlich so weit. Thomas Blyton stand neben seiner Tochter, als sie auf dem Boden kniete und in die aufgeharkte und glattgerechte Erde die ersten Knöllchen und Körnchen hineinsteckte.
»Die Kapuzinerkresse keimt bald schon«, erklärte der Vater. »Man kann sie essen, und sie blüht sehr hübsch.«
»Rot?«, fragte Enid.
»Eher gelb und orange. Und du musst sie nicht düngen. Je weniger du machst, Enid, desto besser werden die Pflanzen gedeihen.« Für den Anfang sei Kapuzinerkresse für eine Gärtnerin die geeignete Pflanze. Man könne nichts falsch machen bei der Pflege. Eine Reihe davon sei genug, meinte er dann. Und sie habe für die übrigen Pflanzen schon etwas sehr Gutes getan. Denn die Kapuzinerkresse vertreibe die Blattläuse auf den anderen Beetbewohnern.
~
Tagelang hatte Enid das Wachsen ihrer Salatpflanzen beobachtet, aber jetzt waren da diese braunen Nacktschnecken gekommen und fraßen die zarten hellgrünen Blätter an.
»Wir haben zu viele Schnecken im Garten, Daddy«, beklagte sie sich.
Thomas Blyton hatte sein freies Wochenende und freute sich darüber, etwas im Garten arbeiten zu können. Er trug sein dunkelgrünes Tweedjackett und hellbraune Manchesterhosen. Enid fand ihn in diesem Moment wunderschön. Und am liebsten hätte sie auch eine Kordhose wie er gehabt, aber das war unmöglich, weil Mädchen nun einmal keine solchen Hosen trugen.
»Wenn man die Schnecken in eine flache Schale mit Bier hineinlockt, sterben sie«, meinte Mummy, die ebenfalls gekommen war, um die ersten Tomaten zu pflücken. »So machen es jedenfalls unsere Nachbarn.«
»Auf keinen Fall. Wir sind doch keine Schneckenmörder«, rief Thomas Blyton.
»Etwas muss man schließlich unternehmen«, beharrte seine Frau. »Sie fressen ja sonst das gesamte Gemüse weg.«
»Wir werden es aber auf die sanfte Tour versuchen.«
»Daddy hat ganz recht«, stimmte Enid zu.
Das beste Mittel, um Schnecken fernzuhalten, sei, eine natürliche Hecke anzupflanzen, erklärte der Vater dann, und Theresa Blyton schüttelte den Kopf. Das dauere doch viel zu lange, bis die neu gepflanzten Sträucher groß genug seien. Bis dahin hätten die Schnecken den Salat längst aufgefressen.
Aber Thomas Blyton war nicht von seiner Idee abzubringen. Dem Garten hier fehle die Hecke. »Sie lockt Schmetterlinge, Falter, Vögel und nützliche Insekten herbei. Und Vögel, vor allem Singdrosseln und Rotkehlchen, verzehren Schnecken.« Eine Berberitzenhecke werde er anpflanzen, mit den roten Beeren im grünen Laub sei sie sehr attraktiv, und außerdem könne man die Beeren roh und gekocht essen.
»Annie kann dann Marmelade daraus für uns kochen«, schlug Enid vor.
»Ich will die Beeren haben«, erklärte Hanly, Enids jüngerer Bruder. Vom Spielen werde er immer so hungrig.
Ein Strandausflug und dichter Nebel
Purbeck, Sommer 1905
Enid hatte zusammen mit ihrem Vater Muscheln am Strand gesucht. Dann waren sie noch ein längeres Stück am Meer entlang gelaufen und hatten zwei Delfine beobachtet, die über das Wasser sprangen.
»Na komm, alter George«, sagte Thomas Blyton. »Wir schaffen es noch ein Stück weiter!«
Wie immer, wenn er sie »alter George« nannte, stimmte Enid begeistert zu. Mummy und die jüngeren Brüder waren im Hotel zurückgeblieben. Theresa Blyton strickte auf der Veranda und lauschte der Musik des Stehgeigers, während die Kleinen ihren Mittagsschlaf hielten. Die drei waren nicht gut zu Fuß. Insofern war es Thomas Blyton nur recht, allein mit seinem ältesten Kind am Strand umherzustreifen, wo sie Möwen beobachteten und Gespräche miteinander führten, fast wie zwei Erwachsene. Enid war sich ganz sicher, dass ihr Vater sie lieber als Mummy und die beiden Jungen hatte.
»Mein alter George versteht mich doch am besten«, sagte er manches Mal und drückte die Kleine fest an sich. Nicht nur, dass Enid mit ihrem dunklen Haar und den braunen Augen ihm und seiner Schwester May so ähnlich sah; sie liebte auch die Musik wie alle auf der Blytonseite, erfand kleine Gedichte und interessierte sich für Tiere und Pflanzen. Da war sie ganz wie er, fand Thomas Blyton, der lieber Musiker geworden wäre, so wie seine beiden Geschwister, die mit Unterhaltungsmusik gutes Geld verdienten. Stattdessen war er nun Angestellter in einer Firma für Bestecke in London, was, wie er fand, auch kein schlechter Beruf für ihn war. Demnächst würde die Familie sogar ein größeres Haus beziehen, mit einem Garten, in dem die Kinder sich austoben konnten.
Ganz plötzlich schlug das Wetter um. Eine graue Wand tauchte über dem Meer auf und näherte sich langsam, aber unaufhaltsam. Und dann war es, als befänden Enid und ihr Vater sich in einer anderen Welt. Die Strandhütten, an denen sie vorhin vorbeigekommen waren, waren mit einem Mal entschwunden. Die Pfähle im Strand und der Turm des Strandwarts waren nicht mehr zu sehen.
Der Nebel wurde immer dichter. Sie hörten die Brandung, die gegen das Ufer schlug. Der Vater blieb stehen und blickte suchend dahin, wo der Himmel sein musste. Doch da waren nur undurchdringliche graue Schwaden, während es immer dunkler wurde.
»Zu dumm, meine Uhr ist stehen geblieben.« Er schüttelte den Kopf.
Enid umklammerte seine Hand. Es ging auf den Abend zu, oder bildete sie sich das nur ein? Jedenfalls hatte sie Hunger und dachte an den Speiseraum des Hotels, wo Mummy mit Hanly und Carey auf sie wartete.
Thomas Blyton sah auf seine Armbanduhr und schwieg. »Ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, Enid«, sagte er nach einer Weile.
»Aber du weißt den Weg, Daddy?«
»Wir haben uns verirrt«, stellte er dann fest. »Leider. Mit dem Nebel hat kein Mensch gerechnet. Und dass er so dicht ist.«
»Müssen wir jetzt verhungern und erfrieren?«, fragte Enid.
»Keine Angst, alter George. Ich bin ja bei dir«, sagte der Vater und lachte. »Und im Rucksack haben wir die Flasche mit Tee und noch ein Sandwich.«
»Daddy, müssen wir hier draußen übernachten?«
Er zuckte die Achseln.
»Hier am Strand?«, fragte Enid.
»Sieht ganz so aus.«
»Erfrieren wir dann?«
»Auf keinen Fall, Enid.«
»Geht der Nebel irgendwann auch wieder weg?«
»Manchmal verschwindet er ganz schnell. Am Meer weht immer Wind, da hat der Nebel keine Chance.« Thomas Blyton sprach lauter als sonst, Enid spürte seine Besorgnis. Sie müssten jetzt auf die Felsen zugehen, weg vom Meer, um sich einen Unterstand für die Nacht zu suchen, fügte er hinzu.
»Wenn wir die Strandhütten finden, wissen wir wieder, wo wir sind«, meinte Enid. Und vielleicht waren da ja Leute, die ebenfalls vor dem Wetter Schutz suchten. Vielleicht hatten sie Kekse und Limonade bei sich oder überzählige Schinkensandwiches und Hackfleischpastetchen.
»Ich wette, Enid, wir finden gleich ein paar Gäste aus unserem Hotel, die sich um einen Gaskocher versammelt haben«, begann der Vater und versuchte, zuversichtlich zu klingen. »Bei den Strandhütten müssen welche sein. Dann gibt es heiße Suppe für uns.« Er schimpfte laut mit sich selbst, weil die Taschenlampe nicht funktionierte, ein vor Kurzem erworbenes Gerät, auf das er sehr stolz war. »Die Kontakte sind feucht geworden«, jammerte er. »Dabei ist es ein britisches Produkt, hier im Land erfunden und hergestellt.«
Enids Beine wurden immer schwerer. »Sind wir bald bei den Hütten, Daddy?«, murmelte sie. »Ich bin so müde.«
»Ich glaube, wir sind längst an ihnen vorbeigelaufen.«
»Vielleicht kommt Mummy und hilft uns.«
»Nein, Enid, vergiss es. Mummy sitzt im Hotel und ist ärgerlich, dass wir nicht rechtzeitig da sind.«
Beide blieben sie stehen, und der Vater begann laut zu rufen: »Hallo, ist da jemand?« Es kam keine Antwort, wie oft er auch rief. Nur die Schreie von Seevögeln und das Rauschen der Brandung waren zu hören.
Sie standen jetzt vor Schilf und dornigem Gestrüpp. »Komm, noch ein bisschen weiter. Vielleicht haben wir Glück«, sagte er, und Enid war zu erschöpft, um zu fragen, was er sich erhoffte. Sie umrundeten ein Dickicht aus Schilf und Strandhafer, ein Weg, der dem kleinen Mädchen endlos erschien.
»Kannst du noch?«, fragte der Vater.
»Aber ja«, log Enid.
»Tapferes Mädchen«, lobte er sie.
Im nächsten Augenblick stolperten sie über etwas, das vor ihren Füßen lag. Thomas Blyton bückte sich. »Das war ein Lagerfeuer«, sagte er triumphierend. »Hier werden wir ausruhen, Enid.«
Sie setzten sich, und der Vater zog seinen Pullover aus, damit Enid warm auf dem Boden saß, und wickelte sich dann in seinen Mantel. Es dauerte ein bisschen, bis er die feuchten Äste am Boden in Brand gesetzt hatte. Aber schließlich flackerte ein richtiges Feuer vor ihnen, und Enids Hände wurden langsam wieder warm. Abwechselnd tranken sie kalten Tee aus der mitgebrachten Flasche, und Thomas Blyton überließ seiner Tochter fast das ganze Schinkensandwich. Dann begann er zu singen, und Enid stimmte in das irische Seemannslied mit ein.
Danach fing Enid an, eine Geschichte zu erzählen: »Die zwei schiffbrüchigen Matrosen saßen am Feuer und sangen. Sie hatten nichts zu essen dabei. Trotzdem waren sie lustig. Ihre nassen Kleider waren bald getrocknet.«
Der Vater lachte leise vor sich hin. »Hatten sie Angst?«
»Überhaupt nicht. Sie waren schließlich zu zweit und außerdem gute Freunde. Und sie sangen ein Seemannslied nach dem anderen.« Wenn sie starken Tee getrunken hatte, erzählte Enid stets Geschichten. Mummy hörte ihr nie dabei zu. Sie sagte dann meist: »Kind, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?«
Daddy aber wollte immer noch mehr von Enid hören. »Wie hießen die beiden denn?«, wollte er jetzt wissen.
»Der eine war Old George und der andere war Young George«, erklärte Enid.
»Das hätte ich mir fast denken können«, meinte Thomas Blyton.
»Und dabei war es so«, fuhr Enid fort, »dass Old George der Jüngere und Young George der Ältere war.« Old George sei viel pfiffiger und klüger gewesen als der alte Matrose. Nur aufgrund der pfiffigen Einfälle des jungen Matrosen hätten die beiden Schiffbrüchigen auf der einsamen Insel inmitten wilder Tiere überlebt.
»Gut, dass sie überlebt haben«, murmelte der Vater.
»Auf der Insel war es immer warm. Sie mussten nicht frieren, nicht einmal nachts«, setzte Enid ihre Geschichte fort. »Im Meer gab es so viele Fische, dass man sie mit der Hand fangen konnte und immer genug zu essen hatte.«
Thomas Blyton brummelte jetzt schläfrig.
»Und wenn ihnen doch einmal kalt war, haben sie sich aneinander gekuschelt. Jeden Morgen hat Old George für Young George den Tee gekocht.«
Schlagartig war der Vater wieder hellwach. »Aber wie hat er das angestellt?«
»Ich weiß nicht«, murmelte Enid. Und nach einer Pause bat sie: »Jetzt musst du eine Geschichte erzählen, Daddy.« Es war inzwischen stockdunkel und unangenehm kalt, trotz des kleinen Feuers, das noch immer brannte. »Erzähl, wie du mir das Leben gerettet hast«, verlangte Enid.
»Also, das war so«, begann Thomas Blyton. »Du warst noch ganz klein, Enid. Eines Tages hattest du hohes Fieber. Fürchterlich hast du gehustet. Erst drei Monate alt warst du und hattest Keuchhusten bekommen, eine Krankheit, die umso gefährlicher ist, je jünger das Baby ist. Der Arzt kam zu uns in die Wohnung und untersuchte dich. Deine Mummy hielt dich im Arm.« Verängstigt hätten Thomas und Theresa Blyton den Mediziner angesehen, als er seine Geräte wieder in die Tasche packte. Was sie noch tun könnten, wollten sie wissen. »›Sie müssen mit dem Schlimmsten rechnen‹, so verabschiedete er sich an der Tür von uns. ›Ihr Kind wird die Nacht wohl nicht überleben.‹«
»Und dann?«, fragte Enid.
»Deine Mummy weinte bitterlich. Ich nahm dich aus ihrem Arm und setzte mich mit dir zusammen in den Sessel vor das Kaminfeuer. Dein Husten wurde immer schlimmer.« Der Vater schwieg eine Weile, während er sich erinnerte. »Bei jedem Anfall bist du fast erstickt. Dein Gesicht lief blau an. Du musstest würgen und erbrechen.« Und ihr Körper habe geglüht wie ein kleiner Ofen.
»Warst du verzweifelt? Hast du geweint?«
Thomas Blyton schüttelte den Kopf. »Ich habe dich gehalten und ein bisschen geschaukelt und dazu gesungen: ›Meine Enid bleibt bei mir. Meine Enid wird gesund.‹«
»Und dann, Daddy? Was ist in der Nacht passiert?«
»Der Husten ließ nach, und am Morgen war auch das Fieber gesunken. Mummy kam zu uns und sagte: ›Jetzt kannst du dich ein bisschen ins Bett legen und schlafen, Thomas. Enid hat die Krise überstanden.‹« Und er habe gesagt, sie solle ihn sofort wecken, wenn die Kleine wieder huste. Doch das war nicht notwendig. »Du warst über den Berg, Enid, wie man so sagt. Ich hatte dir in dieser Nacht das Leben gerettet.«
»Danke, Daddy, dass du das getan hast.«
Kindern die Welt erklären
London und Beckenham, 1905/06
Thomas Blyton war mit Enid nach London gefahren. Dort waren sie mit der Untergrund-Bahn unterwegs gewesen. Enid genoss den fremden warmen Geruch der U-Bahn-Schächte und die endlosen Treppen, die sie auf- und abgingen. Ihr Ziel war die Praxis eines Wissenschaftlers, der Enid untersuchen sollte.
»Ist es ein Zahnarzt?«, fragte sie.
»Nicht ganz, aber so ähnlich. Ein Schädelforscher«, erklärte der Vater. »Er wird dich gründlich untersuchen, Enid. Keine Angst, es wird nicht wehtun.«
Enid hatte sich den Wissenschaftler ganz anders vorgestellt, auf jeden Fall großartig und lebendig, jung und kräftig. Stattdessen empfing sie ein unglaublich hässlicher Alter, vor dem man sich nur fürchten konnte. Wie ein Gespenst erschien er ihr. Der Schädelforscher hatte selbst einen auffallend unförmigen großen Glatzkopf.
»Ich werde bald acht«, sagte Enid auf die erste Frage des hageren Alten im weißen Kittel. Sie war immer noch enttäuscht vom Aussehen dieses Mannes. Denn so viel wusste sie aus den Gesprächen mit ihrem Vater: Wissenschaftler, Doktoren und Professoren besuchten den König im Buckingham Palace, wo sie mit ihm Gespräche bei Tee und Plätzchen führten und hinterher Tennis spielten.
»Es ist so: Die Talente eines Kindes kann man sehr genau ab einem Alter von sechs Jahren bestimmen«, sagte der Wissenschaftler, an Thomas Blyton gerichtet. »Ach, diese dichten Haare«, seufzte er. Dann begann er, sich mit einem seltsamen Gerät an Enids Kopf zu schaffen zu machen. Ab und zu rief er eine Zahl oder einen lateinischen Ausdruck seiner Sekretärin zu, die mit einem Bleistift alle Angaben auf einer großen Karteikarte eintrug. Der Wissenschaftler tastete über Enids Kopfhaut, seine Finger umkreisten einzelne Stellen darauf. Hinter den Ohren verweilten sie länger. Anschließend strich er ihr über die Stirn, dann über den Haaransatz. Der Professor unterbrach die Untersuchung kurz und blickte zu Thomas Blyton hin, der auf einem Stuhl an der Wand, weit vorgebeugt sitzend, das Tun des Experten verfolgte. »Ein sehr willensstarkes Kind«, sagte er zu Enids Vater. »Mit einer auffallenden Beobachtungsgabe.«
»Wir setzen große Hoffnungen auf Enid.« Thomas Blyton nahm die Brille ab. »Fällt Ihnen sonst noch etwas auf?«
»Sie werden ein Gutachten erhalten, Mr. Blyton, das ich Ihnen in ein paar Tagen per Post zusenden werde. Ich muss die Ergebnisse auswerten. Erst in der Zusammenschau aller Einzelheiten ergibt sich das Gesamtbild.« Und noch einmal tastete er über Enids Kopfhaut. Seine Finger verweilten über jedem Knubbel, jeder leichten Hervorwölbung. »Oh, ja«, sagte er schließlich. »Oh, ja. Da ergibt sich ein klares Bild.«
»Wirklich?«, fragte Thomas Blyton.
»Wie gesagt: Ich werde Ihnen den Befund baldmöglichst zuschicken.« Der Wissenschaftler lächelte jetzt. »Dann steht der Weg Ihrer Tochter für Sie ganz fest. Gegen die vorhandenen Anlagen sollten Eltern nicht ankämpfen.«
»Natürlich nicht«, versicherte Thomas Blyton. »Ich muss gestehen, ich bin sehr gespannt.«
Nach der Untersuchung gingen Vater und Tochter in eine Teestube, um Tee und Kuchen zu sich zu nehmen. Das fand Enid viel interessanter als den Besuch in der Praxis des Phrenologen.
Über die Ergebnisse der Untersuchung bewahrte Thomas Blyton Stillschweigen. Enid las den Befund erst Jahrzehnte später, lange nach dem Tod ihres Vaters, als sie bereits eine anerkannte Schriftstellerin geworden war. Dieses Kind sei die geborene Lehrerin, und in dieser Richtung werde unzweifelhaft ihr Leben verlaufen, hatte der Mann mit dem unförmigen Schädel geurteilt. Kein Wort von Schriftstellerei. Zweifellos war Thomas Blyton enttäuscht, dass die musikalische Begabung seiner Tochter dem Experten überhaupt nicht aufgefallen war.
~
Es war ein warmer sonniger Tag. Gleich hinter den Häusern begannen die Brombeerhecken. Mummy hatte Enid und ihren Mann losgeschickt, Brombeeren zu sammeln, damit sie Marmelade und Gelee einkochen konnte. Die Beeren waren fast schwarz, dick und überreif. Fliegen und Bienen schwirrten zwischen den Früchten und den weißen Blüten, und kleine Vögel flogen umher und schnappten nach den Insekten.
Der Vater interessierte sich mehr für die Vögel. »Da sitzt einer ganz oben auf dem Busch, sieh ihn dir genau an, Enid«, rief er.
Sie blickten beide hoch, sahen die rosafarbenen Füße des Vogels und die purpurfarbene Brust.
»Das ist ein Dartford Warbler«, sagte Thomas Blyton halblaut. »Davon gibt es nicht mehr viele Paare.«
»Warum nicht?«, flüsterte Enid.
»Überall werden neue Häuser gebaut und Gärten angelegt. Diese Vögel brauchen die unberührte Landschaft, Heide, Ginster, Brombeerhecken.«
Sie standen jetzt bewegungslos und wagten kaum zu atmen, während sie den Vogel beobachteten.
»Hörst du den Ruf?«
Enid lauschte.
»Das ist eine Goldammer. Da – noch einmal. Jetzt weißt du, wie sie ruft.«
Die Spaziergänge mit ihrem Vater fanden regelmäßig sonntags statt, und Enid freute sich die ganze Woche darauf, an seiner Seite durch die Wiesen zu streifen. Manchmal fingen sie zusammen Schmetterlinge. Ab und zu gingen sie auch an den kleinen Fluss Ravensbourne zum Angeln und brachten im Eimer hinterher Fische für das Abendessen mit. Wenn sie ganz still unter ihrem Platz bei einer Trauerweide am Ufer saßen, sahen sie Eisvögel, die nach kleinen Fischen schnappten.
Jetzt winkte Thomas Blyton seine Tochter näher zu sich heran. »Hier gibt es Kaninchen, Enid. Setz dich hin und rühr dich nicht. Nur, wenn man ganz still ist, wagen sie sich hervor. Oh, schau, da ist schon eins.«
Auf dem Nachhauseweg zeigte der Vater ihr eine Kohlmeise. »Du kannst sie von den anderen Meisen unterscheiden, wenn du auf die weißen Flecke an den Kopfseiten achtest.« Es sei ein Glück, sagte er weiter, dass sie Wälder, Wiesen, Teiche und Seen in der Nähe hätten.
»Und dass es Eidechsen und weiße Veilchen gibt, ist auch sehr gut«, meinte Enid.
~
»Wir haben viel zu wenige Beeren gesammelt«, stellte Thomas Blyton fest, als sie vor dem Gartentor standen. Enid solle ein Naturtagebuch führen, riet er ihr dann noch, in dem sie alle ihre Beobachtungen notieren könnte.
Die Mutter schimpfte die beiden Spaziergänger aus. »Mich habt ihr wohl wieder vergessen. Die wenigen Brombeeren reichen gerade für eine Früchtesuppe«, meinte sie. »Wenn ihr beide mich nicht hättet, würdet ihr verhungern. Das Leben ist eine ernste Sache. Mit Lesen und Träumen bringt man es nicht weit.«
»Gardinenwaschen und Fensterputzen dürfen aber auch nicht der Lebensmittelpunkt werden«, betonte der Vater. »Es gibt viel interessantere Dinge, Theresa.«
»Euer Glück ist, dass ihr mich habt«, wiederholte die Mutter und trug die Brombeeren in die Küche.
»Komm, Enid, wir schauen jetzt gleich in der Enzyklopädie nach, was Arthur Mee über Goldammern und den Dartford Warbler schreibt«, schlug Thomas Blyton vor, und wenig später lagen Enid und er vor dem Bücherregal im Wohnzimmer auf dem Boden und blätterten im dicken Lexikon.
Er bewundere den Herausgeber, murmelte der Vater, während er vorlas und umblätterte.
Was so Besonderes an diesem Mann sei, fragte Enid.
»Er erklärt Kindern die Welt. Glaub mir, Enid, das ist das Schwerste von allem.«
»In den Enzyklopädie-Bänden steht alles, was man wissen muss?«
Ungefähr so sei es, bestätigte Thomas Blyton.
»Dann brauchen wir doch gar nicht so viele andere Bücher.« Enid sah an den Regalen hoch, in denen sich Hunderte von Buchrücken aneinanderdrängten.
»Kein Buch kann alles, Enid«, sagte er. »Für sich allein ist jedes Buch zu wenig. Du brauchst sie daher alle.«
»Wirklich alle?«
»Wir haben unseren Geist, unseren Verstand, um die Welt zu erkunden. Das ist unsere Aufgabe im Leben.« Der Vater dachte nach und fügte hinzu: »Durch Lesen und Reisen kannst du lernen, die Welt zu verstehen.«
»Und wenn ich sie verstanden habe, was ist dann, Daddy?«
»Es gibt kein Ende, Enid.« Thomas Blyton lächelte jetzt. »Je mehr du weißt, desto neugieriger wirst du.«
Carey und Hanly spielten im Kinderzimmer mit ihren Bleisoldaten, und das war Enid nur recht. So störten sie sie nicht bei der Unterhaltung mit dem Vater, der morgen früh ja wieder für den ganzen Tag zur Arbeit verschwinden würde. Insofern war jede Stunde mit ihm kostbar.
Chippy, mein Chippy, und die wilden Bären
Beckenham, Sommer 1907
Gegen Abend dieses heißen Ferientages war Enid allein unterwegs und sammelte wieder einmal Brombeeren. Der Korb war beinahe voll, als sie eine Pause einlegte. Sie setzte sich in den Sand und packte die Verpflegung aus, die das Hausmädchen Annie ihr mitgegeben hatte. Der Tee in der Feldflasche tat gut und belebte Enid.
Plötzlich stand der junge Kater neben ihr und maunzte. Er war rotweiß getigert und mager, noch nicht ausgewachsen, ein Kind wie sie. Die schönste Katze, die sie je gesehen hatte. Ein paar Momente lang war sie fassungslos vor Glück. Hatte sie nicht seit Jahren schon auf ihn gewartet?
Enid brach ein Stück von ihrem zusammengeklappten Sandwich auf und warf es zu dem kleinen Tier hinüber. Wie ausgehungert es war! Es kam ganz nahe und fraß weitere Brocken.
Er konnte nur Chippy heißen, und so hungrig, wie er war, schien er niemandem zu gehören. »Mein Chippy«, murmelte Enid und streichelte über seinen knochigen Rücken. Das Tier hielt still unter der Berührung und gab zufriedene Laute von sich.
Blitzschnell überlegte Enid. »I want him for mine«, flüsterte sie. Daddy musste doch verstehen, dass sie Chippy behalten wollte. Vielleicht konnte er ja Mummy überzeugen, Chippy als Hauskater zu akzeptieren. Sicher würde er alle Mäuse fressen. Und sie, Enid, würde ein Auge darauf haben, dass er keinen Schmutz im Haus machte. Ja, sie würde Mummy sogar helfen, die Möbel abzubürsten und unter den Schränken zu fegen. Sie würde sich Mühe geben, ihr bei der Hausarbeit beizustehen. Mummy würde sich überhaupt nicht mehr über sie beschweren müssen, wenn Enid nur Chippy behalten durfte. Wie schön das Leben sein würde, wenn er erst bei ihnen durch das Haus lief! Auf dem Sofa würde er liegen und zuhören, wenn Daddy auf dem Banjo spielte und sang ... Alles würde sie für Chippy tun. Also klaglos Geschirr abspülen, abtrocknen und in die Schränke räumen. Bügeln, Staub wischen, alles, was Mummy von ihr verlangte. Schuhe putzen, Möbel polieren, das Silber putzen, damit Mummy endlich zufrieden war.
Sie schüttete die Brombeeren aus dem Korb und lockte Chippy mit dem Rest des Sandwichs. Schließlich lag er im Korb, und Enid trug ihn nach Hause.
Der Mutter ging es nicht gut. Sie lag mit Kopfschmerzen im Bett. Carey und Hanly waren mit dem Vater zu Besuch bei Tante May.
Annie hatte gerade die Küche durchgeputzt. »Leg die Brombeeren auf den Tisch vor dem Fenster, Enid, damit die Maden über Nacht rauskriechen können«, sagte sie und drehte sich zu Enid um. »Ah«, rief sie dann und starrte in den Korb, in dem Chippy zufrieden lag und Annie einen langen Blick aus grünen Kateraugen zuwarf. »Der ist wirklich schön.«
Schweigend standen die beiden eine Zeit lang da und betrachteten Chippy. »Die Madam wird die Katze sofort aus dem Haus jagen«, sagte Annie dann.
»Aber –«
»Nein, Enid. Du bekommst nur Ärger. Außerdem hat deine Mummy Kopfschmerzen. Dann geht gar nichts, das weißt du doch.«
»Aber Daddy wird Chippy mögen –«
»Wenn deine Mummy Kopfschmerzen hat, erlaubt er dir schon gar nicht, dass du Unsinn machst.«
»Chippy ist kein Unsinn«, widersprach Enid.
»Chippy ist eine Katastrophe. Er muss fort. So schnell wie möglich.«
Enid weinte nicht, sie dachte fieberhaft nach. Irgendeine Lösung musste es doch geben. »Ich kann ihn nicht auf die Straße setzen, Annie. Er gehört zu mir.«
»Doch, Enid. Das musst du jetzt tun, ehe dein Vater zurückkommt mit den Jungs.«
»Aber Daddy würde es erlauben, wenn –«
Annie war anderer Meinung. »Nein. Er wird sehr böse werden. Weil es deiner Mummy so schlecht geht.«
»Hör zu«, begann Enid, »ich tue alles, was Mummy und Daddy wollen. Ich werde jeden Tag zwei Stunden Klavier üben und das Geschirr abspülen und Teetücher bügeln.«
»In ein gepflegtes Haus passt eine Katze einfach nicht hinein. Wir sind kein Bauernhaushalt, Enid.«
»Aber was ist denn so schlimm an Chippy?«
»Eine Katze verliert jeden Tag Haare. Dann muss man jeden Teppich ausklopfen und Sofa und Sessel abbürsten.«
Das werde alles sie übernehmen, beteuerte Enid und brach in Schluchzen aus.
»Und außerdem ruiniert ein Kater den Garten. Er würde nur über die schönen Veilchen rennen und die Beete ruinieren.«
»Hört endlich auf mit dem Gezanke«, rief Theresa Blyton mit schwacher Stimme vom Schlafzimmer her.
»Um Himmels willen,« Annie bekam es jetzt mit der Angst zu tun. »Komm, Enid, raus in den Garten.«
Und so geschah es, dass Kater Chippy in das Gartenhaus am Ende des Grundstücks der Blytons einzog. Eine Schale mit verdünnter Milch und eine halbe Frikadelle wurden ihm hingestellt. Enid holte ihr Puppenbett herbei, damit er gut und weich schlafen konnte.
»Pass nur auf, dass deine Mummy ihn nicht sieht«, seufzte Annie. Sie hatte ein gutes Herz, fürchtete sich aber vor der strengen Madam. Am Ende würde die sie noch entlassen. »Und – ich weiß von gar nichts. Ist das klar, Enid?«
~
Nur zwei Wochen dauerte Enids Katerglück. Die Ferien waren vorüber, die Schule begann wieder, und nichts war für Enid so schön, wie nach Hause zu kommen, zum Gartenhaus am Ende des Grundstücks zu laufen und Chippy zu begrüßen. Doch dann kam der Tag, an dem Theresa Blyton auf der Suche nach einem alten Putzeimer die Katze mitsamt dem Puppenbett und dem Milchschälchen entdeckte. Annie musste ihr nichts erklären, Enids Mutter erfasste die Situation mit zwei Blicken. »Dieses Mädchen macht mich noch wahnsinnig«, sagte sie nur.
Der Kater wurde in einen Koffer gepackt, den Annie mehrere Busstationen weit fortbringen musste, um Chippy dann am Waldrand auszusetzen.
Als Enid von der Schule kam, war Chippy schon fort. »Wo ist er?«, schrie Enid.
»Ich darf es dir nicht sagen«, antwortete Annie nur und presste die Lippen zusammen.
»Mummy hat ihn umgebracht!« Enid war außer sich und konnte sich nicht beruhigen.
»In ein gepflegtes Haus passt nun mal kein Haustier«, erklärte Thomas Blyton am Abend mit erhobener Stimme.
»Warum nicht?« Enid nahm einen letzten Anlauf. Vielleicht konnte sie Chippy doch noch retten. Vielleicht würde Annie ihn zurückholen.
»Hast du Katzen, hast du Flöhe«, antwortete der Vater. Katzen pflegten auf dem Boden zu liegen und zögen Flöhe an.
»Ungeziefer im Haus, das ist der Horror«, pflichtete die Mutter bei. »Und dann überall die Tierhaare. So viel bürsten und fegen kann man gar nicht.«
Thomas Blyton trat mit seiner Tochter vor die Bücherregale. »Noch etwas, warum ich kein Tier im Haus haben möchte.« Enid wollte es nicht hören, aber ihr Vater hielt sie an der Hand, während er sprach: »Schlimmer als Flöhe ist der Tod. Wenn du einen Hund oder eine Katze hast oder einen Hasen –«
»Oh, ja, einen Hasen«, jammerte Enid.
»Nein, Kind. Sie leben nicht so lange wie wir. Nach kurzer Zeit sterben sie, und das würdest du nicht ertragen.«
»Ich würde es schon aushalten. Oh, Daddy, bitte. Ich will Chippy zurückhaben.«
Des Vaters Gesicht war plötzlich hart und kalt.
»Daddy!«, flehte Enid. »Ich spüle jeden Tag Geschirr ab und werde doppelt so lange Klavier üben. Alles werde ich tun, wenn ich Chippy nur behalten darf.«
Er wolle kein Wort mehr von Chippy hören, sagte Thomas Blyton. Er habe Nein gesagt und Nein gemeint. »Hast du das verstanden, Enid?«
Vor Weinen konnte Enid kaum noch atmen. Mummy war schuld, nur sie. Oh, wie sie diese Frau hasste! Sie hatte ihren lieben Chippy umgebracht!
»Wo ist sein Grab?«, schrie Enid am nächsten Morgen Annie entgegen, die ihr den Tee an den Tisch brachte.
»Was für ein Grab?«
»Das von Chippy.«
»Ich darf nichts sagen«, stammelte Annie und wurde rot und blass.
»Ich hasse euch alle. Das verzeihe ich Mummy niemals. Nie im Leben.«
»Reg dich nicht so auf, Enid. Es gibt Schlimmeres auf der Welt.«
»Wenn ich achtzehn bin, ziehe ich aus und komme nie wieder.«
»Wenn du so alt bist, hast du ganz andere Sorgen. Dann ist der dumme Kater lange vergessen.«
Annie setzte sich neben Enid und schenkte sich ebenfalls Tee ein. Dieses Mädchen war zu leidenschaftlich, zu heftig. Enid wollte zu viel. Annie verglich sich in Gedanken mit der Tochter der Blytons. Mit Annie war niemand ins Theater gegangen oder ins Weihnachtsmärchen. Früh hatte sie Geld verdienen müssen in fremden Häusern, wo man sie ausgeschimpft hatte und wo sie bis in die Nacht hatte plätten und putzen müssen. Jetzt, fand sie, ging es ihr nicht schlecht im Haushalt der Blytons, bei denen sie fast wie ein Familienmitglied behandelt wurde. Die Madam war streng, aber gerecht.
»Es ist nur ein Kater«, fing Annie wieder an.
»Kein Mensch auf der Welt versteht mich!«, schluchzte Enid auf.
~
Unten im Wohnzimmer spielte der Vater Klavier, Chopin, die gleichen Stücke wie am Abend zuvor, und die Mutter strickte. Enid lag im Bett, lauschte und wartete auf die Gedanken, die ganz von selbst zu ihr kamen ...
Da war das wilde Mädchen mit dem kurz geschnittenen Haar in den Shorts, der Tomboy. Es war zugleich sie selbst und der Schiffsjunge auf dem Segelschiff. Und dann war da der Sturm, durch den sie sich kämpften. Das Schiff schlingerte durch die Wellen. »Wir schaffen es nicht«, schrie der Kapitän aus der Dunkelheit. Alle Matrosen schöpften mit Eimern Wasser und schütteten es über die Reling. Doch ihre Mühen waren vergeblich. Das Schiff sank. Sie, zugleich der Schiffsjunge George, klammerte sich an den Hund Waldo, und jetzt gab es kein Schiff mehr. Sie und Waldo kämpften sich schwimmend durch Wellenberge. Da war eine lange Holzplanke. An der hielt George sich fest, Waldo neben ihr. Es war unglaublich kalt. Sie wollte nicht sterben. Das Meer wurde allmählich ruhiger, die Wolken am Himmel hatten sich aufgelöst, und da war auch schon die Küste zu sehen. Ganz nah war sie. George umklammerte die Holzplanke und spürte plötzlich festen Boden unter den Fußsohlen. Sie und Waldo waren gerettet. Das war der Moment, als zwei riesige Bären am Ufer auftauchten und auf sie zustürmten. George wollte schreien, doch kein Laut drang aus ihrer Kehle. Und auch Waldo stand vor Schrecken erstarrt neben ihr. Die Bären setzten zum Sprung auf sie an. Es gab keine Rettung ...
Zitternd und schweißgebadet erwachte Enid. In seinem Kinderbett neben ihr schnarchte der kleine Carey. Der Vater spielte noch immer auf dem Klavier. Alles war wieder gut.
Warum nur träumte sie neuerdings immer von diesen wilden Tieren? Warum tauchten die Bären plötzlich auf und wollten sie angreifen? Eigentlich waren Bären doch nette, drollige Gesellen, jedenfalls die, die sie im Zoo gesehen hatte.
Im Laufe des Tages vergaß Enid den Traum, aber am Abend, als sie im Bett lag, war die Angst plötzlich da. Die grauenhaften Bestien würden wiederkommen, und diesmal konnte sie ihnen nicht entkommen. Sie durfte auf keinen Fall einschlafen. Enid versuchte, wach zu bleiben. Wenn sie im Traum eine Waffe hätte, überlegte sie und verlor gleich wieder den Mut. Die Bären waren so stark und groß, und sie war ein dünnes Kind, George, der Schiffsjunge. Aber George war ein kluger Junge, ihm fiel immer etwas ein, um sich und andere zu retten. Und plötzlich hatte sie einen Plan für die Bären. Wenn sie wiederkamen, wollte sie ihnen entgegengehen, die Hand ausstrecken und sie freundlich begrüßen.
Und dann war sie auch schon mitten in ihrem Traum: Aus dem Gebüsch brachen die beiden Bären hervor, Enid packte die Furcht aufs Neue. Aber sie erinnerte sich trotzdem noch an ihren Vorsatz. So groß ihr Schrecken auch war, sie streckte den Angreifern die Hand entgegen und brachte mit Mühe die Worte hervor: »Schön, dass ihr gekommen seid.« Die Bären machten vor ihr Halt und hoben die Pfoten zu einer feierlichen Begrüßung. Der eine der beiden zwinkerte ihr zu. Und damit war der Traum beendet. Enid schlief ruhig und tief bis zum Morgen.
Sie war stolz und froh. Abends, als ihr Vater nach Hause kam, erzählte sie ihm zum ersten Mal von den Traumbären, von ihrer Angst vor ihnen, und wie sie sie bezähmt hatte.
Thomas Blyton nickte, während er zuhörte. »Das hast du gut gemacht, alter George«, sagte er dann. »Betrachte es als eine Lehre für dein weiteres Leben. Wenn dich etwas ängstigt, dann laufe nicht fort, Enid, sondern tritt ihm mutig entgegen. Das ist meistens die Lösung.« Oft fürchte man sich vor etwas, was bei näherem Hinsehen gar nicht so schwierig sei.
Zu Besuch bei den Großeltern
Sheffield, Dezember 1907
An Weihnachten fuhr Thomas Blyton mit der ganzen Familie im Zug nach Sheffield, wo seine Eltern wohnten, um ein paar Tage mit ihnen, seinen Geschwistern und ihren Familien zu verbringen. Auch zu besonderen Festtagen wurde die lange Reise angetreten. Für die Kinder war schon die Fahrt ein großes Vergnügen.