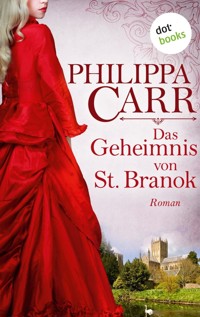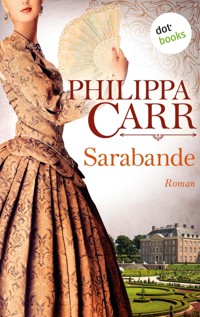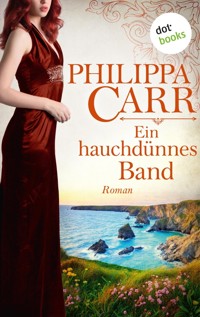Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über 1.700 Seiten fesselndes Lesevergnügen – die große Saga »Die Töchter Englands: Sehnsuchtsjahre« von Philippa Carr jetzt als eBook bei dotbooks. Sie sind voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft und stark genug, um jedem Sturm der Geschichte zu trotzen – von Generation zu Generation … England im 17. Jahrhundert: Auf dem Landsitz ihrer Familie führt die schöne Priscilla ein unbeschwertes Leben, bis sie sich das erste Mal verliebt. Doch die Nacht mit dem Mann, den sie niemals heiraten darf, bleibt nicht ohne Folgen – und ein uneheliches Kind würde Priscillas Ruf zerstören. Mutig spinnt sie einen gewagten Plan, nicht ahnend, in welche Gefahr sie damit sich und ihre ungeborene Tochter bringen wird … Viele Jahre später müssen auch Priscillas Nachfahrinnen Clarissa, Jessica und Annora alles riskieren für ihr Glück – aber bedeutet dies etwa auch, dass sie der Liebe entsagen müssen und den Männern, zu denen sie sich unendlich hingezogen fühlen? Bewegend, dramatisch, romantisch – vier Romane der international erfolgreichen Saga »Die Töchter Englands« erstmals in einem Sammelband: Bestsellerautorin Philippa Carr verwebt große historische Ereignisse mit den Lebensgeschichten starker Frauenfiguren zum mitreißenden Lesevergnügen! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Töchter Englands: Sehnsuchtsjahre« von Philippa Carr, auch bekannt als Jean Plaidy und Victoria Holt, ist der zweite Sammelband der Serie. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2154
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie sind voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft – und stark genug, um jedem Sturm der Geschichte zu trotzen, von Generation zu Generation … Frankreich im Jahr 1658: Die Schreckensherrschaft Oliver Cromwells zwang die junge Arabella Tolworthy, aus England zu fliehen. Halt bieten ihr in der Fremde nur ihre beste Freundin Harriett und vor allem der charismatischen Edwin Eversleigh, für den Arabella zarte Gefühle hegt. Als sich für die drei plötzlich eine Möglichkeit bietet, in ihre geliebte Heimat zurückzukehren, weiß Arabella, dass sie nicht zögern darf – obwohl sie dafür einen hohen Preis bezahlen könnte … Jahre später riskieren auch die mutigen Engländerinnen Priscilla, Carlotta, Damaris und Clarissa alles für ihr Glück – aber bedeutet dies am Ende, dass sie der Liebe entsagen müssen und den Männern, zu denen sie sich unendlich hingezogen fühlen?
Über die Autorin:
Philippa Carr ist – wie auch Jean Plaidy und Victoria Holt – ein Pseudonym der britischen Autorin Eleanor Alice Burford (1906–1993). Schon in ihrer Jugend begann sie, sich für Geschichte zu begeistern: »Ich besuchte Hampton Court Palace mit seiner beeindruckenden Atmosphäre, ging durch dasselbe Tor wie Anne Boleyn und sah die Räume, durch die Katherine Howard gelaufen war. Das hat mich inspiriert, damit begann für mich alles.« 1941 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem in den nächsten 50 Jahren zahlreiche folgten, die sich schon zu ihren Lebzeiten über 90 Millionen Mal verkauften. 1989 wurde Eleanor Alice Burford mit dem »Golden Treasure Award« der Romance Writers of America ausgezeichnet.
Eine Übersicht über den Romanzyklus »Die Töchter Englands« finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe Juli 2019, April 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, Münchenn
Die englische Originalausgabe von »Das Licht und die Finsternis« erschien erstmals 1979 unter dem Originaltitel »Lament for a lost Lover«. Copyright © der englischen Originalausgabe 1979 by Philippa Carr. Copyright © der deutschen Erstausgabe 1984 by Franz Schneekluth Verlag, München. Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Die venezianische Tochter« erschien 1978 unter dem Titel »The Love Child«. Copyright © der Originalausgabe 1978 by Philippa Carr. Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1986 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München. Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München.
Die englische Originalausgabe von »Die Halbschwestern« erschien 1977 unter dem Titel »The Song of the Siren«. Copyright der Originalausgabe © 1977 by Philippa Carr. Copyright für die deutschsprachige Erstausgabe © 1985 by Franz Schneekluth Verlag, München. Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Die Dame und der Dandy« erschien 1981 bei William Collins Sons & Co. Ltd., London, unter dem Titel »The Drop of the Dice«. Copyright © der Originalausgabe 1981 by Philippa Carr. Copyright © der deutschen Erstausgabe 1982 Paul Neff Verlag, Wien. Copyright © der Neuausgabe 2017 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: HildenDesign unter Verwendung eines Bildmotivs von HildenDesign/shutterstock.com.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-98690-355-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie werden in diesem Roman möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen begegnen, die wir heute als unzeitgemäß und diskriminierend empfinden, unter anderem dem Begriff »Zigeuner«.
»Zigeuner« ist die direkte Übersetzung des im englischen Originaltext verwendeten Begriffs »Gypsy«, und es ist nicht möglich, dieses Wort in Titel und Text durch die heute gebräuchlichen Eigenbezeichnungen »Sinti und/oder Roma« zu ersetzen, weil sie inhaltlich nicht passen würden. Zur Handlungszeit im frühen 19. Jahrhundert war »Zigeuner« die gängige Fremdbezeichnung für die Sinti und Roma, wobei dieser Begriff seit dem 18. Jahrhundert vielerorts mit einem zunehmenden stigmatisierenden Rassismus verbunden war. Die Sinti und Roma lehnen die Bezeichnung »Zigeuner« daher heute zu Recht ab.
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt und von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Philippa Carr hat keinen Roman im Sinne der völkisch rassifizierten Nazi-Nomenklatur geschrieben, sondern verwendet Begrifflichkeiten so, wie sie aus ihrer Sicht zu der Zeit, in der ihr Roman spielt, verwendet wurden; Klischees werden hier bewusst als Stilmittel verwendet. Keinesfalls geht es in diesem fiktionalen Text aber um rassistische Zuschreibungen oder die Verdichtung eines aggressiven Feindbildes.
Es ist dotbooks wichtig, zu betonen, dass wir uns gegen die Verwendung des Begriffes »Zigeuner« im aktuellen Sprachgebrauch und gegen Diskriminierung jedweder Art aussprechen.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sehnsuchtsjahre« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Philippa Carr
DIE TÖCHTER ENGLANDSSehnsuchtsjahre
Vier Romane in einem eBook
dotbooks.
Das Licht und die Finsternis
Aus dem Englischen von Karl-Otto und Friderike von Czernicki
Frankreich im Jahr 1658. Wie so viele andere Königstreue musste auch ihre Familie vor der Schreckensherrschaft Oliver Cromwells aus England fliehen – und doch hat die junge Arabella Tolworthy in der Fremde ihr Glück gefunden: Ihre beste Freundin Harriet, deren ungestümes Wesen die beiden immer wieder in Schwierigkeiten bringt, und vor allem den charismatischen Edwin Eversleigh, für den Arabella zarte Gefühle hegt. Als sich für die drei eine Möglichkeit bietet, in ihre geliebte Heimat zurückzukehren, zögern sie nicht … aber sie bezahlen einen hohen Preis dafür. Als Arabella am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen zu sein scheint, wäre es so leicht, einfach aufzugeben – und trotzdem ist die englische Rose nicht bereit, sich in ihr Schicksal zu fügen!
EXIL
Kapitel 1Eine Wanderbühne in Congrève
Obwohl ich es damals noch nicht wissen konnte, sollte der Tag, an dem Harriet Main in unsere Familie kam, zu einem der bedeutungsvollsten in meinem Leben werden. Daß Harriet eine bemerkenswerte, starke Persönlichkeit war, eine Frau, mit der man zu rechnen haben würde, daran bestand kein Zweifel. Es schien irgendwie seltsam, daß sie, wenn auch nur für kurze Zeit, die Stellung einer Erzieherin übernehmen sollte. Gouvernanten geben sich gewöhnlich bescheiden, sind stets darauf bedacht, nichts falsch zu machen. Sie leben in steter Sorge, ihre Stellung zu verlieren, und werden deshalb oft ausgenutzt.
Gewiß, es waren außergewöhnliche Zeiten. Die Revolution hatte zu tiefgreifenden Veränderungen in England geführt, alles ging dort, wie wir gelegentlich hörten, drunter und drüber. Wir lebten nun hier in Frankreich, fern unserer Heimat, und waren auf die Hilfe von Freunden angewiesen. Wenn auch der Gedanke, daß unser König das Exil mit uns teilte, tröstlich war, so half er uns doch nicht aus den Schwierigkeiten.
Wir schrieben das Jahr 1658. Schon sieben Jahre war es her, daß ich mit meinen Eltern aus England geflohen war. Inzwischen war ich siebzehn geworden, hatte mich auch allmählich an das neue Leben gewöhnt, wenngleich viele Erinnerungen an die Heimat in mir noch lebendig waren und ich meinen jüngeren Geschwistern gern von den vergangenen Tagen in England erzählte.
Es wurde soviel von jener Zeit gesprochen und davon, wann sie wohl wiederkehren würde, so daß sie zum beherrschenden Thema unseres Lebens geworden war. Niemand schien daran zu zweifeln, daß alles wieder so werden würde, wie es einmal gewesen war. Auch die Kleinen wurden nicht müde, sich die Geschichten immer wieder anzuhören, denn man redete ja nicht nur von der Vergangenheit, sondern gleichzeitig auch von der Zukunft.
Bersaba Tolworthy, meine Mutter, war eine Frau mit festen Grundsätzen. Sie war Ende Dreißig, sah aber viel jünger aus. Sie war nicht im eigentlichen Sinne hübsch, besaß aber eine Vitalität, die sie anziehend machte. Mein Vater betete sie an, sie bedeutete ihm alles. Und von den Kindern hatte er mich am liebsten.
Meine Mutter führte ein Tagebuch. Sie erzählte mir, ihre Mutter habe ihr und ihrer Schwester Angelet zum siebzehnten Geburtstag ein Tagebuch geschenkt und gesagt, es sei Familientradition, daß die Frauen alle Ereignisse niederschrieben. Diese Bücher würden dann gemeinsam in einer Truhe aufbewahrt. Meine Mutter hoffte, ich würde diese Sitte einmal übernehmen. Ich fand den Gedanken faszinierend, vor allem auch deshalb, weil die Tagebücher bis auf meine Urururgroßmutter Damask Farland zurückgingen, die zur Zeit Heinrichs VIII. gelebt hatte.
»In diesen Tagebüchern ist nicht nur das Leben deiner Vorfahren beschrieben, sondern du erfährst auch etwas über die Ereignisse, die für unsere Heimat von Bedeutung waren«, erklärte meine Mutter. »Wenn du es liest, wirst du verstehen, warum deine Ahnen so und nicht anders gehandelt haben.«
Irgend etwas Geheimnisvolles war um meine Geburt, und meine Mutter glaubte, ich würde alles besser verstehen, wenn ich genau wüßte, wie es sich zugetragen hat. So gab sie mir ihre Tagebücher zum Lesen, als ich sechzehn war. Dabei sagte sie: »Du bist mir sehr ähnlich, Arabella. Du bist rasch erwachsen geworden, und du weißt, daß du nicht den gleichen Vater hast wie Lucas, aber den gleichen wie die Kleinen. Das könnte dir seltsam vorkommen, und ich möchte nicht, daß du glaubst, du gehörtest nicht zu Vater. Lies die Tagebücher, dann wirst du verstehen, wie alles kam.«
Ich las also von meinen Vorfahren mütterlicherseits, von der sanftmütigen Damask, von Linnet und Tamsyn, von der wilden Catharine und meiner Mutter Bersaba, und je länger ich las, desto klarer wurde mir, warum mir meine Mutter diese Tagebücher übergeben hatte. Sie vermutete etwas von Catherine und ihr selbst in mir. Wäre ich wie die anderen und wie ihre Zwillingsschwester, meine Tante Angelet, gewesen, hätte sie vielleicht gezögert.
So erfuhr ich von dem heimlichen, stürmischen Liebesverhältnis zwischen meiner Mutter und meinem Vater, als dieser noch mit Angelet verheiratet war. Erfuhr, daß meine Mutter kurz vor meiner Geburt Luke Longridge heiratete und daß aus dieser Ehe mein Stiefbruder Lucas stammte, der knapp zwei Jahre jünger als ich war. Luke Longridge war bei Marston Moor gefallen, und Angelet war gestorben, als ihr Kind auf die Welt kam, aber es vergingen noch Jahre, bis sich mein Vater und meine Mutter für immer fanden. Inzwischen war die Sache der Royalisten, für die mein Vater gekämpft hatte, verloren, Karl I. war hingerichtet worden, und Karl II. hatte einen verzweifelten, aber vergeblichen Versuch unternommen, den Thron zu besteigen. Der König war nach Frankreich geflohen, und meine Eltern hatten sich mit Lucas und mir den Flüchtlingen angeschlossen, die England verließen.
Sie hatten noch drei Kinder bekommen: Richard, der den Namen meines Vaters erhielt, aber immer Dick genannt wurde, damit es nicht zu Verwechslungen kam; Angelique, deren Name an Angelet, so hatte ja die Zwillingsschwester meiner Mutter geheißen, anklang; und Fenn – Fennimore –, so benannt nach Vater und Bruder meiner Mutter. Das also war unsere Familie, die in der Fremde ein Flüchtlingsdasein führte und jeden Tag auf die Nachricht aus England wartete, daß das Volk der puritanischen Herrschaft überdrüssig sei und den König wiederhaben wolle. Dann wollten wir, als überzeugte Royalisten, mit ihm zurückkehren.
»Diese Kriege sind eine Pest«, pflegte meine Mutter zu sagen, »ich würde mich am liebsten auf die Seite desjenigen stellen, der den anderen in Frieden leben läßt.« Aus ihrem Tagebuch war mir bekannt, daß Lucas' Vater ein Anhänger Cromwells gewesen war, und sicherlich wurde sie durch ihren Sohn manchmal daran erinnert. Aber die Liebe ihres Lebens war mein Vater, so wie sie die seine war, und ich wußte, daß sie stets auf seiner Seite stehen würde, wofür er sich auch entscheiden mochte. Waren sie in unserer Gegenwart beisammen, und das war nicht oft der Fall, denn Vater war ein großer General und mußte seinem König überallhin folgen, jederzeit bereit, ihm bei der Wiedergewinnung des Thrones beizustehen, waren ihre Gefühle füreinander nicht zu übersehen.
»Wenn ich einmal heirate«, sagte ich zu Lucas, »dann möchte ich, daß mein Mann zu mir so ist, wie unser Vater zu unserer Mutter.«
Lucas gab keine Antwort darauf. Er wußte nicht, daß wir nicht denselben Vater hatten und konnte sich an seinen Vater nicht mehr erinnern. Außerdem hieß er auch Tolworthy, obwohl er als Longridge auf die Welt gekommen war. Lucas haßte den Gedanken, ich könnte einmal heiraten. Und obwohl ich ihn herumkommandiert hatte, als er noch klein war, sagte er oft, er werde mich heiraten.
Ich besaß ein dominierendes Wesen, und Lucas sagte immer, daß die Kleinen vor mir mehr Angst hätten als vor unseren Eltern.
Dabei wollte ich nur, daß alles in geregelten Bahnen verlief – das heißt, daß alles so war, wie ich es gern wollte. Und da wir viel allein waren – wenn mein Vater verreiste, begleitete ihn meine Mutter meistens –, fühlte ich mich als Familienoberhaupt. Diese Rolle fiel mir, da ich die Älteste war, von selbst zu; denn obwohl ich nur knapp zwei Jahre älter war als Lucas, bestand doch ein weit größerer Altersunterschied zwischen Lucas und mir und den Kleinen.
Ich konnte mich noch gut an die Zeit erinnern, als wir nach Frankreich gefahren waren, und auch noch an die Zeit davor; denn ich war damals ja schon zehn Jahre alt. Ich habe noch vage Vorstellungen von Far Flamstead, und ich erinnere mich noch an die Angst, die ich in dem Haus hatte, als wir jeden Augenblick mit der Ankunft der Soldaten rechnen mußten. Ich kann mich noch entsinnen, wie ich mich vor ihnen versteckte und wie ich die Sorgen der Erwachsenen spürte. Dann entsinne ich mich an ein neues Baby und daran, daß Tante Angelet in den Himmel kam, wie man mir sagte. Und ich erinnere mich, wie wir eine nicht enden wollende Reise nach Trystan Priory zu meinen Großeltern antraten, dieser Ort, der mir noch deutlich in Erinnerung geblieben ist, obwohl inzwischen schon sieben Jahre vergangen sind. Meine gemütliche Großmutter, mein gütiger Großvater, mein Onkel Fenn – ganz lebendig sehe ich sie vor mir. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Vetter Bastian von Castle Paling herübergeritten kam und immer versuchte, mit meiner Mutter allein zu sein.
Dann änderte sich plötzlich alles: Mein Vater kam. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er war groß und mächtig und hätte einem Angst einflößen können, aber ich fürchtete mich nicht vor ihm. Meine Mutter hatte einmal gesagt: »Wenn du Angst hast vor jemandem, dann sieh ihm direkt ins Gesicht, und du wirst plötzlich merken, daß es überhaupt nichts zu fürchten gibt.« Und so sah ich diesem Mann geradewegs ins Gesicht, und ich merkte schon bald, daß er mich in sein Herz geschlossen hatte. Ja, er schien über meine Existenz ganz besonders glücklich zu sein.
Ich wäre gern in Trystan und bei meinen Großeltern geblieben, und ich wußte, daß sie über unseren Abschied sehr traurig waren, obwohl sie versuchten, es sich nicht anmerken zu lassen. Doch dann waren wir auf dem Meer, in einem kleinen Boot, und das war höchst unangenehm.
Aber schließlich kamen wir in Frankreich an und wurden von vielen Menschen begrüßt. Ich wurde in einen Mantel gehüllt und ritt mit jemandem hoch zu Roß durch die Dunkelheit nach Château Congrève. Und dort bin ich seither geblieben.
Château Congrève! Das klingt zwar großartig, aber eigentlich verdiente das Haus die Bezeichnung Château gar nicht. Es ist mehr ein großes, weitläufiges Bauernhaus als ein Schloß, obwohl es kleine Türmchen an den vier Ecken hat und ein flaches Dach mit Schießscharten. Die Räume sind hoch, die Steinmauern dick, und im Winter ist es sehr kalt.
Das umliegende Weideland wird von der Familie Lambard genutzt, sie wohnt in Katen in der Nähe und versorgt uns mit Fleisch, Brot, Butter, Milch und Gemüse.
Château Congrève wurde uns – einschließlich zweier Dienstmädchen und einem Mann, die sich um uns kümmern sollten – von einem Freund meines Vaters zur Verfügung gestellt. Es sollte als Zufluchtsort für unsere Familie dienen, bis wir nach England zurückkehren konnten. »Wir müssen dankbar dafür sein«, sagte meine Mutter, »Bettler haben keine Wahl.« Und in Anbetracht der Tatsache, daß wir nur einige wenige Habseligkeiten hatten mitnehmen können, kamen wir uns tatsächlich wie Bettler vor.
Aber es ließ sich in dem Haus gut leben. Lucas und ich interessierten uns sehr für die Schweine in den Ställen, für die Ziegen, die auf den Feldern angebunden waren und für die Hühner, die den Hof als ihr Eigentum beanspruchten. Die Lambards – Vater, Mutter, drei kräftige Söhne und eine Tochter – waren sehr freundlich zu uns. Sie liebten die Kleinen und verwöhnten sie, wo sie nur konnten.
Unsere Mutter wohnte mit uns im Château, wenn ihre Kinder geboren wurden, und das waren herrliche Zeiten, obwohl ich wußte, daß sie sich ständig um Vater sorgte. Er gehörte ja zum Gefolge des Königs, und niemand wußte genau, wo sich dieser gerade aufhielt. Sobald sie also einen Säugling unbesorgt in unserer Obhut lassen konnte, verließ uns unsere Mutter wieder, um bei Vater zu sein.
Sie hatte es mir erklärt und gesagt, ich solle es auch den anderen erklären. »Hier im Château Congrève seid ihr in Sicherheit und gut aufgehoben. Aber euer Vater muß in der Nähe des Königs sein und niemand weiß, wohin der König fahren wird. Dein Vater braucht mich, Arabella. Und weil du hier bist, kann ich die Kinder unbesorgt unter deiner Aufsicht zurücklassen.«
Ich war begeistert, und ich war glücklich, weil ich wußte, daß die anderen auf mich angewiesen waren. Und ich versprach meiner Mutter, für alles zu sorgen.
So führten wir in Château Congrève ein ruhiges Leben. Wir hatten eine englische Gouvernante, die schon vor der Revolution als Lehrerin zu einer französischen Familie nach Frankreich gekommen war. Sie freute sich sehr, bei uns zu sein, und sie sollte, da wir sie zum damaligen Zeitpunkt nur schlecht bezahlen konnten, an jenem großen Tag, der mit Sicherheit kommen würde, ihren gerechten Lohn erhalten. Miss Black war mittleren Alters, groß, mager und gebildet. Sie war die Tochter eines Geistlichen und erzählte uns oft, wie froh sie wäre, England noch vor seiner Schande verlassen zu haben, und sie gelobte immer wieder, erst dann nach England zurückzukehren, wenn es dort die Monarchie wieder gäbe. Miss Black war ein großer Gewinn für uns. Sie lehrte uns Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein und Griechisch. Französisch lernten wir rasch. Sie brachte uns außerdem gute Manieren und die englischen Volkstänze bei.
Meine Mutter war sehr von ihr angetan und meinte, sie sei ein Segen für uns, und wir könnten uns glücklich schätzen, eine Frau wie Miss Black als Gouvernante zu haben. Lucas und ich nannten sie hinter ihrem Rücken den ›Segen‹. Wir hätten nie gewagt, es ihr ins Gesicht zu sagen, dazu hatten wir zu großen Respekt vor ihr.
Es gab lange, verträumte Sommertage. Jedesmal, wenn ich ein Huhn gackern höre oder den stechenden Geruch von Ziegen und Schweinen wahrnehme, werde ich sofort wieder in jene Tage von Congrève zurückversetzt, die, wie ich jetzt erkenne, zu den friedlichsten gehörten, die ich je erlebt habe. Manchmal dachte ich, das Leben würde immer und ewig so weitergehen, und wir würden alle alt und grau werden, bis der König seinen Thron zurückerobern könnte. Die Sonne schien immer für uns, und die Tage waren nie lang genug. Ich befand mich ständig in Hochstimmung und gab beim Spielen den Ton an. Es waren die kleinen Theaterszenen, die mir am meisten Spaß machten. So war ich Kleopatra, Genoveva und Königin Elisabeth, und ich war auch keineswegs abgeneigt, eine Männergestalt zu verkörpern, wenn es die Hauptrolle erforderte.
Der arme Lucas protestierte hin und wieder dagegen, aber da ich diejenige war, die entschied, was gespielt wurde, forderte ich die Hauptrolle immer für mich selbst. Ich weiß noch, wie Dick und Angie einmal jammerten, sie wollten nicht immer nur Sklaven sein. Die armen Kleinen – sie waren soviel jünger als Lucas und ich, daß wir es für eine Auszeichnung hielten, wenn sie überhaupt an unseren Spielen teilnehmen durften.
Die große Begeisterung für das Theaterspielen entging der ernsthaften Miss Black nicht, die aus allem eine Unterrichtsstunde zu machen versuchte, was uns wiederum gar nicht gefiel. Aber auf irgendeine Weise hatten wir sie sehr gern, sie gehörte irgendwie zu unserem Leben.
Es war eigentlich Miss Black, die mir den Gedanken eingab, ich müßte Schauspielerin werden. Also lernte ich lange Absätze von Shakespeare auswendig und ließ meine Geschwister unter meinen theatralischen Auftritten leiden. Während der langen Sommertage vergaßen wir unser Flüchtlingsdasein. Wir waren Piraten, Höflinge, Soldaten, wir erlebten herrliche Abenteuer. Und ich gab immer den Ton an.
»Du solltest manchmal zurücktreten und Lucas die Hauptrolle übernehmen lassen«, pflegte Miss Black zu sagen. Aber ich habe nie ihren Rat befolgt.
So vergingen die Jahre. Ab und zu kamen die Eltern zu uns, und das waren wunderschöne Tage.
Wenn Lucas und ich mit ihnen zusammen essen durften, hörten wir ihren Gesprächen zu. Immer wurde von irgendeinem Plan geredet, wie der König wieder in seine angestammten Rechte eingesetzt werden könne. Das Volk werde der puritanischen Herrschaft allmählich überdrüssig, es denke an die gute alte Zeit der Monarchie. »Bald ist es soweit«, sagten sie. Aber es geschah nichts, und das Leben in Château Congrève nahm seinen gewohnten Lauf. Wenn unsere Eltern dann wieder abgereist waren, ergriff uns alle eine trübselige Stimmung, aber schon bald fesselte uns irgendein neues Spiel und niemand sprach mehr von der Rückkehr nach England.
Eines Morgens erschien Miss Black nicht zum Frühstück. Als wir nach ihr sahen, fanden wir sie tot in ihrem Bett. Sie war ebenso still gestorben, wie sie gelebt hatte. Sie wurde auf dem in der Nähe des Château gelegenen Friedhof begraben, und jeden Sonntag legten wir Blumen auf ihr Grab.
Wir redeten noch viel von Miss Black und vermißten sie sehr. Einmal ertappte ich Lucas, wie er leise vor sich hin weinte, weil sie nicht mehr da war, und nachdem ich ihm vorgehalten hatte, er sei ein Heulpeter, kamen auch mir die Tränen.
Als meine Eltern bei ihrem nächsten Aufenthalt in Congrève vom Tod Miss Blacks erfuhren, waren sie entsetzt. »Die Kleinen müssen weiterhin Unterricht bekommen«, sagte meine Mutter. »Wir können sie nicht in Unwissenheit aufwachsen lassen. Meine liebste Arabella, du mußt jetzt dafür sorgen, daß dies nicht geschieht. Du mußt sie so unterrichten, wie Miss Black es getan hätte, bis wir eine neue Gouvernante gefunden haben. Und das wird bestimmt nicht einfach sein.«
Ich freute mich über meine neue Aufgabe und schmeichelte mir schon bald bei dem Gedanken, daß die Erziehung der Kinder keine solchen Einbußen erlitten hatten, wie meine Eltern es befürchteten. Ich spielte eine neue Rolle und bildete mir ein, sie gut zu spielen.
Es war ein dunkler Winternachmittag, als die Wanderbühne ankam. Ein starker Nordwind heulte ums Haus und drang durch alle Spalten und Ritzen. Wir hatten mitten in der Halle ein offenes Feuer gemacht. Das Château war höchst primitiv, und es hatte sich sicher nicht viel verändert seit den Tagen, als die Normannen in dieser Gegend ihre steinernen Festungen erbauten, zu denen auch Congrève gehörte. Ich stellte mir oft vor, wie die großen, blonden Wikinger damals mit polternden Schritten hier in diese Halle gekommen waren, sich um das Feuer gesetzt hatten und sich Geschichten über ihre wilden Abenteuer erzählten.
Es war schon dämmrig, als wir von Pferdegetrappel im Hof aufgeschreckt wurden.
In meiner Eigenschaft als Schloßherrin und mir meiner Stellung durchaus bewußt, rief ich Jacques, unseren Diener, und wies ihn an nachzusehen, was draußen los sei.
Als er in die Halle zurückkam, sagte er aufgeregt: »Es ist eine Wanderbühne. Die Leute bitten um Unterkunft für die Nacht, und sie werden für uns spielen, wenn wir ihnen zu essen geben.«
»Aber selbstverständlich«, rief ich, nun ebenso aufgeregt wie Jacques. »Sag ihnen, daß sie hier willkommen sind. Führ sie herein!«
Lucas war heruntergekommen, und ich flüsterte ihm zu, was los war. »Sie werden für uns spielen!« jubelte er, »wir werden ein richtiges Schauspiel sehen!«
Es waren ihrer acht, drei Frauen und fünf Männer. Ihr Leiter war ein bärtiger, untersetzter Mann mittleren Alters. Er nahm den Hut ab, als er mich sah, und verneigte sich tief. Er hatte freundliche Augen, die fast verschwanden, wenn er lächelte.
»Einen schönen Tag wünsche ich«, sagte er. »Ist wohl der Hausherr zu sprechen, oder die Hausherrin?«
»Ich bin die Herrin hier«, erwiderte ich.
Er schien verwundert über meine Jugend und meinen Akzent.
»Und mit wem habe ich die Ehre?«
»Ich bin Arabella Tolworthy«, antwortete ich. »Ich bin Engländerin. Meine Eltern sind bei unserem König, und ich wohne hier mit meinem Bruder«, ich wies auf Lucas, »und anderen Familienangehörigen, bis wir nach England zurückkehren.«
»So bitte ich Sie um Unterkunft für eine Nacht«, sagte er. »Eigentlich hätten wir weiterfahren müssen, aber das Wetter ist zu schlecht geworden. Wir würden die Stadt kaum erreichen, bis es zu schneien anfängt. Wir werden Sie mit unserem Spiel reich entschädigen für ein wenig Essen und einen Platz, wo wir uns niederlegen könnten, – irgendwo. Wir suchen nur Zuflucht vor dem Wetter.«
»Sie sind uns willkommen«, sagte ich. »Seien Sie unsere Gäste. Ich muß gestehen, daß mir der Gedanke, Sie spielen zu sehen, großes Vergnügen bereitet.«
Er lachte laut und dröhnend.
»Schöne Dame!« rief er aus. »Wir werden vor Ihnen spielen, wie wir noch nie in unserem Leben gespielt haben!«
Die Kinder hatten gehört, daß Gäste gekommen waren, und kamen angelaufen. Lucas sagte ihnen, die Besucher seien Schauspieler, und sie würden für uns ein Theaterstück aufführen. Dick machte einen Luftsprung vor Begeisterung, und Angie tat es ihm nach, während Fenn immer wieder Fragen stellte und wissen wollte, was eigentlich los sei.
»Aber tretet doch näher!« rief ich. Ich strahlte vor Vergnügen, weil ich eine schöne Dame genannt worden war und freute mich über die Gelegenheit, meine Autorität als Schloßherrin zu beweisen.
Sie schienen die Halle ganz auszufüllen. Als sie zum Feuer traten, um sich zu wärmen, leuchteten ihre Augen.
Unter den Schauspielern war eine Frau mittleren Alters, die gut die Frau des Leiters sein konnte, und eine andere, die ich auf Ende Zwanzig schätzte. Und Harriet Main. Von den fünf Männern waren drei schon etwas älter. Einer der beiden jüngeren schien sehr gut auszusehen, aber sie waren alle so vermummt, daß ich nur wenig von ihren Gesichtern erkennen konnte. Nachdem ich sie um das Feuer gruppiert hatte, ging ich in die Küche, um mit unseren beiden Dienstmädchen, Marianne und Jeanne, zu sprechen.
Als ich ihnen von den Gästen erzählte, waren sie entzückt. »Schauspieler!« rief Marianne, die ältere der beiden. »Oh, das wird lustig werden. Wie lange ist es her, daß Schauspieler hier gewesen sind? Meist gehen sie ja doch nur in die großen Häuser und Schlösser.«
»Das Wetter hat sie zu uns gebracht«, sagte ich. »Aber was haben wir für sie zu essen?«
Jeanne und Marianne steckten tuschelnd ihre Köpfe zusammen und sagten dann, ich könnte versichert sein, daß die Schauspieler ordentlich verpflegt werden würden. Ob sie denn auch die Aufführung sehen dürften?
Dazu gab ich sofort meine Erlaubnis. Ich würde auch die Lambards auffordern, teilzunehmen. Trotzdem würden wir nur ein kleiner Zuschauerkreis sein.
Ich ging in die Halle zurück. Jetzt sah ich Harriet zum ersten Mal richtig. Sie hatte ihren Mantel abgelegt, und ob wohl sie vor dem Feuer hockte, konnte ich sehen, daß sie hochgewachsen war. Ihre dichten, von der Kapuze befreiten dunklen Locken bildeten einen wunderschönen Rahmen für ihr Gesicht, in dem die Augen dominierten. Es waren dunkelblaue, geheimnisvolle Augen, die etwas zu verbergen schienen, mit langen dunklen Wimpern und dichten, schwarzen Augenbrauen, die sich deutlich von ihrem blassen Teint abhoben. Ihre Lippen waren leuchtend rot.
Ich starrte sie an. Sie merkte es, und es schien sie zu belustigen. Sie war wohl daran gewöhnt.
»Ich bin Engländerin«, sagte sie zu meinem Erstaunen und streckte mir die Hand hin. Ich ergriff sie, und einige Augenblicke lang sahen wir uns an. Ich hatte das Gefühl, daß sie mich prüfend betrachtete.
»Ich bin noch nicht lange bei dieser Bühne«, sagte sie .auf englisch. »Wir sind auf dem Weg nach Paris. Dort werden wir in großen Häusern auftreten, aber unterwegs verdienen wir uns die Unterkunft durch kleinere Aufführungen.«
»Sie sind willkommen bei uns«, sagte ich. »Wir hatten noch nie eine Wanderbühne hier und freuen uns alle sehr darauf, Sie spielen zu sehen. Wir werden unser Bestes tun, damit Sie sich hier wohl fühlen können. Wie Sie sicher gemerkt haben, ist es kein großes Haus. Wir sind Flüchtlinge und wohnen nur so lange hier, bis wir mit dem König zurückkehren können.«
Sie nickte. Dann drehte sie sich zu den anderen um und sagte in schnellem Französisch, daß ich volles Verständnis für sie hätte und sie alle ihr Bestes geben müßten, um uns für die Gastfreundschaft zu entschädigen.
Ich hatte beschlossen, daß sie erst einmal etwas essen sollten. Deshalb bat ich zu Tisch, als die große Terrine mit einer dampfenden Suppe hereingebracht wurde. Während sie aßen, hatte ich Zeit, mir unsere Gäste genauer anzusehen. Alle waren lebhaft und hatten wohlklingende Stimmen. Sie sprachen viel und schienen auch den Nebensächlichkeiten eine besondere Bedeutung beizumessen.
Als es anfing zu schneien, sagte Monsieur Lamotte – so hieß der Leiter der Truppe –, sie hätten wirklich Glück gehabt, rechtzeitig in das Schloß des Überflusses gekommen zu sein. Ich wehrte bescheiden ab und erklärte, wir seien so wenig daran gewöhnt, Gäste zu haben, daß ich fürchtete, wir könnten sie nicht so bewirten, wie wir es eigentlich wünschten.
Wie aufregend alles war! Sie redeten von ihren Stücken und Rollen und den Orten, an denen sie aufgetreten waren. Und es schien uns allen, die wir den Gesprächen lauschten, daß das Schauspielerleben das Interessanteste und Schönste auf der Welt sein müsse. Jeanne und Marianne kamen mit Jacques in die Halle und hörten der Unterhaltung zu, die immer lebhafter und sprühender wurde. Jacques kam gerade von dem Lambards zurück und berichtete, wie begeistert sie die Einladung, der Aufführung beizuwohnen, angenommen hatten.
Harriet war weniger redselig als die anderen. Interessiert sah sie sich in der Halle um, als wolle sie sich ein Urteil bilden. Dann merkte ich, daß ihr Blick aufmerksam auf mir ruhte. Harriet saß neben dem gutaussehenden jungen Mann, den sie Jabot nannten. Ich fand ihn reichlich eitel, denn er wollte sich immer hervortun. Als Angie zu ihm ging, ihm die Hände auf die Knie legte, bewundernd zu ihm aufblickte und sagte: »Bist du aber hübsch«, lachten alle, Jabot war so entzückt, daß er sie hochhob und ihr einen Kuß gab. Angie wurde schrecklich verlegen, riß sich sofort los und rannte hinaus! Doch bald kam sie wieder herein, hielt sich aber im Hintergrund. Sie schien den Blick jedoch nicht von Jabot zu wenden.
»Du hast wieder eine Eroberung gemacht, mein Junge«, sagte Madame Lamotte.
Fleurette, die andere Schauspielerin, sagte spitz: »Wir müssen die Kleine aber darüber aufklären, daß Jabot keiner treu bleibt.«
Harriet zuckte mit den Achseln. »Das ist eine abgedroschene Redensart«, sagte sie und begann mit tiefer, wohlklingender Stimme zu singen.
»Nimmermehr seufzet ihr Damen mit Schmerzendenn trügerisch immer sind Männerherzen ...«
Und wieder lachten alle.
Sie blieben lange am Tisch sitzen, und ich beriet mich indessen mit Jeanne und Marianne. Wir mußten nach der Aufführung, die um sechs Uhr beginnen sollte, für die Schauspieler ein Abendessen bereithalten. Die Mädchen waren fest entschlossen, ihr Bestes zu tun, soweit es unter den gegebenen Umständen möglich war.
Jacques war bereits damit beschäftigt, Kostüme und Dekorationen in die Halle zu bringen, und die Kinder betrachteten andächtig die Gepäckstücke, aus denen bunte Kleidungsstücke quollen.
Die Schauspieler hatten Teppiche und Decken bei sich und erklärten, sie würden in der Halle schlafen. Am nächsten Morgen wollten sie schon beim ersten Tageslicht weiterfahren, um auf keinen Fall zu spät zu ihrem Engagement in Paris zu kommen.
Ich protestierte. Das Château sei zwar keineswegs komfortabel, aber wir könnten ihnen zumindest ein paar Zimmer zur Verfügung stellen, damit sie nicht auf dem Hallenboden zu schlafen brauchten.
»Die Herzlichkeit Ihrer Gastfreundschaft ist wie ein heißer Grog an einem kalten Tag«, deklamierte Monsieur Lamotte und verbeugte sich dankbar.
Es war ein denkwürdiger Abend. Die Kerzen brannten in ihren Haltern an der Wand, und wir waren wie verzaubert. Selbst die sonst so lauten Lambard-Söhne saßen stumm und andächtig da und waren wie wir übrigen hingerissen. Die Estrade befand sich glücklicherweise am Ende der Halle und war in eine Bühne verwandelt worden.
Aufgeführt wurde der ›Kaufmann von Venedig‹. Harriet war die Portia, und ich konnte die ganze Zeit den Blick nicht von ihr wenden. Sie trug eine blaue Samtrobe mit etwas Glitzerndem an der Taille. Bei Tageslicht hätte man gemerkt, daß der Samt schon abgewetzt und nicht mehr ganz sauber, der Gürtel billiges Flitterzeug war, aber der Kerzenschimmer verbarg jeden Makel und bot uns jene Schönheit, an die wir alle nur zu bereitwillig glauben wollten. Die Schauspielertruppe hatte uns in ihren Bann geschlagen.
Es war eine Zauberwelt. Wir hatten uns zwar ab und zu kostümiert und unsere Scharaden gespielt, aber dies hier schien uns Vollkommenheit. Jabot war ein hübscher Bassanio. Monsieur Lamotte spielte den schlauen Shylock mit buckligem Rücken und einer Waage in der Hand. Die jüngeren Kinder schrien entsetzt auf, als er in der Gerichtsszene auftrat, und Angie weinte bitterlich, weil sie glaubte, er würde sich wirklich sein Pfund Fleisch nehmen. »Das darf er nicht, das darf er nicht«, schluchzte sie, und ich mußte sie trösten und ihr sagen, sie sollte erst einmal abwarten, wie Portia auch diese Schwierigkeit meistern würde.
Wie sie deklamierte, wie sie sich bewegte und wie unglaublich schön sie war! Ich werde die Harriet jenes Abends nie vergessen.
Als die letzte Szene gespielt und Bassanio mit Portia vereint war, umarmten sich die Kinder vor lauter Freude, und ich glaube, wir waren alle ein wenig wie benebelt.
Dann hielt Monsieur Lamotte eine kleine Ansprache. Er glaube, daß uns die Aufführung gefallen habe. Er jedenfalls habe noch nie vor einem dankbareren Publikum gespielt – womit er meines Erachtens recht hatte.
Die Mädchen eilten in die Küche, die Kulissen wurden weggeräumt, und bald saßen wir bei einem Abendessen, wie es wohl noch nie zuvor in Château Congrève aufgetragen worden war.
Ein seltsamer Zauber umgab uns in dieser Nacht. Dick flüsterte mir zu, unsere guten Feen hätten den Schnee geschickt, damit diese wunderbaren Menschen nach Congrève kommen konnten. Die Lambards blieben zum Abendessen da. Madame Lambard hatte einen von einer goldbraunen Kruste überzogenen Auflauf aus Hühner- und Schweinefleisch mitgebracht und Monsieur Lambard spendierte ein Faß Wein.
Die Kinder durften ausnahmsweise aufbleiben, sie waren viel zu aufgeregt, als daß ich sie hätte ins Bett schicken können.
Die Schauspieler redeten unaufhörlich, und zwar alle gleichzeitig. Das Sprechen lag ihnen offenbar mehr als das Zuhören. Monsieur Lamotte hatte als Chef der Truppe den Platz zu meiner Rechten eingenommen und mich ins Gespräch gezogen. Er erzählte mir von den Theaterstücken und von den Städten im Land, in denen er gespielt hatte.
»Mein Traum ist es, einmal vor König Ludwig persönlich zu spielen. Er liebt das Theater, was bei einem so vielseitig begabten Mann nicht verwunderlich ist, finden Sie nicht auch? Was die Leute wollen, sind Lustspiele. Das ist meine Meinung. Wir brauchen gute Komödien. Es gibt genug Trauriges auf der Welt, meine liebe Miss. Die Menschen wollen lachen. Sind Sie auch dieser Meinung?«
Ich war mit allem einverstanden, was er sagte. Ich war ebenso verwirrt und benebelt wie die anderen.
Harriet saß weiter unten am Tisch neben Jabot. Sie flüsterten aufgeregt miteinander, und Harriet schien verärgert zu sein. Ich merkte, daß Fleurette die beiden beobachtete. Dort schien sich irgendein Drama abzuspielen. Ich interessierte mich zwar sehr für das, was mir Monsieur Lamotte erzählte, aber ich war so von Harriet fasziniert, daß ich gar zu gern gewußt hätte, worüber sie und Jabot sprachen.
So war ich froh, als sich schließlich alle an der allgemeinen Unterhaltung beteiligten, von ihren Auftritten redeten und einige Kostproben ihrer Kunst zum besten gaben. Harriet sang hauptsächlich Lieder von Shakespeare, die wir kannten. Sie sang erst auf französisch, dann auf englisch, und das Lied, an das ich mich besonders erinnerte, war:
Was ist Lieb? Sie ist nicht künftig;Gleich gelacht ist gleich vernünftig,Was auch kommen soll, ist wert.Wenn ich zögre, so verscherz' ich;Komm denn, Liebchen, küß mich herzig!Jugend hält so kurze Zeit.
Harriet hatte eine Laute und begleitete sich so reizend, daß ich das Gefühl hatte, noch nie ein so anmutiges Geschöpf wie Harriet gesehen zu haben.
»Auf der Bühne sollte viel mehr gesungen werden«, sagte Madame Lamotte und streichelte Fenns weiche, blonde Haare.
»Die Zuschauer mögen Lieder.«
»Sie haben eine wunderschöne Stimme«, sagte ich und sah Harriet unverwandt an.
»Es geht so«, erwiderte sie, wobei sie leicht die Schultern hob.
»Was für ein herrliches Leben müssen Sie doch führen!« rief ich aus.
Alle lachten, und Monsieur Lamotte sagte: »Ja, es ist ein herrliches Leben, ich würde mir kein anderes wünschen. Manchmal freilich ist es nicht leicht. Und für die Schauspieler in England ist das Leben jetzt eine Tragödie. Was ist dieser Cromwell doch für ein Barbar! Es soll kein Theater mehr in England geben, wie ich hörte? Gott sei Ihrem armen Lande gnädig, meine liebe Miss.«
»Wenn der König zurückkehrt, wird es auch wieder das Theater geben«, sagte ich.
»Den Leuten werden das alte Globe und das Cockpit nicht mehr genügen«, meinte Harriet. »Sie werden neue Theater haben wollen. Ich bin gespannt, ob ich dies noch erleben werde.«
Es entstand ein allgemeines Stimmengewirr. Mehr Wein wurde getrunken, die Kerzen flackerten, und obwohl ich nicht wollte, daß der Abend zu Ende ging, fielen mir doch beinahe die Augen zu. Die Kleinen waren schon lange eingeschlafen, und Lucas konnte sich nur noch mit Mühe wach halten.
Die Kinder wurden von Jeanne nun zu Bett gebracht, und Madame Lamotte bestand darauf, Fenn auf dem Arm hinaufzutragen.
Damit löste sich die Gesellschaft auf.
Und als Madame Lamotte zurückkam, nicht ohne Fenn und den anderen Kindern noch einen liebevollen Gutenachtkuß gegeben zu haben, meinte sie, alle sollten jetzt möglichst bald schlafengehen, sie hätten einen beschwerlichen Reisetag vor sich.
Und so führte ich sie mit den beiden Mädchen zu ihren Zimmern, wobei die Frauen und Männer je in einem untergebracht wurden.
Als ich schließlich in meinem Zimmer war, zog ich mich aus und ging zu Bett. Doch nach all der Aufregung war es mir unmöglich, Schlaf zu finden. Ich war traurig darüber, daß die Schauspieler am nächsten Tag weiterziehen würden. Im Château würde alles wieder seinen normalen Gang gehen, und wie ich jetzt wußte, unerträglich eintönig sein. Wie gerne wäre ich eine Schauspielerin wie Harriet Main!
Während ich noch meinen Gedanken nachhing, hörte ich plötzlich Stimmen auf dem Flur. Es waren leise, zischende Stimmen.
Ich sprang aus dem Bett, warf mir einen Morgenmantel über und öffnete leise die Tür.
Ich konnte die Umrisse von zwei Frauen erkennen, es waren Harriet und Fleurette.
»Ich habe deine Eifersucht endgültig satt«, sagte Harriet.
»Pah, Eifersucht! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Heute geliebt und morgen verstoßen.«
»Du mußt es ja wissen«, gab Harriet zurück, »du hast diese Rolle ja lange genug gespielt.«
Fleurette hob die Hand und schlug Harriet ins Gesicht.
»Du unterstehst dich, mich anzurühren?« Harriet gab den Schlag zurück.
»Du englische Hure, du!« zischte Fleurette und hob erneut die Hand.
Ich sah, wie Harriet nach Fleurettes Handgelenk griff. Doch Fleurette riß sich plötzlich los, Harriet trat einen Schritt zurück, verlor das Gleichgewicht und fiel die drei Stufen, die die verschiedenen Ebenen des Korridors verbanden, hinunter.
»Das geschieht dir ganz recht«, höhnte Fleurette. »Ein Sturz, bevor Jabot dich fallenläßt. So weißt du wenigstens, wie es ist.«
Harriet kam wieder auf die Füße und stieg humpelnd die Stufen wieder hinauf.
»Tu doch nicht so«, höhnte Fleurette. »Du bist ja gar nicht verletzt. Dir könnte das Haus über dem Kopf einstürzen, du kämst immer wieder auf die Füße. Ich kenne doch deinesgleichen.«
»Dann solltest du dich vorsehen und mich nicht reizen«, entgegnete Harriet.
Fleurette lachte und ging in das Zimmer, das ich für sie hergerichtet hatte. Wenige Sekunden später folgte ihr Harriet.
Es war offensichtlich, daß sich die beiden nicht leiden konnten und daß Jabot der Grund dafür war. Mochte das Leben in der Welt des Theaters noch so aufregend sein, es war sicherlich alles andere als ungetrübt.
Ich wachte am nächsten Morgen schon früh auf, obwohl ich lange nicht hatte einschlafen können. Mein erster Gedanke galt den Schauspielern, und daß wir sie gut verpflegen mußten, bevor sie in die Kälte hinausgingen.
Ich trat ans Fenster. Es schneite nicht mehr, und auf dem Boden lang nur eine dünne, weiße Schicht. Ich hatte gewünscht, sie würden hier einschneien und müßten noch dableiben, weil sie wegen des schlechten Wetters nicht weiterfahren könnten, und schon gehofft, wir würden jeden Abend eine Theateraufführung sehen können.
Ich ging in die Küche. Jacques, Jeanne und Marianne waren schon eifrig am Werk, Ale und Brot mit Speck anzurichten, denn sie waren offenbar ebenso fest entschlossen wie ich, den Schauspielern vor ihrer Abfahrt noch eine kräftige Mahlzeit zu bereiten. Wir waren alle traurig, daß ihr Aufenthalt sich seinem Ende näherte.
Jeanne deckte den Tisch in der Halle, während Marianne eilig das Feuer anschürte, das während der Nacht nicht völlig erloschen war.
Monsieur Lamotte kam die Treppe herunter, trat auf mich zu, küßte mir die Hand und verneigte sich. »Meine liebe Dame«, sagte er, »selten habe ich eine so angenehme Nacht verbracht.«
»Ich hoffe, daß Sie es warm genug hatten?«
»Die Wärme Ihrer Gastfreundschaft hat mich eingehüllt«, erwiderte er, womit er wahrscheinlich umschreiben wollte, daß das Bettzeug nicht ganz ausreichend gewesen war. Damit hatte er vermutlich recht.
Dann erschien Madame Lamotte mit den drei Kindern, denen sie gerade die Geschichte eines Theaterstücks aus dem Repertoire der Wanderbühne erzählte.
Sie begrüßte mich überschwenglich und erklärte, daß sie und die ganze Truppe sich ihr Leben lang mit Vergnügen an den Besuch im Château Congrève erinnern würden.
Beider Augen weiteten sich voll Entzücken, als sie das Frühstück sahen, und Monsieur Lamotte meinte, sie würden sich sofort zu Tisch setzen.
»Wir sind gerüstet, zum Auszug bereit wie die Kinder Israels. Doch ist Trauer in unseren Herzen. Ich weiß, daß Sie uns Gastfreundschaft noch für eine weitere Nacht gewähren würden, und ich möchte Ihnen sagen, liebes Fräulein, daß ich fast gehofft hatte, ein Schneesturm würde uns zwingen, Ihnen noch einmal zur Last zu fallen. Aber die Pflicht ruft! Wir müssen Paris rechtzeitig erreichen. Wir haben einen Vertrag, und jeder wahre Schauspieler würde eher sich selbst als sein Publikum enttäuschen.«
Unwillkürlich antwortete ich in ähnlichem Stil. Ich sagte, daß auch ich ihre Abreise bedauerte. Ich wäre glücklich gewesen, sie noch länger als Gäste zu haben, aber ich verstünde natürlich, daß sie unbedingt weiterziehen müßten. Sie hätten ihre Pflichten, und wir seien dankbar, ein so hinreißendes Beispiel ihrer Kunst erlebt zu haben, das wir nie vergessen würden.
Als sie sich an den Tisch setzten, fragte Madame Lamotte: »Wo ist Harriet?«
Mir war ihre Abwesenheit gleich aufgefallen, denn sie war die erste, nach der ich Ausschau gehalten hatte. Jeden Augenblick hatte ich erwartet, sie die Treppe herunterkommen zu sehen.
Madame Lamotte sah Fleurette an, die mit den Achseln zuckte.
»Ich habe sie aufgeweckt, bevor ich das Zimmer verließ«, sagte Madame Lamotte. »Sie müßte längst hier sein.«
Ich sagte, ich würde hinaufgehen und nach ihr sehen.
Harriet lag auf dem Bett. In der frühen Morgenstunde sah sie ebenso wunderschön aus wie bei Kerzenlicht. Sie hatte die Haare mit einem blauen Band zusammengebunden und trug unter einem Unterrock ein ausgeschnittenes Leibchen. Sie lächelte mir entgegen, als ob sie mir irgend etwas sagen wollte.
»Unten wartet man auf Sie«, sagte ich.
Sie hob die Schultern und wies auf ihren Fuß. »Ich kann nicht auftreten«, sagte sie. »Ich kann nicht gehen. Was soll ich bloß tun?«
Ich trat ans Bett und berührte vorsichtig das Fußgelenk, das leicht geschwollen war. Sie zuckte zusammen und verzog das Gesicht.
»Es ist verstaucht«, sagte ich.
Sie nickte.
»Aber vielleicht ist der Fuß auch gebrochen.«
»Wie kann ich das wissen?« fragte sie.
»Das werden Sie schon merken«, erwiderte ich. »Können Sie auf dem Bein stehen?«
»Ja, aber es tut sehr weh.«
»Madame Lambard versteht etwas von Krankheiten und hat eine Menge Arzneien. Ich könnte sie bitten, sich das Gelenk einmal anzusehen. Aber eines weiß ich genau: Sie sollten es ruhig halten.«
»Aber ... wir müssen weiterfahren. Wie ist denn das Wetter?«
»Kalt, aber klar. Es schneit nicht mehr. Auf dem Boden liegt nur eine dünne Schneedecke, die beim Fahren nicht hinderlich sein wird.«
»Sie müssen weiterziehen! Sie haben in Paris ein Engagement.« Sie verzog die Lippen zu einem Lächeln. »Fräulein Tolworthy«, sie zögerte, »würden Sie ... könnten Sie vielleicht so gut sein, mich hier noch so lange bei sich aufzunehmen, bis ich wieder richtig gehen kann? Sehen Sie, ich singe und tanze auf der Bühne, ich spiele natürlich eine bestimmte Rolle. Und wenn ich meinen Fuß jetzt nicht ordnungsgemäß pflege, könnte ich damit meine ganze Karriere ruinieren.«
Mich überkam plötzlich ein Gefühl wilder Erregung. Das Abenteuer war noch nicht vorbei! Sie blieb noch hier!
Ich sagte rasch: »Ich würde niemanden abweisen, der unsere Hilfe braucht.«
Sie streckte mir die Hand entgegen, und ich trat einen Schritt vor und ergriff sie. Einen Augenblick hielt ich ihre Hand in der meinigen und blickte in das seltsame, aber wunderschöne Gesicht.
»Gott segne Sie«, sagte sie. »Bitte, lassen Sie mich noch eine Weile hierbleiben.«
»Sie sind uns willkommen«, erwiderte ich. Ich lächelte dabei, und meine Freude war sicher nicht zu verkennen.
»Aber jetzt werde ich Madame Lambard herrufen«, erklärte ich. »Sie wird sofort wissen, was mit Ihrem Fuß ist.«
»Ich bin gestern abend auf der Treppe ausgerutscht«, sagte sie.
Ja, dachte ich, als Sie die Auseinandersetzung mit Fleurette hatten.
»Wahrscheinlich ist es nur eine Verstauchung. Ich werde Madame Lambard Bescheid geben.«
Ich ging zurück in die Halle, wo die anderen bereits Berge von Brot und Speck aßen und Ale dazu tranken.
»Miss Main hat sich den Knöchel verletzt«, sagte ich. »Sie kann nicht gehen. Ich habe sie eingeladen, so lange hier zu bleiben, bis sie wieder spielen kann. Seien Sie unbesorgt. Wir werden uns um sie kümmern.«
Ein paar Sekunden herrschte tiefes Schweigen. Fleurette konnte ein kleines Lächeln nicht ganz unterdrücken, und Jabot blickte unverwandt auf sein Bierglas.
Dann stand Madame Lamotte auf und sagte: »Ich gehe hinauf und werde einmal nachsehen.«
Ich begab mich in die Küche und sagte Jeanne und Marianne: »Miss Harriet Main bleibt noch ein paar Tage hier, bis sie wieder auftreten kann. Sie hat sich den Knöchel verstaucht.«
Den Gesichtern der Mädchen sah man an, daß sie freudig überrascht waren. Die Küche schien sich verändert zu haben. Das Herdfeuer brannte auf einmal heller.
Das Abenteuer ging also weiter.
Draußen war es kalt, und Rauhreif glitzerte auf den Bäumen, als wir den Schauspielern zum Abschied nachwinkten. Wegen der Packpferde bewegten sie sich nur langsam bis zur Straße hinunter, und Monsieur Lamotte führte seine Truppe wie ein biblischer Patriarch an.
Mir war, als beobachte ich eine Bühnenszene. Dies war das Ende des ersten Aktes, und ich war dankbar, daß es nicht das Ende des ganzen Schauspiels war. Oben lag die Hauptdarstellerin, und solange sie hier war, mußte das Stück weitergehen.
Sobald sie weg waren, ging ich zu Harriet. Sie lag im Bett und hatte die Decke bis zum Kinn heraufgezogen. Ihre Haare schienen gleichsam über das Kopfkissen zu fließen. Sie lächelte, schien die Situation zu genießen, und ich fand, daß sie eine fast katzenhafte Anmut besaß.
»Sie sind also weg«, sagte sie.
Ich nickte.
Sie lachte. »Ich wünsche ihnen viel Glück. Sie werden es nötig haben.«
»Und Sie?« fragte ich.
»Ich habe das Glück, mir ausgerechnet hier meinen Knöchel zu verstauchen.«
»Glück? Das verstehe ich nicht.«
»Na ja, hier bin ich halt besser aufgehoben, als auf der Straße. Ich bin gespannt, wo sie heute nacht Unterkunft finden werden. Bestimmt nicht so gemütlich wie hier. Übrigens, ich habe noch nie vor einem Publikum gespielt, das von der Aufführung so gefesselt war.«
»Ach, wir haben hier so gar keine Erfahrung mit Theaterstücken und dergleichen.«
»Nun, das wäre eine Erklärung«, sagte sie und lachte wieder. »Von dem Augenblick an, als ich Sie sah«, fuhr sie fort, »hoffte ich, daß wir Freunde werden könnten.«
»Das freut mich. Hoffentlich wird es dazu kommen.«
»Es ist so nett von Ihnen, mich noch etwas hierzubehalten. Ich hatte große Angst, daß ich einen bleibenden Schaden an meinem Fuß davontragen würde. Meine Beine sind, wie Sie sich vorstellen können, ein wichtiger Bestandteil meines Berufs.«
»Das verstehe ich, und Sie werden sich rasch wieder erholen. Jetzt sage ich aber endlich Madame Lambard, sie möge sich Ihren Knöchel ansehen.«
»Das hat Zeit.«
»Das glaube ich nicht. Sie wird wissen, ob etwas gebrochen ist und was getan werden muß.«
»Warten Sie noch einen Augenblick, damit wir uns ein bißchen unterhalten können.«
Aber ich blieb fest und ging sofort zu Madame Lambard.
Madame Lambard setzte immer ihren ganzen Stolz darein, uns zu verarzten. Sie warf dann die Lippen auf, hielt den Kopf schief und gebrauchte mit wichtiger Miene geheimnisvolle Ausdrücke, die wir nicht verstehen sollten. Im Haus der Lambards gab es ein Zimmer, das ausschließlich der Zubereitung ihrer verschiedenen Kräutertränklein vorbehalten war, ein Zimmer, in dem es nach allen möglichen Tinkturen roch und in dem ständig ein Kessel, dem seltsame Düfte entströmten, über dem Feuer hing. Von den Dachsparren baumelten getrocknete Kräuter.
Als Madame Lambard hörte, daß sich ein Mitglied der Schauspielertruppe den Knöchel verletzt hatte, dageblieben sei und ihre Hilfe benötigte, war sie hocherfreut. Natürlich würde sie sofort kommen! Sie würde keine Zeit verlieren! Die Schauspieler seien großartig gewesen. Schade, daß sie nicht länger hatten bleiben können.
Voller Geschäftigkeit betrat sie das Zimmer, in dem Harriet lag. Man merkte ihr den Wunsch an, ein gutes Werk vollbringen zu können. Sie betastete den Knöchel und gebot Harriet, aufzustehen. Sie tat es und stieß einen Schmerzensschrei aus.
»Halten Sie den Fuß ruhig«, erklärte Madame Lambard beruhigend. »Dann heilt er wieder. Knochen sind nicht gebrochen. Ich werde eine ganz spezielle Packung machen und ihn damit einwickeln. Ich schwöre, daß Sie schon morgen die wohltätige Wirkung spüren werden. Der Knöchel wird schon sehr bald wieder in Ordnung sein, das verspreche ich Ihnen.«
Harriet sagte, sie wisse nicht, wie sie uns allen danken solle.
»Arme Lady«, sagte Madame Lambard. »Es muß sehr traurig für Sie sein. Alle Ihre Freunde sind fort, und Sie mußten allein hier zurückbleiben.«
Harriet seufzte, aber ich glaubte, ein verstohlenes Lächeln um ihre Lippen entdeckt zu haben, und dies schien darauf hinzudeuten, daß es ihr gar nicht so leid tat.
»Ich höre so gern vom Theater«, sagte Madame Lambard. »Was für ein wunderbares Leben müssen Sie führen.«
Harriet verzog wieder den Mund zu einem schiefen Lächeln. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke: Sie ist gar nicht die, die sie zu sein scheint.
Und wie wir sie verwöhnten! Marianne und Jeanne kochten eigens für sie besondere Gerichte, Jacques erkundigte sich dauernd nach ihr. Madame Lambard kam während des ersten Tages dreimal herüber, um den Umschlag zu wechseln. Die Kinder schauten herein, und es war schwierig, sie wieder wegzubringen. Lucas betete sie förmlich an, und auch ich war von ihr fasziniert.
Sie war sich all dessen bewußt. Sie lag zurückgelehnt in den Kissen und genoß offenbar ihre Lage.
Was mir merkwürdig vorkam, war die Tatsache, daß sie es ziemlich gleichmütig hinnahm, von ihren Kollegen hier zurückgelassen worden zu sein. Ich hielt sie für so welterfahren, daß ich annahm, sie würde die Reise auch allein fortsetzen können, wenn sie wieder aufstehen konnte. Ich war damals noch sehr naiv.
Am nächsten Tag sagte sie uns, sie könne noch immer nicht mit dem Fuß auftreten, ohne daß es ihr wehtäte, obwohl der Knöchel nicht mehr schmerzte, wenn sie ihn nicht belastete. So fuhren wir fort, sie nach besten Kräften zu pflegen und sie wie einen Ehrengast zu behandeln, und es kam uns nicht in den Sinn, daß sie uns etwas vormachen könnte. Doch am dritten Tag machte ich eine Entdeckung.
Die Kinder waren mit Lucas ausgeritten. Ich hatte in der letzten Minute beschlossen, nicht mitzureiten. Jacques hackte Holz für die Lambards, Marianne und Jeanne waren in der Küche damit beschäftigt, eine besondere Mahlzeit für Harriet zuzubereiten, und ich entschloß mich, hinaufzugehen und nach ihr zu sehen.
Ich klopfte an der Tür, und als niemand antwortete, öffnete ich leise und sah hinein. Das Bett war zwar benutzt, aber leer. Harriets Kleider lagen umher, aber wo war sie selbst?
Ich konnte es nicht verstehen. Ein schreckliches Gefühl des Verlassenseins überkam mich. Sie war fort! Wie eintönig würde jetzt alles werden! Aber sie konnte nicht ohne ihre Kleider weggefahren sein, nein. Sie mußte sich irgendwo im Hause befinden. Aber wo? Und wie konnte sie ihr Zimmer verlassen haben, wo sie doch nur unter starken Schmerzen herumhumpeln konnte?
Sie hatte zu gehen versucht, sie war hingefallen, sie lag bestimmt irgendwo unter Schmerzen auf dem Boden. Ich mußte sie finden!
Während ich, die Hand auf der Klinke, noch in der Tür stand, hörte ich schnelle Schritte, die sich dem Zimmer näherten.
Mein Herz begann zu klopfen, als ich mich in eine dunkle Ecke des Zimmers stellte und wartete.
Harriet kam hereingelaufen. Von Humpeln keine Spur. Sie tänzelte durchs Zimmer, drehte Pirouetten und betrachtete sich dann in dem Spiegel, der auf dem Tisch stand.
Sie mußte meine Anwesenheit entweder geahnt oder im Spiegel eine Bewegung gesehen haben, denn sie fuhr herum, als ich aus dem Schatten heraustrat.
»Ihr Knöchel ist anscheinend viel besser geworden«, sagte ich.
Sie riß die Augen weit auf. Dann zuckte sie mit den Achseln.
»Also gut«, sagte sie, setzte sich auf das Bett und sah mich lächelnd an, »es war nie sehr schlimm. Ich habe mir den Fuß zwar verstaucht, als ich auf den Stufen ausrutschte. Und als das Gelenk ein bißchen angeschwollen war, kam mir der Gedanke.«
Ich hätte gewarnt sein müssen, daß jemand, dem es gleichgültig zu sein schien, bei einem Täuschungsmanöver ertappt zu werden, ähnliche Situationen schon früher erlebt haben mußte.
Sie sah mich bittend an und lächelte. »Ich wollte so gern hierbleiben«, sagte sie,
»Sie wollten hierbleiben ... als ...«
»Es ist so behaglich«, sagte sie. »Viel behaglicher, als irgendein schmutziges, altes Gasthaus. Schlechte Unterkunft und nicht genug zu essen, weil wir es nicht bezahlen können ... Ach, hier geht es mir viel besser.«
»Aber Ihr Pariser Engagement ...
»Unsere Hoffnung auf ein Pariser Engagement. Glauben Sie denn, man würde sich in Paris um eine arme Wanderbühne reißen?«
»Aber Monsieur Lamotte hat doch gesagt ...?«
»Monsieur Lamotte ist ein Träumer. Aber träumen wir nicht alle? Es ist so schön, sich vorzustellen, daß die Träume Wirklichkeit werden könnten. Und besonders Schauspieler flüchten sich oft in Träume.«
»Wollen Sie mir sagen, daß Sie nur vorgegeben haben, sich den Knöchel verletzt zu haben, damit Sie hierbleiben könnten?«
»Ich habe mir den Knöchel wirklich verstaucht. Als ich in meinem warmen Bett aufwachte – in Ihrem Bett, besser gesagt –, da dachte ich: Ich wünschte, ich könnte hierbleiben, wenigstens eine Zeitlang. Ich wünschte, ich könnte mich mit der interessanten Arabella unterhalten und mich mir ihr anfreunden und aus der Ferne von dem entzückenden Lucas angebetet werden und mich in der Bewunderung durch die reizenden Kleinen sonnen ...«
»Sie reden wie Monsieur Lamotte.«
»Das kommt daher, daß ich zu seinem Ensemble gehört habe.«
»Wollen Sie jetzt, wo Sie wieder ohne Schmerzen gehen können, zu ihm zurückgehen?«
»Das hängt von Ihnen ab.«
»Von mir?«
»Gewiß. Wenn Sie mich auf die Straße setzen wollen, werde ich zu den anderen zurückkehren. Ich werde ihnen sagen, daß mich die Bettruhe und die Behandlung durch die brave Madame Lambard wiederhergestellt haben. Aber das werde ich nur dann tun, wenn Sie mich nicht mehr haben wollen.«
»Meinen Sie damit, daß Sie endgültig hierbleiben wollen?«
»Ich habe daran gedacht. Der junge Master Dick hat mir von einer allseits geschätzten Dame erzählt, die leider zu ihrem Schöpfer heimgekehrt ist – Miss Black, deren Name nur mit Ehrfurcht ausgesprochen wird. Es ist ein großes Unglück, daß die Kinder nun jenen Unterricht entbehren müssen, der so wichtig für ihr künftiges Leben ist.«
»Ich unterrichte sie jetzt, und Lucas hilft mir.«
»Das ist bewunderungswürdig. Aber Sie haben Ihre Pflichten hier im Château zu erfüllen. Lucas ist noch zu jung und hat seine eigene Ausbildung kaum beendet. Sie brauchen eine Erzieherin. Wenn Sie sich entschließen könnten, mich zu engagieren, würde ich mein Äußerstes tun, Sie zufriedenzustellen.«
»Erzieherin! Aber Sie sind doch Schauspielerin.«
»Ich könnte sie in Literatur unterrichten. Ich bin darin gut bewandert. Ich kenne die Theaterstücke von England und Frankreich auswendig – oder wenigstens einige von ihnen. Ich könnte sie im Gesang unterrichten, – im Tanzen, im richtigen Benehmen. Ich könnte ihre Erziehung und Ausbildung wirklich zu Ende führen.«
»Ist es tatsächlich Ihr Ernst, daß Sie in diesem stillen, langweiligen alten Château bleiben wollen?«
»Wo es ein wärmendes Feuer für mich gibt, gutes Essen, um mich satt zu machen, und eine Gesellschaft, die, wie ich meine, für mich noch einmal wichtig sein könnte.« Sie sah mich ernst, beinahe flehentlich an. »Arabella, ich habe gemerkt, daß Sie hier entscheiden. Wie ist Ihre Antwort?«
»Sie wissen doch«, sagte ich, »daß ich niemanden zurückweisen würde, der Zuflucht sucht.«
Sie strahlte. Ich wußte, daß ich sie immer anschauen und ihr immer zuhören wollte. Natürlich war es mein Wunsch, daß sie blieb! Ich war entzückt, daß der Vorschlag von ihr ausgegangen war, auch wenn ich ein wenig schockiert war, daß sie sich so überzeugend hatte verstellen können. Aber schließlich war sie ja Schauspielerin.
Als ich den Kindern erzählte, daß Miss Main ihre neue Erzieherin sein würde, machten sie Luftsprünge. Lucas fand, daß es für die Kinder nur gut sein könnte und unsere Eltern davon sehr angetan sein würden. Von letzterem war ich nicht so ohne weiteres überzeugt und beschloß daher, ihnen vorläufig nicht zu sagen, daß Harriet eigentlich Schauspielerin war – jedenfalls nicht, bevor sie sie nicht selbst gesehen und, wie ich sicher annahm, ihrem Charme erlegen waren. Jeanne, Marianne und Jacques waren glücklich, daß ihr eintöniges Leben jetzt vom aufregenden Duft des Theaters umgeben sein würde. Madame Lambard konnte natürlich nichts gegen jemanden einwenden, bei dem sie so rasch die Wirkung ihrer Heilmittel hatte beweisen können.
Und so wurde Harriet Main ein Teil unseres Haushalts.
Wie vorauszusehen gewesen war, veränderte sich unser Leben. Sogar Harriets Kleider waren anders. Sie hatte Gewänder aus Brokat und Samt, die bei Kerzenlicht herrlich aussahen. Für die Kinder war sie wunderschön, und auf eine seltsam exotische Weise war sie es sicherlich auch. Sie konnten den Blick kaum von ihr wenden, und Lucas war bereit, ihr Sklave zu ein. Aber ich war diejenige, auf die sie vor allem Eindruck machen wollte.
Manchmal trug sie die prachtvollen Haare nach hinten gekämmt und im Nacken mit Bändern zusammengebunden, dann wieder steckte sie sie auf und schmückte sie mit allerlei Zierat. Die Kinder dachten, sie müsse eine Prinzessin sein, um solche Juwelen zu besitzen, und ich brachte es nicht übers Herz, ihnen zu sagen, daß es nur billige Glasperlen waren. An ihr sahen sie wie echter Schmuck aus.
Wir kannten uns bald ganz gut in der Bühnenliteratur aus, und die Schulstunden nahmen oft die Form von Schauspielunterricht an. Sie teilte uns die verschiedenen Rollen zu und reservierte sich selbst die beste – aber konnte ich ihr daraus einen Vorwurf machen? Sie versprach uns, daß wir, wenn wir soweit seien, das Stück vor der Dienerschaft und den Lambards aufführen würden.
Harriet hatte unsere Herzen gewonnen, und ich fürchtete nur, daß sie eines Tages unserer überdrüssig werden und beschließen könnte, zu ihrer Wanderbühne zurückzukehren. Aber nichts deutete darauf hin, im Gegenteil, sie schien mit dem Leben bei uns vollkommen zufrieden zu sein. Sie machte es sich zur Gewohnheit, in mein Zimmer zu kommen, wenn die anderen zu Bett gegangen waren, und sich mit mir zu unterhalten – das heißt, meistens redete sie, und ich hörte zu.
Sie saß immer in der Nähe des Spiegels und warf ab und zu einen Blick auf ihr Ebenbild. Ich hatte den Eindruck, als betrachte sie das Stück auf der Bühne vom Zuschauerraum aus. Manchmal schien es sie geradezu zu erheitern.
Eines Abends sagte sie: »Sie kennen mich nicht, Arabella. Sie sind so jung wie die Unschuld, und ich bin so alt wie die Sünde.«