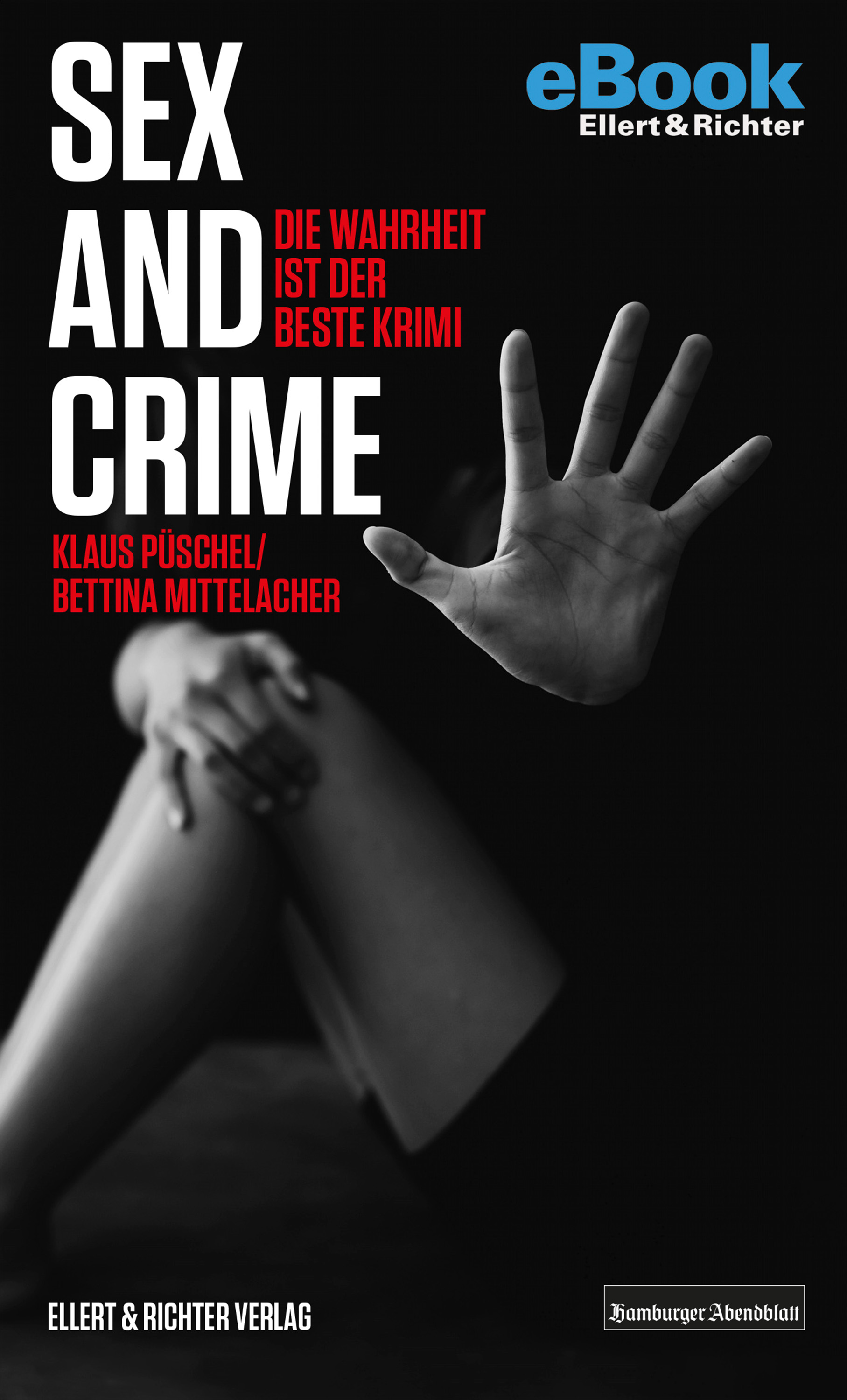17,99 €
Mehr erfahren.
In seinem Buch erzählt Klaus Püschel aus dem Innersten der Pandemie-Bekämpfung, von den Hürden, die es zu überwinden gilt, um von den Toten zu lernen, nicht nur während Corona. Denn unabhängig von seinen Thesen ist er fest davon überzeugt, dass wir über Erkrankungen nur mehr erfahren, wenn die Toten gründlich untersucht werden. Seine Schlussfolgerungen helfen uns in Zukunft, die richtige Balance zu finden zwischen dem Schutz vor Viren einerseits und unserer Freiheit andererseits. Er wirft einen dringend notwendigen Blick in die Zukunft und auf Krankheitswellen, die uns noch bevorstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungVorwortDetektive in WeißFaszination RechtsmedizinAm Anfang war das Rätsel »Mensch«Der Tod – das einzig Sichere im LebenDie Sprache der TotenWas kann die Rechtsmedizin?Im Namen der Toten und der SchwächstenBis dass der Tod uns schneidetSchlag auf SchlagAm Ende völlig atemlosDann schießen Sie mal los!Darauf kannst du Gift nehmen!Tote retten LebenWenn das Baby nicht mehr aufwachtDas Beben im KopfBeelzebub statt Teufel – Safer Use und MethadonDen Finger in die Wunde gelegt oder: Druck machen gegen DruckgeschwüreSave the Sex durch Safer Sex – vom Umgang mit HIV/AidsAlles vergurkt – die EHEC-Epidemie und ihre (Nicht-)FolgenAngst essen Seele und Verstand auf – zwischen Aktion und Überreaktion in Zeiten von CoronaVisionen und PläneDer Tod gibt niemals RuheSchöne neue TotenweltNachwortÜber dieses Buch
In seinem Buch erzählt Klaus Püschel aus dem Innersten der Pandemie-Bekämpfung, von den Hürden, die es zu überwinden gilt, um von den Toten zu lernen, nicht nur während Corona. Denn unabhängig von seinen Thesen ist er fest davon überzeugt, dass wir über Erkrankungen nur mehr erfahren, wenn die Toten gründlich untersucht werden. Seine Schlussfolgerungen helfen uns in Zukunft, die richtige Balance zu finden zwischen dem Schutz vor Viren einerseits und unserer Freiheit andererseits. Er wirft einen dringend notwendigen Blick in die Zukunft und auf Krankheitswellen, die uns noch bevorstehen.
Über den Autor
Klaus Püschel zählt zu den renommiertesten Rechtsmedizinern Deutschlands. Er ist Professor und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf. Außerdem ist er der Herausgeber der Zeitschrift »Blutalkohol«, in der für die juristische und medizinische Praxis verkehrspolitische, juristische und medizinische Beiträge sowie aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirkungsweise von Alkohol und Drogen auf die Fahrtauglichkeit veröffentlicht werden.
KLAUS
PÜSCHEL
mit Bettina Mittelacher
DIE TOTEN KÖNNENUNS RETTEN
Wie die Rechtsmedizin hilft,Krankheiten zu erforschen unddas Sterben zu verhindern
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Die Namen in sämtlichen Fallbeispielen wurden geändert, sofern es sichnicht um Fälle handelt, über die bereits öffentlich berichtet wurde.
Originalausgabe
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Swantje Steinbrink, Berlin
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngenunter Verwendung eines Motivs © UKE/EVA HECHT
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0413-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
MORTUIVIVOSDOCENTVon den Toten lernen wir für die Lebenden
Vorwort
Deutschland, 28. Januar 2020. In Bayern scheint die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Doch die Idylle trügt. Laut Pressemeldungen hat ein gefährlicher Serientäter unbemerkt die Grenze passiert und erste Spuren hinterlassen. Bislang ist wenig über ihn bekannt. Nur dass er vor Seniorenheimen und Diskotheken lauert, in Bars, Kirchen und Großschlachtereien, wo er sich wehrlose Opfer sucht. Noch operiert er europaweit in überschaubarem Maße, erweckt den Anschein, kontrollierbar zu sein. Aber man fürchtet, dass dies nur der Anfang ist. Dass es Nachahmungstäter geben könnte. In China hat er bereits zahlreiche Menschenleben ausgelöscht. Dabei ist er so winzig klein, dass das menschliche Auge ihn nicht erkennen kann. Sein Name: SARS-CoV-2. Wenige Wochen nach seinem Auftauchen in Europa hat er den zweiten Kontinent schachmatt gesetzt. Erst Asien, jetzt Europa. Er verbreitet sich rasant, fordert Opfer um Opfer. Und schürt Angst unter den Menschen.
Angst ist eine überlebenswichtige Warn- und Schutzreaktion des Körpers bei Bedrohung. Einem biochemischen Feuerwerk gleich werden Hormone ausgeschüttet, das sympathische Nervensystem wird aktiviert. Binnen Bruchteilen von Sekunden werden die Sinne geschärft und die Muskeln stärker durchblutet mit dem Ziel, zu kämpfen oder zu fliehen. Ohne das Gefühl der Angst hätten wir Menschen nicht überlebt. Sie hilft uns, das Kostbarste zu schützen, über das wir verfügen: unser Leben.
Doch Angst ist ein schlechter Ratgeber, wenn sie zum Selbstläufer wird. Denn ganz gleich, ob eine Bedrohung echt ist oder nur in unserer Vorstellung existiert, unser Körper reagiert stets auf dieselbe Weise. Nimmt die Angst überhand, kann sie uns kopflos machen. Kann Fehlentscheidungen provozieren und Verschwörungstheorien befeuern, kann zu Verleugnung statt zur Vorsicht führen, kann uns einengen und niederdrücken. Dann ist es besonders wichtig, den Gegenspieler der Angst auf den Plan zu rufen: das Wissen.
Wissen allein ermöglicht uns, eine Bedrohung zu verstehen und die Vernunft einzuschalten, um auf den Boden der Tatsachen zu gelangen. Um angemessen handeln, uns schützen, der Bedrohung etwas entgegensetzen zu können. Genau deshalb hat sich das Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) so frühzeitig und weltweit dafür eingesetzt, jene Menschen zu obduzieren, die an COVID-19 verstorben waren. Meinen Kollegen und mir ging es darum, die Krankheit und ihren Verlauf zu erforschen, um künftige Patienten zielgerichtet behandeln zu können. Denn es sind immer wieder die Toten, von denen wir Lebenden lernen – angefangen bei den frühesten Erkenntnissen zur Anatomie des Menschen bis hin zur heutigen Rechtsmedizin und Pathologie, die sich modernster Diagnosemethoden bedienen. Mortui vivos docent – die Toten lehren die Lebenden. Dies ist kein leerer Spruch, es ist meine tiefe Überzeugung, das Ergebnis von über 40 Jahren Erfahrung im Fach und die Erkenntnis nach vielen tausend untersuchten Toten.
Unter allen Fachdisziplinen der Medizin rufen die Rechtsmedizin und die Pathologie die zwiespältigsten Gefühle hervor. Im Mittelalter als Leichenschänder verschrien und der Hexerei bezichtigt, erleben wir Rechtsmediziner derzeit einen regelrechten Hype in Thrillern und Krimis: Am Tatort und in der Leichenhalle folgen wir den Spuren von Blut und DNA, bestimmen Todeszeitpunkt und Todesursache, hantieren mit Skalpell, Sägen, Computertomografen, Mikroskopen und im Labor. Wir schöpfen Körperflüssigkeiten, analysieren Haare auf Drogenkonsum und stecken buchstäblich die Nase in Leichname, um Gifte zu erschnuppern. Zum Anwalt der Toten erhoben, decken wir Kunstfehler sowie als Unfälle oder Suizide getarnte Morde auf. Wir sprechen die Sprache der Toten, die nicht aus Wörtern und Sätzen, sondern aus geheimen, versteckten Botschaften des Körpers besteht. Auf dem Seziertisch, mit dem Mikroskop und im Labor bringen wir die menschlichen Abgründe der Täter zum Vorschein. So umgibt uns eine Mischung aus Gruseleffekt und dem Versprechen von Erkenntnis, von Gerechtigkeit, Sicherheit und Wahrheit. Wir Wollen Wissen, Was Wirklich War. Ob Kinderquäler oder Serienkiller – wann immer einem Mörder das Handwerk gelegt wird, endet damit die Spur der Gewalt, die ein Täter nach sich zieht. Und so kann der Tod des einen das Leben eines anderen bedeuten. Die Aufklärung des Schütteltraumas bei einem Kind kann sein Geschwisterchen retten, die Seniorin, die von ihrem Pfleger erstickt wurde, kann ihre Mitpatienten vor dem gewaltsamen Tod bewahren. Und weil der erste Mord im Täter die Hemmschwelle senkt, aufs Neue zuzuschlagen, verhindert seine schnelle Überführung in vielen Fällen weitere Gewalttaten.
Mord, Totschlag, Unfälle, Katastrophen bilden das Haupteinsatzgebiet der Rechtsmedizin. Doch als Disziplin steht sie selten allein. Virologen, Bakteriologen, Molekulargenetiker, Pathologen, Tropenmediziner, Anthropologen, Kriminalisten … Wie so oft ist es die Vielfalt, die Synergieeffekte hervorbringt. Rechtsmedizin funktioniert nur im Team und im interdisziplinären Kontext. Ich bin weder ein einsamer Wolf noch ein Solist, sondern der Dirigent in einem eng vernetzten Ensemble von hochkarätigen Fachleuten. So auch im Fall von COVID-19, als es uns unter anderem gelang, entscheidende Hinweise auf den Verlauf der Krankheit, auf Thrombenbildung und den Virusbefall von Organen zu geben.
Ob Corona, HIV oder plötzlicher Kindstod: Es ist der breite Fächer an Erkenntnissen, den wir aus der Sektion Verstorbener gewinnen, der uns Mediziner immer wieder aufs Neue überrascht, widerlegt, belehrt, weiterbringt. Um andere und künftige Leben zu retten und das frühzeitige Sterben zu verhindern, indem Behandlungsmethoden und Operationstechniken verbessert, Krankheiten erkannt, gelindert und geheilt werden.
Und so möchte dieses Buch Sie einladen, sich mit mir auf die Spurensuche zu begeben: in gutbürgerliche Wohnungen deutscher Städte und in einsame ländliche Gegenden, in die Halbwelt von Hamburg-St. Pauli und den faszinierenden Kosmos der kleinsten Serientäter – der Bakterien, Viren und multiresistenten Keime. Denn Wissen ist unsere machtvollste Waffe. Gegen die Angst. Und für das Leben.
Detektive in Weiß
Faszination Rechtsmedizin
Eigentlich sollte mein Fachgebiet ja die Sportmedizin werden. Sport hatte mich immer schon interessiert; als Jugendlicher bildete ich gemeinsam mit meinem Vater und meinem älteren Bruder immerhin die Hälfte der Tischtennis-Herrenmannschaft im norddeutschen Varel. An der medizinischen Fakultät in Hannover absolvierte ich deshalb recht bald die Zusatzausbildung zum Sportmediziner, erwarb eine Trainerlizenz für die Tischtennis-Bundesliga, beriet das Trainerteam der Nationalmannschaft und hatte schon eine Assistenzarztstelle in Aussicht. Alles lief planmäßig; die Weichen für eine spannende berufliche Laufbahn waren gestellt. Jetzt galt es nur noch, das letzte Ausbildungsjahr hinter mich zu bringen. Jenes Jahr, in dem unter anderem die Rechtsmedizin auf dem Lehrplan stand.
In Studentenkreisen war zu vernehmen, dass die Vorlesungen bei Professor Bernd Brinkmann, seines Zeichens Privatdozent und Oberarzt der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, trotz toter Materie äußerst lebendig seien. Inwieweit zu der positiven Wahrnehmung auch die Tatsache beitrug, dass unter anderem sichergestellte Sexfilme und Exkursionen ins Hamburger Rotlichtviertel auf dem Programm standen, sei dahingestellt.
Damals war gerade der spektakuläre Fall des Serienmörders Fritz Honka omnipräsent. Honka, im Jahr 1935 in Leipzig geboren, war ein klein gewachsener Mann, das spärliche Haar sauber gekämmt, der Bart gepflegt. Als Folge eines schweren Unfalls war sein Gesicht deformiert, das schielende Auge verbarg er meist hinter einer getönten Brille. In den frühen Morgenstunden, wenn sich die Nachtschwärmer in Etablissements wie dem Goldenen Handschuh oder dem Elbschlosskeller auf dem Kiez trafen, endete Honkas Schicht als Nachtwächter im Shell-Gebäude. Dann mischte er sich unter die Feiernden, trank sich Mut an und versuchte sein Glück bei der Damenwelt: bei Gelegenheitsprostituierten, vereinsamten Frauen und solchen, die längst durch das soziale Netz gerutscht waren. Bei Frauen, die niemand je vermissen würde. Für eine Brause mit Korn oder fünf D-Mark folgten sie ihm in seine winzige Dachgeschosswohnung, die sich als eine mit pornografischen Bildern austapezierte Rumpelkammer erwies. Zwischen leeren Bierkästen, Unrat, Puppen und einer vergilbten Ausgabe von de Sades Juliette vergnügte er sich dort mit den Frauen. Was auch immer der Auslöser gewesen sein mochte – Zank ums Geld, eine falsche Bemerkung, Beschimpfungen –, wenn die Wut in ihm entfacht wurde, verlor Honka jegliche Selbstkontrolle. Dann warf er sich auf sein Opfer, seine Hände schnellten um dessen Kehle, und er begann es zu würgen. Ein minutenlanger Todeskampf folgte, der ihm all seine Kraft abverlangte, doch er ließ nicht von den Frauen ab, bis sie sich nicht mehr regten. Doch damit nicht genug. Die leblosen Körper legte er auf ein Brett und zersägte sie mit einem handelsüblichen Fuchsschwanz. Einige Päckchen mit Leichenteilen hatte er schon einmal nicht weit von seiner Wohnung entfernt auf einer Brachfläche entsorgt; es dauerte lange, bis die Fragmente einer verschwundenen Prostituierten zuzuordnen waren. Den Torso des Leichnams und die Teile dreier weiterer ermordeter Frauen versteckte er in den Verschlägen seiner Einzimmerwohnung. So lebte er dort mit ihnen weiter, umgeben von den Ausdünstungen der Einsamkeit und massivem Verwesungsgestank. Ein Brand im zweiten Stock des Wohnhauses rief schließlich die Feuerwehr auf den Plan. Auf der Suche nach Glutnestern drangen die Männer bis in Honkas Dachwohnung vor und machten einen grausigen Fund: Müllsäcke voller Fleisch, von dem Honka behauptete, es handele sich um Schlachtabfälle – bis sich herausstellte, dass es menschliche Überreste waren. Fritz Honka, der als »Schlächter von St. Pauli« bekannt werden sollte, gab bei der stundenlangen Befragung auf dem Revier zunächst an, sich an nichts zu erinnern.
Professor Brinkmann war einer der Sachverständigen im Prozess, und so erhielten wir Studenten anhand der Bilder von den verwesten, teils mumifizierten Leichenteilen einen detaillierten Einblick in den Fall. Es handelte sich um Taten, die nur schwer zu fassen waren. Ein Mörder, dessen Leben zwischen massiver väterlicher Gewalt, Aufenthalten in Heimen, Demütigungen und fortwährendem Versagen zerschellt war. Dazu die Tragik der Frauen, nach deren Verbleib sich niemand je erkundigt hatte. Die Eruption von Gewalt, das zornerfüllte Würgen, gefolgt von fein säuberlichem Zerlegen der Leichen.
Während jener Vorlesungen bekam ich eine Ahnung davon, was Rechtsmedizin ausmacht, und das Fach nahm mich mehr und mehr gefangen. Dazu trugen auch die Vorlesungen von Professor Manfred Kleiber über scharfe Gewalt bei. Allein die exakte Analyse der Stichverletzungen und was man in Relation zu den Spaltlinien der Haut schlussfolgern konnte! Hier waren exakte Befunde, die Kenntnis naturwissenschaftlicher Sachverhalte und logisches Denken gefragt, um dem Tod auf die Spur zu kommen.
Auf einer unserer Exkursionen nach Hamburg zeigte uns Professor Brinkmann das dortige Institut für Rechtsmedizin, das dezent am Rande des großen Uniklinikums liegt. Gespannt stiegen wir die Treppe in Richtung Leichenhalle hinab, wo Brinkmann uns in einen großen Kühlraum mit mehreren Leichen führte. Die Wände waren gekachelt, an einem der Metalltische hafteten Spritzer von getrocknetem Blut. Ein wenig roch es wie in der örtlichen Metzgerei: ein leichter Fleischgeruch, durchwoben von den Aromen Blut und beginnende Verwesung.
An diesem Tag war »eine Bahnüberfahrung« hereingekommen. Professor Brinkmann nahm die Leiche genau in Augenschein und referierte. Während wir uns gedanklich Notizen machten, packte er die Haare des Leichnams – und hielt im nächsten Moment den abgetrennten Kopf in die Höhe. Ein Raunen ging durch die Gruppe der Anwesenden. Was immer er bezweckt hatte, die Aufmerksamkeit seiner Studenten war ihm gewiss. In den folgenden Minuten dozierte er über den Abtrennungsrand des Kopfes und klärte uns über die Unterschiede zu einer Enthauptung durch Beil oder Messer auf. Die Aufgabe der anstehenden Sektion war es, zu klären, ob es sich um eine Selbsttötung handelte oder ob das Opfer womöglich vor der Bahnüberfahrung erdrosselt und dann auf die Schienen gelegt worden war. Ein immenser Unterschied. Für die Hinterbliebenen, für die emotionale Last des Fahrzeugführers und im Fall eines Mordes für all jene, die dem Täter künftig zum Opfer fallen könnten.
Der Tod, so begriff ich, bedeutet in der Wissenschaft der Medizin nicht das Ende. Auch wenn dem Menschen, der auf dem Sektionstisch vor einem liegt, nicht mehr geholfen werden kann, so gibt die Obduktion doch Aufschluss über Verletzungsmuster und Krankheitsverläufe. Interpretiert man diese richtig, kann man rekonstruieren, was im speziellen Fall zum Tode geführt hat, und vor allem künftig weitere Menschenleben retten. Indem ein Täter gefasst wird oder indem fehlerhafte Behandlungsmethoden aufgedeckt und Krankheiten weiter erforscht werden. Und so packte mich die Faszination der Rechtsmedizin.
Die Krankheit, auf die ich von da an am häufigsten stoßen sollte, war die Gewalt. Ob als niederer Instinkt oder Folge von Bedrohung: Gewalt, so meine Überzeugung aus über 40 Jahren Tätigkeit als Rechtsmediziner, schlummert in jedem von uns. Den meisten Menschen gelingt es, sie zu beherrschen – bis etwas Unvorhergesehenes sie wachruft und unverhüllte Aggression die Herrschaft übernimmt. Nahezu alles kann Ursache sein: ein Leben, das sich am Rande der Gesellschaft bewegt und schließlich havariert; ein Gefühl des Versagens oder der Bedrohung; Demütigung, Angst, Rachegelüste, Sex, Eifersucht, Habgier, politische Motive … Rund 200 000 polizeilich erfasste Fälle von Gewaltkriminalität werden in Deutschland jährlich verzeichnet. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher, denn Opfer häuslicher Gewalt erstatten nur selten Anzeige. Aus Scham, Angst oder weil sie nicht in der Lage sind, sich Hilfe zu holen.
Jeder Körper erzählt eine Geschichte, und mehr als alles andere ist es Aufgabe des Rechtsmediziners, die Sprache der Toten zu verstehen und die Todesursache herauszufinden. Wir sind immer dann im Einsatz, wenn die Krankheit Gewalt sich gegen einen Menschen selbst oder gegen andere entladen hat. Und sämtliche Tode aufgrund nicht natürlicher oder noch ungeklärter Ursache sind unser Fachgebiet.
Natürliche Tode infolge innerer Erkrankungen hingegen zählen zum Fachgebiet der Pathologen. Manchmal allerdings verschwimmen die Grenzen zur Pathologie, wie zuletzt bei Corona. Ein Thema, das mich kurz vor der Pensionierung sehr stark herausgefordert hat.
Immer wieder kommt es vor, dass eine auf dem Totenschein als natürlich angegebene Todesursache, zum Beispiel Herzversagen, in Wahrheit ein Mord war. So im Fall des Olaf D.
An einem Junitag im Jahr 2001 klingelt es an der Tür der 82-jährigen Rentnerin Martha B. Als die alte Dame öffnet, steht ihr ein Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes gegenüber, ein freundlicher, vertrauenerweckender Bär von einem Mann, in der Tat der Inbegriff des guten Samariters. Mit seinen eins dreiundneunzig und 130 Kilogramm Körpergewicht hat er etwas Tapsiges. An diesem Tag möchte Olaf D. sich vergewissern, dass das Bad der alten Dame auch wirklich behindertengerecht ist. Dankbar für die Fürsorglichkeit des netten Mannes, lässt Martha B. ihn eintreten. Sie ahnt nicht, dass der 31-Jährige fristlos entlassen wurde, weil er Geld unterschlagen hat.
Arglos wendet sie ihm den Rücken zu. Die Tür fällt hinter ihr ins Schloss. Einen Atemzug lang ist es völlig still, dann hört sie ein Rascheln. Im nächsten Moment spürt sie, wie sich eine Pranke auf ihren Mund legt: eine kräftige Hand, die in einer Socke steckt. Sie will schreien, doch die Pranke hindert sie daran. Olaf D.s Griff wird fester. Unbarmherzig schiebt er die alte Frau mit seinem wuchtigen Körper ins Schlafzimmer. Kurz kann Martha B. sich losreißen, will voller Panik wissen, was er von ihr verlange.
»Geld!«, lautet die Antwort. Geld ist der Grund, warum Olaf D. einen hinterlistigen Plan ersonnen hat. Geld ist der Grund, warum er an diesem Tag zum sechsten Mal zum Mörder werden will.
»Jungchen, nimm das Geld und geh!«, wimmert Martha B., denn er tut ihr weh.
Da packt er sie und drückt sie ins Kissen. Martha B. bekommt keine Luft mehr. Todesangst erfasst sie. Ein entsetzlicher Kampf beginnt, dem sie körperlich nicht gewachsen ist. Der Sauerstoffmangel macht sie benommen, es fühlt sich an wie Sterben. Kurz meint sie, das Telefon läuten zu hören, dann verliert sie das Bewusstsein.
Aufgeschreckt vom Telefon, lässt Olaf D. von ihr ab. Schlaff fällt ihr Körper auf die Kissen. In aller Eile bricht er die Geldkassette auf und macht sich mit 3 700 D-Mark aus dem Staub.
Martha B.s Sohn ist besorgt, weil seine Mutter den Anruf nicht entgegennimmt. Schnellstmöglich macht er sich auf den Weg zu ihrer Wohnung und findet sie bewusstlos vor. Neben Platzwunden und Hämatomen hat die zierliche Frau eine Schädelprellung und mehrere Knochenbrüche erlitten. Doch sie kommt wieder zu sich. Und sie erinnert sich. Noch am selben Abend kann Olaf D. dank ihrer Aussage gefasst werden.
Bislang hat sich Olaf D. in Sachen Körperverletzung nichts zuschulden kommen lassen. Wenn er auffiel, dann durch seinen Hang zur Protzerei, zu schnellen Autos, zur Großmannssucht. Schulden sind auch der Grund dafür, warum er Geld unterschlagen hat. Warum seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Doch zurzeit ist Olaf B. frisch verliebt – in eine Prostituierte, deren erkaufte Zuwendungen er fälschlicherweise für echte Zärtlichkeit hält.
Die Staatsanwaltschaft wird misstrauisch. Fünf hochbetagte Frauen aus dem ehemaligen Arbeitsumfeld des Olaf D. sind in den vergangenen Tagen angeblich eines natürlichen Todes gestorben, eine 89-jährige Rentnerin nur wenige Stunden vor seinem Besuch bei Martha B. Auf allen fünf Totenscheinen ist als Todesursache Herzversagen angegeben, keine ungewöhnliche Diagnose für einen alten Menschen. Die Staatsanwaltschaft ordnet an, die Toten zu obduzieren. Da ich während meiner ärztlichen Laufbahn schon häufig Erstickungen aufklären konnte, werde ich hinzugezogen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit; einen der Leichname können wir gerade noch vor dem Krematoriumsofen anhalten.
Die Obduktionen zeigen eindeutige Merkmale des Erstickens durch Fremdeinwirkung. Neben Bindehautblutungen weisen die Opfer erhebliche innere Verletzungen sowie Rippen- und Wirbelsäulenbrüche auf, wie zusätzliche Röntgenuntersuchungen zeigen; bei einer der Frauen stelle ich einen Brustkorbniederbruch fest – eine Fraktur mehrerer Rippen, die dadurch entsteht, dass sich der Täter auf den Brustkorb seines Opfers kniet. Nach dem Präparieren der Haut sind Weichteilunterblutungen erkennbar, besonders in den Bereichen von Hals und Mund. Mikroskopische Untersuchungen können Fasern der Kissen nachweisen, mit denen die Opfer erstickt wurden. Ganz offensichtlich wurde keine der fünf Frauen bei der äußeren Leichenschau gründlich untersucht. Ansonsten hätten die Ärzte, die die Totenscheine ausstellten, einige der massiven Verletzungen bemerken müssen, die sich unter dem Deckmantel der Haut verbargen. Eine Obduktion der ersten Ermordeten hätte die Serie der Verbrechen also bereits stoppen können.
Was sich so trocken liest, bezeugt in Wahrheit, welche Gewalt den wehrlosen alten Frauen am Ende ihres Lebens angetan wurde. Drei bis sechs Minuten dauert der Tod durch Ersticken. Minuten, die vom Todeskampf bestimmt sind, von Gefühlen der Wehrlosigkeit, der Panik, der Ausweglosigkeit. Die Vorstellung, wie eine hochbetagte Frau der physischen Übermacht des Mörders ausgeliefert ist, wie sie vergebens um ihr Leben kämpft, macht fassungslos, traurig und wütend zugleich.
Und es geschieht nicht selten, dass alten Menschen vorschnell ein natürlicher Tod bescheinigt wird. Doch nicht immer ist das Naheliegende auch das Wahre. Im Fall des »Oma-Mörders«, wie Olaf D. von der Presse genannt wurde, drapierte dieser seine Opfer hinterlistig im Bett, damit es so aussah, als wären sie friedlich entschlafen. So täuschte er Ärzte und Angehörige – und konnte weiter morden.
Warum er das tat?
Um an Geld zu kommen. Um sich im Anschluss an die Tat zu vergnügen. Um »seiner« Prostituierten eine Pediküre zu schenken, einen Helikopterflug, einen Ausflug nach Helgoland. Allein deshalb mordete Olaf D. in einer Frequenz, die einzigartig ist und schaudern lässt.
Manche Sektionen haben sogar etwas Tröstliches, wenn sich herausstellt, dass das Opfer nicht leiden musste. Dass es schnell ging. Doch in den meisten Fällen werden wir Zeugen von vergangenem Schmerz, und auch wenn die begleitenden Gefühle der Todesangst nicht mit dem Skalpell nachweisbar sind, so stehen sie doch im Raum. Dann ist das einzig Tröstliche die Überführung des Mörders, damit einem geliebten Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Und glücklicherweise gelingt es nicht selten, eine drohende Mordserie aufzuhalten …
Nach Einschätzung der Sachverständigen war nach Olaf D.s erster Tat, der Ermordung der 87-jährigen, verwitweten Lisbeth N., eine Art »Gewöhnungseffekt« beim Täter eingetreten. Fiel ihm die erste Gewalttat noch schwer, so perfektionierte er mit jedem weiteren Opfer sein Vorgehen und hinterließ keine äußerlich sichtbaren Spuren. Bis ihm »Kommissar Zufall« zusammen mit der Rechtsmedizin das Handwerk legte. Nach einhelliger Überzeugung der Kriminalisten und Kriminalpsychologen bestand kein Zweifel daran, dass er sich weitere Opfer gesucht hätte. Denn seine Geldbörse leerte sich sehr schnell, und hilflose alte Menschen, die ihm ihr Vertrauen schenkten, gab es in seinem Umfeld zur Genüge …
Es sind Fälle wie diese, die mir immer wieder vor Augen führen, warum ich Rechtsmediziner geworden bin: um die Krankheit Gewalt zu bekämpfen.
Erdrosselte, Erhängte, Erstochene, Erschossene, Drogentote, Tote nach ärztlichen Kunstfehlern, Vergiftete, Unfallopfer, Wasser- und Brandleichen, Asbesttote, Opfer von Kriegen, Flugzeugabstürzen, Explosionen oder Vergewaltigungen, Misshandelte und Missbrauchte, Voodoo-Morde, Moorleichen, der Störtebeker-Schädel … In der Rechtsmedizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Manche Fälle machen sprachlos, andere kitzeln am Voyeurismus der Menschen und erlangen weltweite Aufmerksamkeit.
Und dann sind da die lebenden Opfer, denen wir uns widmen. Frauen und Kinder, auch Säuglinge, denen Gewalt angetan wurde. Minutiös untersuchen wir sie und diagnostizieren, welches Trauma sie erlitten haben. In der Hoffnung, dass ihnen die richtige psychologische Hilfe zuteilwird und die seelischen Wunden heilen werden. Und dass wir einen Beitrag zur Überführung der Täter leisten können, damit weitere Gewalttaten dieser Art vereitelt werden. Als Detektive in Weiß, als Anwälte der Opfer.
Zum Untersuchungsspektrum der Rechtsmedizin zählt auch das breite Feld der durch ärztliche Einwirkung (mit)verursachten Todesfälle wie Diagnose- und Behandlungsfehler oder Narkosetode sowie der Bereich der ungeklärten Todesfälle wie durch plötzlichen Kindstod und vieles mehr. Nicht immer kommen wir der Todesursache auf die Spur. Doch wenn es uns gelingt, dann erzielen wir gelegentlich einen weiteren Durchbruch in der Wissenschaft der Medizin. Dann arbeiten wir daran, Behandlungsmethoden und Operationstechniken zu verbessern, Richtlinien zur Prävention aufzustellen, Infektionswege zurückzuverfolgen und im besten Fall auszumerzen.
Die Errungenschaften der Medizin gingen schon immer mit Sektionen einher, von den frühesten chirurgischen Eingriffen im alten Ägypten über Andreas Vesalius’ anatomische Erkenntnisse im 16. Jahrhundert bis hin zur Erforschung von Corona-Toten. Doch es ist nicht nur das erlangte Wissen, das immer wieder aufs Neue fasziniert. Das Eröffnen eines Leichnams zeigt die ganze Schönheit des Gewebes, des Gehirns, der Muskulatur, Blut- und Nervenbahnen, der Organe und Knochen. Und so erinnert ein Ausflug in die Rechtsmedizin immer wieder an das Wunderwerk des menschlichen Körpers in all seinen staunenswerten Facetten.
Am Anfang war das Rätsel »Mensch«
Isfahan, im frühen elften Jahrhundert. In der Madrasa, der ehrwürdigen islamischen Lehrstätte, verebbt das allgegenwärtige Gemurmel. Es ist Zeit für den Anatomie-Unterricht. Der legendäre Arzt und Philosoph Ibn Sina deutet auf ein vergilbtes Schaubild des menschlichen Körpers und doziert: »Die Lunge ist ein großer Kreis, in dem das Herz sitzt, und davor der Magen …« Sein Schüler, der angehende Medicus Rob Cole, hat für den Vortrag nur ein müdes Lächeln übrig. Müde deshalb, weil er in der Nacht zuvor in den Katakomben heimlich einen Leichnam eröffnet und erstmals einen Blick in den Körper eines Menschen geworfen hat …
Auch wenn es sich beim Medicus um einen historischen Roman handelt: Die Wahrscheinlichkeit, dass weder Sie noch ich existieren würden, ist groß, wenn einer unserer frühen Vorfahren ein unbekanntes organisches Leiden gehabt hätte – und wenn in der beeindruckenden Geschichte der Medizin niemals obduziert worden wäre. Dabei gilt der historische Ibn Sina (980–1037 n. Chr.) als begnadeter Arzt seiner Zeit, der sich in seinem Kanon der Medizin der Krankheitslehre und Hygiene, den fortschrittlichen Behandlungsmethoden sowie der Arzneimittelkunde widmete. Doch das islamische Gebot der Unversehrtheit eines Leichnams mag ihn davon abgehalten haben, einen Blick unter den Deckmantel der Haut zu werfen, um sich sein anatomisches Wissen aus erster Hand anzueignen. Und damit war er über viele Jahrhunderte hinweg nicht der Einzige.
Reisen wir zurück in der Zeit, und zwar zu den Anfängen der Medizin. Wir dürfen davon ausgehen, dass die alten Ägypter eine gewisse Vorstellung vom Inneren des Körpers besaßen, da vor der Mumifizierung eines Leichnams die Organe durch Schnitte in Bauch und Brust entnommen und in Kanopen verschlossen wurden. Auch das Gehirn wurde mit eigens dafür angefertigten Werkzeugen durch die Nase quasi herausgelöffelt. Doch das Ziel war nicht, anatomische Kenntnisse zu erlangen, sondern den Körper möglichst unversehrt für das Leben nach dem Tod zu konservieren. Die Priesterärzte kannten bereits zahlreiche Krankheiten wie die Wassersucht und deren mögliche Ursachen. Was die Anatomie anging, bedienten sie sich allerdings nicht des Wissens der niederen Kaste der Einbalsamierer, sondern eigener Vorstellungen. Dem »matten Herzen« zauberten sie mittels ihrer Imagination ein Gefäß namens »Empfänger« an die Seite, das angeblich das Herz mit Wasser versorgte – eine spannende Mischung aus medizinischem Wissen über die Wassersucht, die durch eine Herzschwäche bedingt sein kann, und reiner Spekulation. Zugleich verfügten sie über eine beachtliche Vielfalt an Heilmitteln, die sie ihren Patienten gemeinsam mit Begleitsprüchen und Beschwörungen verabreichten.
Die Macht der Suggestion spielte auch in der antiken griechischen Heilkunst eine Rolle. In sogenannten Schlaftempeln wurden die Kranken nach diversen Waschungen und Gebeten in Trance versetzt, um heilsame göttliche Botschaften zu empfangen. Allerdings waren es nicht die Götter, die zu ihnen sprachen, sondern wiederum Priesterärzte, deren Worte über verborgene Schalltrichter ans Ohr der Kranken drangen – mit großen Heilerfolgen.
Hippokrates (um 460–375 v. Chr.), der Vater der Heilkunde, legte mit seiner Ärzteschule auf der Insel Kos den Grundstein für die Wissenschaft der Medizin. Als Entdecker der Vier-Säfte-Lehre betrachtete er Krankheiten als Störungen im Gleichgewicht von Blut, Schleim, schwarzer und gelber Galle. Die menschliche Anatomie spielte für ihn eine untergeordnete Rolle, seziert wurden nur Tiere.
Tatsächlich aber geht das Wort Anatomie, das heute für die Lehre des Körperbaus steht, auf das griechische ανατομία (anatomίa) zurück, was »Aufschneiden, Zergliedern« bedeutet. Und so waren es griechische Ärzte, die im dritten Jahrhundert v. Chr. in Alexandria dem Anspruch von Aristoteles folgten, die Natur in ihrer Gänze zu erforschen, und systematisch menschliche Leichen untersuchten. Proxagoras von Kos und seine Schüler Erasistratos und Herophilos gelten daher als Begründer der Anatomie. Ihnen verdanken wir die Unterscheidung von Venen und Arterien, die Entdeckung der Nerven und die Kenntnis der Herzklappen. Auch gelang ihnen eine detaillierte Darstellung des Gehirns mit Groß- und Kleinhirn, Hirnhäuten und Ventrikeln, was dadurch ermöglicht wurde, dass sie relativ frische Leichen von Verbrechern untersuchten – eine Praxis, die sich Jahrhunderte später, im Christentum, einer gewissen Beliebtheit erfreute. Dennoch sollte ihre Forschung mit ihrem Tod ein Ende finden, denn die Ärzte, die auf sie folgten, hegten Zweifel, ob man aus der Sektion von Toten Rückschlüsse auf die Lebenden ziehen könne. Noch hing eine Heilung nach Ansicht der Menschen wesentlich vom Wohlwollen der unsterblichen Götter oder auch vom Stand der Gestirne ab. Erst Galenus von Pergamon (um 129–199 n. Chr.), Leibarzt von Marc Aurel und für die Gladiatoren zuständig, griff wieder auf Sektionen zurück. Allerdings nicht, um möglichen Krankheitsursachen auf die Spur zu kommen. Vielmehr ging es ihm darum, seine Behandlungstechniken zu verbessern, um es sich nicht mit dem römischen Kaiser zu verscherzen. Die Anatomie des Skeletts untersuchte Galenus anhand von Knochenresten in aufgegebenen oder zerstörten Gräbern. Das Corpus Galenicum sollte über Jahrhunderte hinweg zum Standardwerk der Medizin werden. Das Problem: Galenus sezierte nur Affen und Schweine und übertrug seine Erkenntnisse frei auf den Menschen. Seiner Ansicht nach wurde das Blut in der Leber produziert, um von dort aus zur Hälfte in die Peripherie des Körpers und zur anderen Hälfte zum Herzen zu fließen. Die linke Herzkammer sei ein Ofen, so Galenus, in dem sich das Blut zur Abkühlung mit der Luft der Lungen vermische. Vom Blutkreislauf selbst oder gar von der Pumpfunktion des Herzens hatte er keine Vorstellung.
Zum Nachteil aller Herzkranken machte sich in den folgenden Jahrhunderten – zumindest öffentlich – niemand die Mühe, sein Werk zu hinterfragen, zumal Leichenöffnungen sowohl bei den Römern als auch bei den Christen mehrheitlich als Tabubruch galten. So wundert es nicht, dass die durchschnittliche Lebenserwartung im Römischen Reich (auch aufgrund der hohen Kindersterblichkeit) gerade mal 30 Jahre betrug.
Von frühen Christen wie Augustinus wurden Sektionen geradezu verdammt, doch ein ausdrückliches Verbot gab es nur bedingt. Papst Bonifatius stellte im Jahr 1299 das Kochen von Leichnamen und das Abschaben menschlicher Knochen unter die Strafe der Exkommunikation. Dass sich solche Praktiken überhaupt einer gewissen Beliebtheit erfreuten, lag an den Kreuzzügen: Wer es sich leisten konnte, veranlasste zu Lebzeiten, dass sein Körper im Fall des Todes wieder nach Hause geschafft und dort beerdigt wurde. Und das war nun mal einfacher zu bewerkstelligen, wenn es sich um saubere Skelette in transportfähigem (sprich: zerstückeltem und abgekochtem) Zustand handelte.
In der Folge wurde die päpstliche Bulle allerdings immer wieder auf die »schändliche« Praxis der Sektionen bezogen und diese als Leichenschändung verschrien. Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass der Körper zu jener Zeit lediglich als fleischliche Hülle für die Seele galt.
Mit der Renaissance aber flammte eine neue Wissbegierde auf, eine Hinwendung zur Schönheit des menschlichen Körpers und seinen Mysterien.
Werfen wir einen Blick nach Italien im späten 15. Jahrhundert. Im Schutz der Dunkelheit eilt ein Mann zum örtlichen Friedhof. Immer wieder blickt er über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass ihm niemand folgt. Denn er ist einem Rätsel auf der Spur: dem Aufbau des menschlichen Körpers und seinen Funktionen. Vor einem frisch aufgeschütteten Grabhügel bleibt er stehen. Ein Geräusch lässt ihn innehalten, doch es war nur der Flügelschlag einer Elster, die durch sein Kommen aufgeschreckt wurde. Hastig gräbt er den frischen Leichnam eines Erhängten aus. An der Friedhofsmauer wartet ein Gehilfe; gemeinsam schaffen sie den Toten fort.
Von Kerzen erhellt, liegt der Körper wenig später im Keller des Mannes auf einem Tisch. Er setzt das Messer an und eröffnet den Leichnam. All die staunenswerten Details, die er sieht, hält er akribisch mit Feder, Tinte und Silberstift fest …
So ähnlich mag es sich abgespielt haben, bevor die Universität Pavia Leonardo da Vinci offiziell die Erlaubnis erteilte, Hingerichtete und Selbstmörder zu obduzieren. Der Künstler hatte bemerkt, dass seine eigenen Beobachtungen am menschlichen Körper nicht immer mit den Lehrbüchern übereinstimmten, und daher selbst zum Skalpell gegriffen. Aus seinen Erkenntnissen entstanden zahlreiche Zeichnungen, die tiefe Einblicke in die Anatomie des Menschen gewähren: das Innere des Schädels, das Auge, der Verlauf der Sehnerven, die Muskeln, Sehnen und Bänder, das Herz und seine Gefäße, die Organe. Sogar einen Fetus in der Gebärmutter stellte da Vinci dar. Indem er unter die Haut blickte und sein anatomisches Wissen in die Kunst einfließen ließ, schuf er Werke, die uns bis heute in ihrer Ästhetik berühren und uns buchstäblich unter die Haut gehen.
Auch Michelangelo wird nachgesagt, dass er Leichen sezierte. Und es sind nicht allein seine plastischen und detailreichen Skulpturen, die dies nahelegen. Wissenschaftler wollen herausgefunden haben, dass er in den Fresken der Sixtinischen Kapelle anatomische Entdeckungen verbarg, so etwa das Stamm-, Groß- und Kleinhirn im Hals Gottes. Mediziner entdeckten auf den Gemälden des Meisters außerdem eine anatomisch korrekte Niere sowie die Netzhaut eines Auges.
Seitens der Kirche wurden Sektionen erst durch Papst Sixtus IV. im Jahr 1482 ausdrücklich erlaubt. Dies führte zu bahnbrechenden wissenschaftlichen Errungenschaften, denen die Medizin ihren Fortschritt verdankt, aber auch zu makabren Auswüchsen.
Andries van Wesel (1514–1564), bekannt unter dem Namen Andreas Vesalius, revolutionierte gewissermaßen die Sektionspraxis, indem er den menschlichen Körper eigenhändig Schicht um Schicht freilegte – anders als die damaligen Gelehrten an den Universitäten, die das blutige Handwerk gern den Barbieren überließen und aus gewisser Entfernung dozierten. Sein Hauptwerk De humani corporis fabrica libri septem – sieben Lehrbücher über den Bau des menschlichen Körpers mit zahlreichen Illustrationen auf der Grundlage von Sektionen am Menschen – war überaus bedeutsam, wenngleich Vesalius nicht unumstritten war. Für die einen entfernte er sich zu weit von Galenus, für die anderen ging er nicht weit genug. In jedem Fall aber galt er aufgrund seiner Obduktionspraxis als hervorragender Chirurg. Auch mahnte er seine Kollegen zur Sorgfalt bei der Sektion, denn statt fein säuberliche Schnitte zu setzen, rissen manche die Gliedmaßen einfach ab.
An dieser Stelle kommen wir zu den anatomischen »Reality-Shows« des 16. bis 18. Jahrhunderts. Die Mitwirkenden: Mann oder Frau, nicht zu dick, nicht zu dünn, am besten jung, zum Tode verurteilt, eben noch lebendig, dann hingerichtet, rasch vom Galgen abgenommen und im Zentrum der Aufmerksamkeit platziert. Neben dem Tisch, auf dem seziert wurde, ein Barbier, ein Arzt, ein Heilkundiger, vielleicht auch einfach nur ein Schauspieler, der wusste, wie er die Menge anheizen konnte. Die Werkzeuge: Säge, Sonde, Skalpelle mit Ebenholzgriffen und Schädelspalter in Form eines dreizackigen Sterns.
Rings um die Hauptdarsteller scharte sich das sensationslüsterne Publikum – Studierende, wohlhabende Kaufleute, hohe Herren, auch Damen der Gesellschaft oder wer immer sich den Eintritt leisten konnte. Kaum wurde der erste Schnitt gesetzt, zeigte sich auf den Gesichtern der Anwesenden eine Mischung aus Neugier, Grauen, Ekel, Lust. Der Voyeurismus wurde befriedigt – und bei manch einem auch die Wissbegierde.
Dabei war es nach wie vor Praxis, zum Tode Verurteilte und Selbstmörder zu sezieren. Bisweilen wurden die Hinrichtungsmethoden sogar dem jeweiligen Bedarf angepasst. Die Obduktion war Teil der Strafe, die über einen Kriminellen verhängt wurde, und sollte der Abschreckung dienen. Man mag sich fragen, ob dies nicht immer noch im Hinterkopf des einen oder anderen Menschen mitschwingt, der Sektionen ablehnend gegenübersteht.
Um die gesteigerte Nachfrage zu befriedigen, wurden Arme, deren Familien das Geld für eine Beerdigung fehlte, bereits zu Lebzeiten rekrutiert; Leichname wurden gestohlen, ausgegraben … Das ging zeitweise so weit, dass sich Wohlhabende sicherheitshalber in verschlossenen Eisensärgen bestatten ließen.
Aufgrund der erhöhten Sektionsrate stellten die damaligen Anatomen auch vermehrt Anomalien fest. So findet sich in einer medizinhistorischen Sammlung ein Blasenstein. Man kann sich das Erstaunen vorstellen, als dieser geborgen wurde. Was mag sich der Anatom gedacht haben? Hatte er Zugang zur Krankengeschichte des Patienten? Und war er in der Lage, Zusammenhänge zwischen dem Stein und den Beschwerden zu erkennen, die der Mann zu Lebzeiten gehabt haben musste?
Mit dem Zeitalter der Aufklärung ging ein gesteigertes Interesse an den Naturwissenschaften einher. Erkenntnisse, Logik und Vernunft traten an die Stelle von Aberglauben und Gottesfurcht, oft gegen den Einfluss der Kirche gerichtet. Mehr und mehr wurde der Körper als Mechanismus betrachtet und eine Krankheit als Störungsprozess, der einer »Reparatur« bedurfte – eine Sicht, die den medizinischen Fortschritt abermals beflügelte. Endlich wurden morphologische Veränderungen in einen kausalen Zusammenhang mit Krankheitsbildern und Todesursachen gesetzt. Dies war die Zeit, in der die Toten die Lebenden zu retten begannen.
Eine glanzvolle Entwicklung nahm die Medizin in Wien, wo Erzherzogin Maria Theresia, eine Verfechterin des aufgeklärten Absolutismus, den Niederländer Gerard van Swieten im Jahr 1745 zu ihrem Leibarzt ernannte. Er wiederum berief medizinische Kapazitäten in die Kaiserstadt, die einen regen wissenschaftlichen Austausch pflegten – eine Entwicklung, die später als ältere Wiener Medizinische Schule bekannt wurde. Das von ihm eröffnete Allgemeine Krankenhaus wurde in den darauffolgenden Jahren zu einer Stätte der medizinischen Forschung zum Wohl der Patienten, wobei Sektionen eine herausragende Rolle spielten.
Im 19. Jahrhundert kam es in Wien erstmals zur Spezialisierung von medizinischen Fachgebieten und der Gründung der weltweit ersten Augen-, Haut- sowie Hals-Nasen-Ohren-Kliniken. Die sogenannte zweite Wiener Medizinische Schule trug Früchte: Zwischen 1914 und 1936 wurden vier Nobelpreise für Medizin an Wiener Ärzte verliehen. Mit dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland fand der Höhenflug der Wiener Spitzenmedizin allerdings ein jähes Ende. Renommierte Mediziner und Forscher waren gezwungen zu emigrieren oder wurden in Konzentrationslagern ermordet.
Seither profitiert die moderne Diagnostik insbesondere von den bahnbrechenden technologischen Neuerungen, die auf die frühen Mikroskope und Röntgengeräte folgten, dazu gehören CT, MRT, PET*, Elektronen- und Lichtmikroskope sowie die Nanoskopie mit Chip-Verfahren, die eine Auflösung von 20 bis 30 Nanometern und damit einen immer genaueren Blick in den Mikrokosmos der Zellen ermöglichen.
Und die Rechtsmedizin?
In altägyptischen Papyri finden sich Hinweise darauf, dass um das Jahr 2700 v. Chr. unter dem Hohepriester, Arzt und Baumeister Imhotep, nach seinem Tode zum Gott erklärt, mindestens eine Leichenschau mitsamt toxikologischer Untersuchung stattfand, um die genaue Todesursache eines Menschen festzustellen. Nach damaligen Möglichkeiten, versteht sich.
Giftmorde waren es, die im frühen 14. Jahrhundert medizinische Experten in Italien auf den Plan riefen und eine Zusammenarbeit zwischen Medizin und Recht etablierten. Der Bedarf war vorhanden. Zeitweise wurden den Borgias dermaßen viele Giftmorde mit Arsen, Cantarella und weiteren Substanzen zugeschrieben, dass sie Mühe gehabt hätten, diese überhaupt auszuführen. In den meisten Fällen beschränkte sich die Untersuchung damals darauf, dass die Ärzte den Toten in Augenschein nahmen. Doch das geruchlose, leicht süßlich schmeckende Arsen zum Beispiel, das mit Vorliebe in Wein verabreicht wurde, löst innere Blutungen aus, die bei einer äußeren Leichenschau nicht zu erkennen sind. Da das giftige Schädlingsmittel einfach zu bekommen war, erfreute es sich bei Giftmördern großer Beliebtheit. Erst im Jahr 1836 entwickelte der englische Chemiker John Marsh ein Verfahren, um Arsen nachzuweisen: die Marsh’sche Probe, mit deren Hilfe der Giftmischerin Marie Lafarge im Jahr 1840 das Handwerk gelegt werden konnte. Heute weisen die Labore der rechtsmedizinischen Institute Arsen noch Jahrhunderte nach dem Tod eines Menschen in dessen Haaren und Nägeln nach.