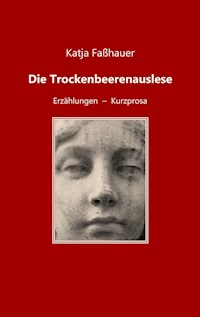
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die Trockenbeerenauslese" bietet eine Auswahl von Erzählungen und Kurzprosa, die der Suche des Menschen nach dem eigenen Leben nachgeht. In scheinbarer Naivität werfen Märchen und Fabeln politische Fragen auf, Kurztexte spiegeln Momente der Ausweglosigkeit, aber auch der Hoffnung wider. Biografische Bilder greifen Beobachtungen aus den letzten dreißig Jahren auf. Jedes Wort wirft einen besonderen Blick auf alltägliche Dinge.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Sammlung enthält Erzählungen und Kurzprosa, die die Suche des Menschen nach Erfüllung zum Thema haben. Ob ein Photograph an der Liebe zu scheitern droht oder eine Vogelscheuche mit ihrem Beruf hadert: Das Leben stellt seine Fragen immer wieder neu. Ratlosigkeit und Hoffnung liegen dicht beieinander, und eine Antwort kann am Ende wohl nicht gegeben werden.
Katja Faßhauer studierte Soziologie und Theologie. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main. Eine weitere Erzählung liegt in der Anthologie Frankfurter Verkehrsliteratour des Größenwahn Verlags vor.
Stürz dich ins Gravierende Dein ärgster Feind ist nicht der Tod Gabriele Scheld
Inhalt
Lukrezia
Die Trockenbeerenauslese
Hapax Legomenon
Der Garten
Die Johanne
Der vierzehnte Oktober
Märchen und Fabeln
Das politische Märchen
Aus dem Krieg
Nacht
Das letzte Märchen
Der Mummelputz
Kleine Dinge
Die Liebe in Harheim
Das Versprechen
Die Greisin
Größenwahn
Was auf uns zukommt
Das Feld
Der Bien
Memorabilia
1.
Kaventsmänner
2.
Die Nonne
3.
Das blaue Glas
4.
Der Blinde
5.
Margit
6.
Die Helden
7.
Der schwarze Prinz
8.
Em Beys
9.
Das Fastenbrechen
10.
An der Grenze
11.
Der neunte November
12.
Das Feuerwerk
Lukrezia
Anstelle eines Vorworts
Wie man schreibt? Vor allem natürlich braucht man einen Füller. Und einen Computer. Der ist meine Werkstatt. Dort findet der Teil des Schreibens statt, der harte Arbeit ist: Ordnen, glätten, Fäden verknüpfen, Wörter nachschlagen, Formulierungen etwa siebenunddreißig Mal verwerfen und so weiter und so weiter. Mühselig ist das. Zum Trost umgebe ich mich mit allerlei Postkarten. Bayerische Landschaften sind darauf zu sehen oder Segelschiffe oder Lukrezia Borgia, je nachdem. Damit ich etwas Aufregendes anschauen kann und nicht verzweifle.
Es gibt jedoch noch einen anderen Ort, an dem es weniger streng zugeht. Und viel geheimnisvoller. Den ich betrete, ich weiß nicht wie. Oh, herrlich ist er! Man muss nur auf Reisen gehen, und dann ist schon alles da: Farben, Verwirrungen, Unendlichkeiten.
So etwas zum Beispiel:
Ein sommerheißer Vormittag in Naumburg. Herr Nietzsche sitzt auf dem Holzmarkt, räkelig und auf ungepolstertem Stuhl. Vor einer Minute noch hat er gelesen, doch nun ist ihm das Buch auf den Schoß gesunken. Sein Blick ist zum Pflaster hin gesenkt und geht ins Unendliche. Der Schnauzbart verbirgt kein Lächeln. In unerbittlichem Ernst sitzt Herr Nietzsche und sinnt.
Vor ihm steht, in sehr fordernder Haltung, mit gerecktem Bubikopf und in die schmalen Hüften gestützten Händen, ein Mädchen, vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt. Mit wachem Gesicht sieht es zu des Denkers Stirn empor. Gerade eben hat es Herrn Nietzsche eine schwierige Frage gestellt. Gleich, wenn er nur ausgesonnen hat, wird er eine alte und große Antwort haben. So hofft das Mädchen.
Aber Herr Nietzsche kommt nicht mehr dazu: Eine Kindergartengruppe erstürmt den Platz. Zwanzig Vierjährige stürzen wie ein Jubel zum Holzmarktbrunnen und sind von ermatteten Erzieherinnen nicht zu halten. Herrlich prasseln funkelnde Fontänen, die Sonne brennt, in einer Rinne im Pflaster plätschert und strömt es zu Füßen des Herrn Nietzsche vorbei. Boote aus Papier, Schachteln und Hüte werden mit Geschrei und Aufwand zur Fahrt eingesetzt. Ach, viele gehen sofort unter, reißend und gefährlich ist die Flut. Einige wenige aber werden getragen und sausen davon. Ein kleines Mädchen rennt ihrem Schiffchen nach, das Kleid tropft, die nackten Sohlen hämmern nasse Abdrücke auf das Pflaster. Ohne stehenbleiben zu können, sieht das Mädchen sich nach diesen Abdrücken um. „Ich mache Spuren“, kräht es und jauchzt und rennt, „lauter Spuren!“ Meine Augen treffen Herrn Nietzsches entfernten Blick.
Vielleicht, ein wenig, lächelt er doch.
Oder dies: Der trostlos muffige Supermarkt in der Naumburger Salzgasse. Die Sonne ist auf einmal sehr weit weg. Ich treffe eine eingesunkene Greisin. Ihr dunkelbraunrotes Haar schwebt als fadenscheinige Wolke um ihren Schädel. Auf einen Rollator gestützt steht sie gebeugt und lange im Halbdunkel vor dem Süßigkeitenregal. Da sie fast blind ist, lese ich ihr eine Keksschachtel vor: weiche Biskuits mit Schokolade und Orangengeleefüllung. Dreihundert Gramm sind in der Schachtel, für neunundneunzig Cent. „Viel Süßes für so wenig Geld“, sagt die Greisin und sieht mich an. Ihre Augen leuchten, wie man es gar nicht ahnen kann. „Ich bin einundneunzig“, erzählt sie, „und ich habe nur ein Bein.“ Sie hebt die graue Polyesterhose über dem linken Knöchel an, darunter sehe ich einen künstlichen Fuß und eine Metallstange. Das ist ihr abhanden gekommenes Bein. „Merkt man gar nicht, oder?“ Sie zwinkert mir zu und rollatort mit den Keksen unter dem Arm davon.
Später sehe ich sie vor mir an der Kasse wieder. Mit Mühe unterscheidet sie Münzen. Es dauert lange. „Ich bin gleich weg“, sagt sie und lacht. Dann ist sie wirklich fort, und ich trage ihr Bild.
Und das noch, vor allem:
Die Südtreppe zum Ostchor im Dom Peter und Paul. Allerlei Getier strebt den Handlauf hinan, eine köstliche Girlande aus lebendiger Bronze. Ein Pfau gleich am Antritt, vor ihm aufsteigend die Schlange. Fliegen und Bienen auf langgestreckten Zweigen.
Der die Treppe erklimmende Mensch fügt sich staunend ein in diesen Zug der Kreaturen. Wohin nur will das? Immer mehr werden es, alle nach oben hingerichtet wie gezogen: Eine appetitliche Schnepfe, Spinnen, Libellen und Gekreuch, das schiebt sich und wimmelt und fußelt und fliegt. Irgendwo eine Schnecke, rund und hübsch und - man weiß es genau - nicht langsamer als all die anderen. Immer hinauf eilen sie, so heiter, so entzückend, dass schließlich der neugierige Mensch nicht anders kann: Er hebt den Blick, um zu erfahren, nach wem sich all die Hälse und Beinchen und Flügel recken.
Und dort, ganz oben, am Knick zum Podest, erspäht er das Ziel der Prozession: ein bronzenes Mönchlein. Vergnügt schaut es den Tieren entgegen. Drollig von Antlitz und in schludriger Kutte. Übergroß sind seine Hände und in einer stillen Geste erhoben, die das ganze Gewusel unter ihm umfasst. „Ach“, ruft der Mensch aus und springt über die letzte Stufe hin auf das Podest, „dass ich das jetzt erst sehe: Da steht ja der Heilige Franziskus und predigt den Tieren auf dem Felde und grüßt sie, als wären sie der Vernunft teilhaftig.“
Einen Augenblick lang steht der Mensch zufrieden da.
Dann dämmert ihm, dass dies noch nicht das Ende der Geschichte sein kann. Denn von irgendwoher muss das Mönchlein ja gekommen sein auf seinem Weg zum Treppensturz und den Tieren entgegen. Also schaut der Mensch noch einmal genau hin, und wirklich:
Im oberen Handlauf, im Rücken des Heiligen, findet er wundersame Spuren eingeprägt. Es ist kein gerader Pfad, den sie zeichnen, es sind Sprünge darin und Abwege und einmal sogar eine Umkehr. Vielleicht kein leichter Gang. Jedoch: Die Abdrücke der runden Füßchen sind sehr deutlich zu sehen, jede einzelne Zehe hat sich in die Bronze hineingedrückt. Entzückend und zierlich wie die eines vierjährigen Mädchens.
Wie hübsch dies alles ist! Ich wäre gerne dortgeblieben, aber das geht natürlich nicht. Irgendwann muss ich wieder an meinen Computer und ordnen und glätten und das etymologische Wörterbuch benutzen. Manchmal geht mir dabei durch den Sinn, dass es mit allem eine Bewandtnis haben muss. Einen Herzschlag lang – aber das kann man gar nicht beschreiben. Nicht einmal versuchen darf man das. Gottseidank klingelt das Telefon.
Lukrezia lächelt nachsichtig.
*** *** ***
Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas
Die Trockenbeerenauslese
Für A.R.
Im schwankenden Vorraum des ICE ist es eiskalt. Ich sehe auf die Uhr, zum dreißigsten Mal. Die Abfahrt in Freiburg war schon unpünktlich, mittlerweile schleppen wir eine Viertelstunde. Es riecht nach Klo und Maschinenöl. Ich hasse diesen Zug und seine Umständlichkeit. Dass ich überhaupt losgefahren bin. Noch ein paar hundert Meter zum Bahnhof, und wir schleichen, dass man den Verstand verlieren möchte. Metallräder kreischen, Weichen stoßen mich in unfassbare Richtungen. Ja, diese ganze Reise ist eine Zumutung. Bis Hattenheim liegen noch zwei Umstiege vor mir, in Karlsruhe und in Frankfurt. Wie Gebirge und reißende Flüsse. Wieder ein Ruck, ich kralle mich an einen Müllbehälter. Ladies and Gentlemen, in a few minutes. Die Durchsage versichert mir, dass mein Anschluss in Karlsruhe erreicht wird.
Immerhin.
Ich erkenne die Stimme des Schaffners wieder. Er klingt so jung. Er könnte mein Enkel sein. To Frankfurt via Wiesloch-Walldorf. Ich beuge mich krumm, um durch das Fenster zu sehen. Aber vor den Scheiben ist es bereits dunkel. Schwerer Regen. Keine Spur von einem goldenen Oktober. Thank you for traveling!
Ich fahre zu jemandem, der einmal meine große Liebe war.
In Karlsruhe renne ich mir die Seele aus den Stöckelschuhen. Der IC wartet tatsächlich, ist dann aber unerträglich voll. Es ist Sonntag. Die feuchte Menschenenge quält mich. Wie sehr mich alles auf dieser Reise stört. Auch Allens Brief, der in meiner Tasche liegt, stört mich. Ich komme nicht zur Ruhe. Gerne hätte ich einen freien Sitz neben mir. Ein absurder Wunsch. Überall quäkende Kopfhörer, Wurstbrote und gelangweilte Kinder. Ich schwitze. Zweimal gehe ich durch den ganzen Zug. Ein verbissenes drittes Mal.
Hinter Heidelberg schmerzen meine Beine so sehr, dass ich mich schließlich irgendwo niederlasse. In einem schwarzen Fenster spiegelt sich mein fahles Gesicht. Ich sitze da wie Helen Mirren in der New Yorker U-Bahn. Ein paar Reihen vor mir spuckt ein Tablet den Soundtrack eines Actionfilms aus. Schrille Schreie. Schwerter, zerfetzte Leiber und schrecklicher Tod. Ich schiebe die Hand in meine Tasche, bis ich Allens Brief berühre. Ein kurzer Brief. Natürlich muss es ein kurzer Brief sein. Er bricht ein vierzigjähriges Schweigen. Nur die wesentlichen Sätze. Auch dieser: „Denk nicht allzu sehr nach, denn Du musst bald kommen.“
Ich wäre lieber nicht gefahren. Dieses „bald“ macht mir Angst. Außerdem will ich Allen gar nicht sehen.
Mein Sitznachbar telefoniert in einer Sprache, die ich nicht erkenne. Er schreit. Wenn er nicht schreit, hustet er. Die Verbindung reißt ab, aber das Telefon klingelt sofort wieder. Erneutes Geschrei. Abbruch. Klingeln. So geht es im Minutentakt. Aber er riecht gut.
Allen war der dürre Junge auf der Schulbank neben mir. Der Dunkelhaarige auf den Konfirmationsfotos. Der Ami. Er war immer da. Eltville ist klein, da kennt man sich ein Leben lang. Als wir fünfzehn waren, haben wir uns bei Gewitter an einem Lagerfeuer geküsst. In solchen Augenblicken kommt man der Welt abhanden. Dann waren diese Sommer: Gedichte, Nancy Sinatra aus der Jukebox, Motorradfahrten im Minirock. Allen durchjagte die Kurven über Assmannshausen, als könnten wir fliegen, als wäre die nächste Biegung eine Rampe, und jetzt, jetzt, jetzt würden wir abheben hinauf in die blaue Luft über dem Rhein. Manchmal wurde mir schwindelig, und ich schlug ihn, weil ich es nicht mehr aushielt. Liebe, Wein und Dylan Thomas.
Natürlich war Allen in Frankfurt, als die Kaufhäuser brannten.
Irgendwann waren wir dann einundzwanzig. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich ging nach Freiburg. Ich musste fort. Vielleicht mochte ich es einfach nicht mehr, wenn mir manchmal schwindelig wurde. Ich wollte nicht abhandenkommen. Ich war eben nicht Bettine. Die herrliche Bettine. Die Bildhauerin. Mit der Allen dann bis zu den Sternen flog.
Und nun schreibt er, dass ich mich beeilen soll und er mich leider nicht abholen kann.
Die schaukelnde Fahrt lullt mich allmählich ein. In einem Traum stehe ich mit allzu vielen Koffern auf einem sinkenden Schiff. Das geschieht unter Fanfaren und blendendem Sonnenschein. Plötzlich steht jemand hinter mir und hüllt mich in einen Mantel. Da bricht mir vor Sehnsucht die Seele entzwei.
Ich werde wach, weil der Zug steht. Wie lange schon, kann ich nicht wissen. Wir warten auf freier Strecke wegen einer Vorbeifahrt. Es regnet immer noch oder schon wieder.
Dass Bettine vor einem Jahr gestorben ist, hat mir irgendjemand bei der goldenen Konfirmation erzählt. Irgendein Weib, das Informationen über mich ausschüttete wie einen Kübel Dreck: „Allen ist heute ja gar nicht hier … schade … wir hatten uns alle so … vor allem für dich schade … Bettine ist gestorben … das weißt du, gell … noch keine fünfundsechzig … stell dir nur … das Restaurant hat er verkauft ... den Weinberg auch ... das muss man verstehen … das ist ja jetzt alles ohne Bettine … wie soll er denn ohne Bettine!“
Als müsste ich wissen, wie es ohne Bettine ist.
Mit einem Knall überholt ein Zug. Die Gleise singen. Mein Sitz wankt wie ein Boot auf kabbeliger See. Das Muster auf der Lehne vor mir zeigt klirrende Halbkreise. Magenta auf Türkis. Augenblicke lang ist mir so übel, dass ich aufstehen muss. Ich suche den Schaffner, der diesmal eine Frau ist. Fast zwanzig Minuten Verspätung, erklärt sie mir, da werde der Anschluss sicher nicht warten.
Trotzdem renne ich auch in Frankfurt wieder. Und vorerst hat meine Eile etwas Berauschendes. Ich fließe durch Menschen und Rollkoffer. Dann sehe ich ein Gesicht: Eine schmale Gestalt, ein Mann mit schwarzen Augen. Es kommt mir vor, als schaue er mich an. Aber es ist natürlich nicht Allen. Ich versuche zu lachen. Das kann gar nicht Allen sein. Allen wartet in seinem Haus, in Hattenheim. Nein, das hier ist irgendein Fremder. Der gar nicht mich anschaut, sondern etwas anderes, hinter mir, über mir. Was, kann ich nicht wissen.
Als ich zum Gleis komme, ist mein Zug längst abgefahren. Selbst in größter Entfernung sind keine Rücklichter mehr zu sehen. Ich schaue ihm trotzdem nach. Die Luft ist jetzt sehr viel kälter als noch in Karlsruhe. Eine Werbestele wirft ihre brillanten Bilder in die Welt, unaufhörlich und sinnlos wie die Karussells in Prypjat. Bis zur nächsten Verbindung nach Hattenheim bleiben mehr als vierzig Minuten.





























