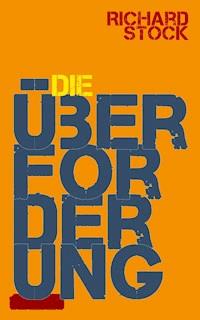
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es geschieht an einem dieser gewöhnlichen Donnerstage. Ich wache auf und weiß, dass alles anders ist. Das Bett, das Zimmer, die Geräusche, ich." Der namenlose Ich-Erzähler wacht eines Morgens auf und bemerkt, dass sein seelisches Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. In ihm tobt ein Sturm und stellt alles in Frage, was zuvor gesichert schien. In Episoden erfährt der Leser, wie es zu diesem Zusammenbruch gekommen ist und welche fatalen Konsequenzen der Protagonist daraus zieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Überforderung
Eine Novelle von Richard Stock
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 - Das Erwachen 2
Kapitel 2 - Die Freundin 10
Kapitel 3 - Der Vater 21
Kapitel 4 - Die Arbeit 28
Kapitel 5 - Die Mutter 34
Kapitel 6 - Der Streit 39
Kapitel 7 - Die Trennung 44
Kapitel 8 - Die Schule 48
Kapitel 9 - Die Leere 51
Kapitel 10 - Der Ausbruch 57
Kapitel 11 - Die Erkenntnis 62
Kapitel 12 - Der Plan 68
Kapitel 13 - Der Tag 72
Kapitel 14 - Das Ende 77
Kapitel 1 - Das Erwachen
Es geschieht an einem dieser gewöhnlichen Donnerstage.
Ich wache auf und weiß, dass alles anders ist. Das Bett, das Zimmer, die Geräusche, ich.
Natürlich ist es mein Bett und mein Zimmer, natürlich sind es dieselben Geräusche wie jeden Tag und natürlich bin ich es, der die Augen aufschlägt. Dennoch ist alles fremd und unwirklich.
Noch kann ich nicht feststellen, was anders ist. Aber ich spüre mit jeder Sekunde, die ich wach bin, wie mir die Realität, die ich kenne, entgleitet, in einem Abgrund verschwindet. Eine neue dunkle Wirklichkeit kriecht langsam aus einem Schlund hervor und erzwingt sich Platz in meinem Körper.
Ich versuche die Normalität festzuhalten, aber es gelingt mir nicht. Verzweifelt greife ich nach ihr, will nicht, dass sie hinab gezogen wird, aber sie zerbröckelt unter meinen Händen wie uraltes Papier und rieselt in die Dunkelheit meines Seins.
Über Nacht ist etwas mit mir geschehen. Irgendetwas hat diese geheime Pforte geöffnet.
Was ist passiert? Was ist denn so anders? Wo bist du Normalität?
Das kann nicht sein. Noch gestern Abend war alles in Ordnung. Nein. In Ordnung ist der falsche Begriff. Es war wie immer, es war wie jeden Abend in den letzten Monaten. Ein Abend ohne besondere Vorkommnisse.
Ich habe Probleme, ja, aber wer hat die nicht? Außerdem habe ich diese Probleme ja nicht erst seit gestern. Warum dann heute Nacht?
Ich wage mich nicht zu bewegen. Starr schaue ich nach oben, registriere jede einzelne Unebenheit an der weiß verputzten Decke, beobachte das Lichtspiel des angefangenen Tages. Ich höre auf meinen Atem, der wie durch einen Verstärker laut und deutlich das Verstreichen der Zeit in kleine Einheiten aufteilt. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
Ich versuche meine Gedanken diesem Rhythmus anzupassen, Ruhe zu gewinnen und mich an die letzten Reste einer mir bekannten Wirklichkeit zu klammern.
Aber es gelingt mir nicht.
Meine Gedanken koppeln sich von mir ab, machen sich selbstständig und bewegen sich immer schneller, beginnen zu rasen. Immer wieder jagen sie die kleine Straße meines Lebens rauf und runter, schauen durch jedes Fenster, blicken hinter jede Tür, hecheln rastlos durch jeden Winkel meines Ichs.
Ich spüre Panik aufsteigen, versuche die Gedanken zu ordnen, Langsamkeit in meinen Kopf zu bekommen, das Tempo innen den äußeren Begebenheiten anzupassen.
Ein Schwindelgefühl erfasst mich. Je schneller die Gedanken rasen, desto langsamer vergeht die Zeit.
Mir scheint es, als könne ich dem Licht beim Fluge zusehen. Zäh, wie dickflüssige Tropfen dringt meine zeitlupenhafte Wahrnehmung in den Kopf und wird mitgerissen in einen Zeitraffer aus Versatzstücken meiner selbst. Hilflos versuche ich die Fragmente meines Ichs festzuhalten, doch ohne Erfolg. Ich spüre nun körperlich, schmerzhaft, was mit Unfassbarkeit umschrieben ist.
Alles um mich herum erscheint so groß und ich fühle mich so klein, so staubkornhaft klein. Ein Krümel im Universum, ein kurzer Tick auf der unendlichen Uhr. Alles was mir gestern noch wichtig schien, ist plötzlich vollkommen ohne Bedeutung.
Obwohl ich, erstarrt zu einer steinernen Statue, im Bett liege, umfasst mich ein Strudel, ein Sog, der mich presst und zerrt, mich zerquetscht, zerreißt und immer wieder neu zusammenbaut. Alles dreht sich. Die Gedanken, das Zimmer, das Bett. Zersplittert taumle ich durch ein undefinierbares Etwas. Wie warmes Wasser, nur viel dickflüssiger, fast wie Honig.
Ein Kreischen, ein Brüllen, ein Inferno aus Geräuschen, schrill und spitz wie Eissplitter, schwillt an. Es wird zur Begleitmusik dieses Sturms, der durch mich hindurch fegt, alles auf den Kopf stellt, was für mich bisher Basis und Anker war.
Immer lauter und lauter, immer schriller werden die Geräusche, vermischen sich mit undefinierbaren Stimmen, die mich anbrüllen. Wie spitze Fingernägel, die auf einer Schiefertafel entlang fahren, krallen sich diese Geräusche hämisch in mein Bewusstsein, ritzen sich in meine Wahrnehmung und schwellen an zu einem Chor der Unerträglichkeit.
Mein Kopf steht kurz davor, zu platzen. Meine Augen scheinen aus meinem Kopf hervor zu quellen und aus meinen Ohren muss das Blut in Fontänen herausspritzen, so infernalisch ist diese Kakophonie aus Lauten, Stimmen und Geräuschen.
Und so plötzlich und unvermittelt, wie dieser Sturm gekommen war, so plötzlich und abrupt ist er vorbei.
Stille. Abgrundtiefe Stille. Nichts. Kein Ton, keine Bewegung, kein Gedanke. Schwärze.
Tick Tack, Tick Tack, Tick Tack.
Es ist vorbei, die Uhr an der Wand über dem Kühlschrank drängt in mein Bewusstsein. Ich lausche ihr. Ein Geräusch voller Vertrautheit, ein Mittwochsgeräusch.
Misstrauisch und angstvoll horche ich in mich hinein, suche nach Spuren dieses Sturmes, der eben noch durch mich hindurch fegte. Hat er sich nur kurz zurückgezogen, um sich dann unvermittelt und mit doppelter Heftigkeit erneut auf mich zu stürzen? Doch ich spüre nichts davon. Keine Spur, kein Lüftchen.
Noch traue ich mich nicht mich zu bewegen, liege bewegungslos im Bett und richte meine Aufmerksamkeit auf die Geräusche im Zimmer und in meinem Kopf. Aber nichts ist mehr von diesem morgendlichen Albtraum zu bemerken.
Zaghaft versuche ich meine Finger zu bewegen, nicht sicher, ob dies gelingen würde. Aber es geht.
Vorsichtig richte ich mich auf.
Es scheint tatsächlich vorbei zu sein.
Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern.
Ein wunderbarer Tag ist angebrochen.
Ich lache grimmig in mich hinein. Es kommt mir wie eine Verhöhnung vor, eine spöttische Laune des Lebens.
Wie ein Überlebender nach einem verheerenden Wirbelsturm aus seinem Schutzkeller, so krieche ich langsam aus meinem Bett. Auf wackligen Beinen stelle ich mich hin und lasse den Blick durch das Zimmer schweifen. Irgendwie habe ich erwartet ein Chaos aus übereinander getürmten Möbeln und herumflatternden Unterlagen vorzufinden, aber alles ist noch auf seinen Platz. Das Zimmer sieht genauso aus, wie gestern vor dem Zubettgehen. Sogar meine Hose liegt akkurat gefaltet über der Stuhllehne. Als ob nichts, rein gar nichts geschehen wäre. Fast bin ich enttäuscht. Ein zerstörtes Zimmer wäre ein Beweis für ein äußeres Ereignis gewesen. Eine zwangsläufige Naturkatastrophe, die jeden hätte treffen können. Aber beim Anblick dieser Ordnung ist mir klar, dass es nur mich getroffen hat. Mich ganz alleine.
Unschlüssig stehe ich mitten im aufgeräumten Zimmer und bin erstmal von der Situation überfordert.
Meine Beine zittern, meine Gedanken sind noch nicht sortiert, fließen nicht in gewohnten Bahnen.
Aber dann spüre ich, dass ich Hunger und Durst habe. Diese profane Erkenntnis wirkt wie ein Startschuss und mein interner Motor setzt sich in Betrieb. Nackt gehe ich in die Küche, setze Teewasser auf und schiebe zwei Toastscheiben in den Toaster.
Mein Blick fällt auf die Uhr, die mich in die Realität zurückgeholt hat.
07.30 Uhr. In einer Stunde muss ich auf der Arbeit sein. Während ich warte, dass die Toastscheiben herausspringen, schaue ich aus dem Fenster, beobachte den normalen Alltag da draußen.
Ein Plakat fordert mich auf, Wählen zu gehen. Ein Hund an einer Hundeleine hebt sein Bein und die alte Frau, am anderen Ende der Schnur, schaut in mein Fenster. Kann sie mich sehen? Der Wasserkessel pfeift.
Alltägliche Handgriffe treiben mich weiter, automatisch spule ich meinen Standardmorgen ab.
Ich vermeide zu denken. Tief in mir – ich spüre es genau - brodelt ein Vulkan und ich habe Angst vor dem Ausbruch, habe Angst vor der Lava der Veränderung, die mich verbrennen könnte.
An unsichtbaren Fäden werde ich, eine Marionette der Routine, durch die Wohnung gezogen. Am Ende dieser Prozedur stehe ich angezogen vor der Haustür und gehe die Straße Richtung Innenstadt hinunter.
Ein kleiner Junge mit einem roten Anorak sitzt auf der Treppe beim Bäcker. Er schaut mich mit großen Augen an und lacht. Ich lache zurück, bin aber schon an ihm vorbei, nicht sicher, ob er mein Lachen mitbekommen hat. Also bleibe ich stehen und drehe mich um. Der Junge ist nicht mehr da. Er wird wohl in den Laden gegangen sein.
Meine Augen fixieren die Stelle, wo er eben noch gesessen hat. Es kommt mir alles so unwirklich vor. So absurd. Saß da wirklich ein Junge oder habe ich mir das nur eingebildet? Sein Lachen klingt noch in meinen Ohren, aber habe ich es wirklich gehört? Ich weiß es nicht.
Ist auch egal, denke ich trotzig und wende mich mit einem Ruck wieder meinem Weg zu und schreite aus, um im nächsten Augenblick wieder stehen zu bleiben. Verdammt noch mal, wo gehe ich eigentlich hin? Das ist doch nicht der Weg zum Auto.
Hinter mir flucht ein Mann, der mir beinahe in die Hacken gelaufen wäre, als ich abrupt abstoppte.
»Entscheide dich mal. Gehen oder stehen, Du Träumer«, grummelt er im Vorübergehen.
In Gedanken forme ich eine Erwiderung und schleudere sie ihm mit meinen Blicken hinterher. Wirkungslos prallt sie von seinem Rücken ab.
Ich schaue auf die Uhr. Ich komme zu spät zur Arbeit. Die Kollegen werden sauer sein. Donnerstag ist immer viel los im Büro.
Unschlüssig stehe ich auf dem Bürgersteig und überlege. Es fällt mir schwer, einen klaren Entschluss zu fassen. Immer wieder starte ich einen Versuch meine Gedanken zu ordnen, eine Entscheidung zu treffen. Immer wieder entgleitet mir der Gedanke, verschwindet in der Leere, die sich in meinem Kopf breitgemacht hat.
Der Sturm in mir ist zwar vorbei, aber ich bin noch sehr mitgenommen und aufgewühlt.
Langsam bewege ich mich weiter. Schritt für Schritt.
Wohin?





























