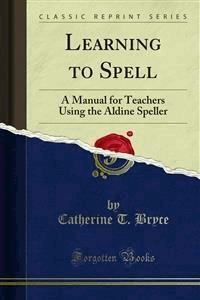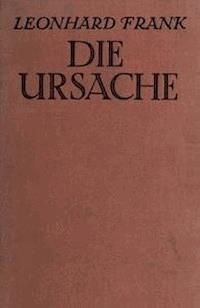
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Project Gutenberg
- Sprache: Deutsch
Gratis E-Book downloaden und überzeugen wie bequem das Lesen mit Legimi ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 161
Ähnliche
21.-25. Tausend
LEONHARD FRANKDie UrsacheErzählung
1929Im Insel-Verlag zu Leipzig
Copyright 1915 by Insel-Verlag in Leipzig
Lisa Ertel gewidmet
1
Nach vierzehn unter der ständigen Beobachtung verbrachten Jahren, daß er eine entlarvte Illusion nach der andern für eine Portion Seelenschmutz hatte hingeben müssen, verspürte der vermögenslose Dichter Anton Seiler im Winter 1907, ohne die Ursache zu kennen, unvermittelt und heftig den Drang, von Berlin in die kleine Stadt zu reisen, wo er als Sohn eines Wagnergesellen auf die Welt gekommen war.
Die resultatlos verbrauchte Energie hatte sein Gesicht scharf gemacht wie das eines gefährlichen, rücksichtslosen Verbrechers. Alle Reisenden im Abteil fühlten einen Widerstand, den Dichter mit in die Unterhaltung zu ziehen. Und alle verstummten vor Verwunderung, weil ganz unerwartet die scharfe Verbrechermaske seines Gesichts von einem traurigen Lächeln zerbrochen wurde, als er dem im Seitengang stehenden kleinen Mädchen zunickte.
In der Nacht vor dem Reiseentschluß hatte der Dichter von einem bestimmten Schulausflug, durch den heimatlichen Laubwald, geträumt: der gefürchtete Lehrer Mager geht voraus, wendet sich drohend um. Da wechseln, wie damals, die fünf Rehe über den Weg. Besonnte Morgendämpfe. Vogelgeschrei. Die Fröhlichkeit geht durch mit dem Achtjährigen, über den gefährlichen Lehrer weg, reißt alle Schulkameraden mit. Von Ast zu Ast mit dem Eichhörnchen in die Höhe fliegend, sitzt er auf dem letzten wippenden Zweig der Baumkrone und singt lachend in wildem Glück zum blauen Sommerhimmel hinauf. Tief unten staunen die Schulkameraden. Plötzlich ist der Himmel tintenschwarz. Alle sitzen, Milch trinkend, fröhlich im Wirtshausgarten — er allein steht vor dem Zaune. Der Lehrer Mager hält ein kirchturmgroßes Milchglas in der Hand, in der anderen das heiße Herz des Dichters, stopft es ihm ins Gehirn und schließt den Kopf wieder. Mit diesem ununterbrochen schmerzhaft zuckenden Druck hinter der Stirn erlebt der Dichter viele peinigende Demütigungen späterer Jahre traumhaft vergrößert noch einmal.
Die Fingernägel tief in die Kopfhaut gekrallt, in dem Bemühen, das Gehirn freizulegen und den Druck herauszureißen, erwachte er, wußte nicht mehr, was er geträumt hatte.
Und fand sich etwas später plötzlich auf dem Bahnhof, sah dann stundenlang gedankenlos aus dem Fenster auf die vorübergleitende Landschaft.
„Tanten, Anfangsgründe!“ hörte er wie aus weiter Ferne den ihm gegenübersitzenden Herrn zwei Damen zurufen.
„Ja, das ist keine Erziehung.“ Die Damen waren klein und trugen beide Klemmer. Die vier kurzen Beine baumelten gleichmäßig über dem Kokosteppich.
Der Dichter war vergebens bemüht, sich an seinen Traum zu erinnern.
Die eine Dame sagte: „Wenns auch pedantisch ist, das ist ganz gut für den Jungen.“
„Ja, ich kann auch gar nicht anders. Anfangsgründe sind die Hauptsache, Tanten.“
„Ganz gut für den Jungen!“
„Nein . . . es ist nicht gut für den Jungen“, sagte der Dichter plötzlich und sah die Damen an.
„Was meinen?“
„Nichts . . . Es ist eben auf keinen Fall gut für den Jungen.“
Der Schaffner rief etwas Unverständliches. Der Zug fuhr langsam in die Station ein.
Das Gesicht des Dichters war wieder gespannt und scharf.
Aus dem Gefühle heraus, daß die Reisenden nicht nur weiterfuhren, sondern immer an ihm vorbeigefahren waren, verließ er, ohne zu grüßen, unsicher das Abteil und den Zug. Verlegen empfand er beim Durchqueren der Bahnhofshalle den Kontrast zwischen seinen neuen eleganten Lackschuhen und dem alten, fleckigen Anzug.
Auf der Treppe blieb er zurückweichend stehen vor dem bekannten Platz, den Kirchtürmen, dem Geruch der Heimatstadt. Rasend schnell durchliefen die Erinnerungen sein Gehirn: Armut, Prügel, Demütigungen, Schulqualen; so daß er den Kopf einzog und geduckt gegen die Stadt blickte. „Dieses böse Tier hat mir die Seele krank gemacht“, flüsterte er. „. . . Nein, ich habe kein Gepäck.“
Der Dienstmann trat wieder zurück zu seinen Kollegen; und der Dichter fühlte sich geschlagen, als er die geringschätzig musternden Blicke der Dienstmänner sah.
„Ich habe doch längst erfahren, daß ich ohne Gepäck kein Mensch bin“, sagte er, nachdem er sich die ganze Bahnhofstraße hinuntergequält hatte — und schaukelte erschrocken gegen ein Schaufenster, denn er war der Meinung, der schräg über die Straße auf ihn zukommende Herr sei Herr Mager, sein früherer Lehrer.
Ein Schuster, der ein Paar schwebende Röhrenstiefel an den Stulpen trug, begrüßte den Herrn mit dem Titel Kanzleirat. Der trat, mit den Händen fuchtelnd, wütend und schnell von einem Fuß auf den andern und beschwerte sich. Der Schuster beugte sich hinab, drückte das Oberleder, zuckte die Schultern — gegen das Knarren sei nichts zu machen. Der Kanzleirat fauchte speichelspritzend den Schuster an, schritt knarrend davon.
Und dem Dichter, der auf der ganzen Reise vergebens darüber nachgegrübelt hatte, was ihn zwang, die Heimatstadt zu besuchen, war von dem unvermittelten gierigen Haß auf seinen Lehrer die Denkfähigkeit vollkommen niedergeschlagen worden.
Noch immer lehnte er gelähmt am Schaufenster und sah dem Kanzleirat nach, den er für seinen Lehrer gehalten hatte. Nur allmählich stellte sich die Denkfähigkeit wieder ein und mit ihr die vom Lehrer empfangenen Demütigungen, die er in den vierzehn Berliner Jahren oft und kritisch durchdacht hatte. „Diese Gemeinheiten können nicht der Grund meines unvermittelten Hasses sein“, sagte er langsam.
„Ist es denn aber möglich, daß ein Mensch als Kind qualvolle Erlebnisse hatte . . ., von denen er nichts mehr weiß, die aber in seinem Gefühlsleben ein dunkles Dasein weiterführen und plötzlich einen Haßausbruch verursachen?“
Der drückende Klumpen unter seinem Brustbein sprach dafür.
„Aber was war es? Was?“ flüsterte er, schloß die Augen und horchte, ohne zu denken, nach innen — glaubte plötzlich, Kaffeegeruch zu riechen, sieht den Vater morgens die Wohnung verlassen, eine Frau, die zum Fenster hinaus „Karo“ ruft. — Erinnerungsfetzen, welche er anfangs in keinen Zusammenhang bringen konnte, die sich jedoch durch ein weiteres Glied (der Hund fährt kläffend nach ihm) zu einem ganz bestimmten Schultage verdichteten. Seine Beklemmung steigerte sich; er sieht die Bankreihen, frohe Aufregung unter den Schülern. Plötzlich wurde er heiß. „Wegen des Schulausfluges.“
„Schulausflug?“ flüsterte der Dichter immer noch, als er schon die enge, dumpfriechende Treppe zur Elternwohnung hinaufstieg. Belastet und verwirrt blieb er vor der Gangtür stehen, ohne zu läuten, weil er fühlte, daß er nahe daran war, die Ursache seines Hasses gegen den Lehrer zu finden. „Schulausflug durch den Wald . . . Wald.“ Da verlor er das Gedächtnis, so gänzlich, daß er nicht wußte, wo er sich befand, als der Vater die Tür öffnete und erstaunt zurückwich, weil ihm sein Sohn „tückisch . . . tückisch“ ins Gesicht sagte.
Ganz schnell rief der Dichter dem Vater zu: „Wart, wart, wart!“ Und: „Ah! . . . Aha! Ja, ich wollte euch einmal besuchen.“
„Kommst du endlich einmal zu uns?“
„Ja, wegen des Lehrers . . . Vielleicht bin ich wegen des Lehrers gekommen.“
„Wegen des Lehrers? . . . Gehe nur hinein, Anton, zur Mutter. Ich muß in die Singprobe.“
„So? . . . Bist du immer noch Vorstand vom Gesangverein ‚Zwischen grünen Bäumen‘?“
„Ja freilich!“ Der Vater lächelte freundlich und schüttelte seinem Sohne schnell die Hand zum Abschied, um rechtzeitig in die Singprobe zu kommen. „Gehe nur hinein zur Mutter.“
Schweißnaß trat er der Mutter entgegen.
Der stiegen die schnellen Tränen in die Augen.
„Nun, Mutter“, sagte er weich. „Nein nein!“ Und er drückte das Schluchzen zurück.
„Das weiß ich nicht, wie lange ich hier bleibe.“
Die Mutter legte den alten Kopf in die Hand, an den Mund die kleinen Finger, die von der Scheuerarbeit stumpf geworden waren.
„An was denkst du denn, Mutter?“
„In diesem Bett schläft der Vater“, deutete sie, „und ich in dem.“
Der Dichter sah umher im einzigen Zimmer, in dem nichts verändert war. Nur der Stahlstich nach einer Kreuzigung von Rubens fehlte. „Ich schlafe eben wie früher neben dir auf dem Kanapee . . . Wo ist denn der Christus?“
„Den hab ich für eine Mark verkauft.“
„So, du hast den Christus verkauft? . . . Unsern Christus.“
„Ja. O Gott! Es ging nicht anders. — Womit soll ich denn deine schönen Schuhe putzen? Wir haben nur unsere Fettglanzwichse.“
„. . . Jetzt muß ich dich aber doch fragen, Mutter. Sag, bist du wirklich so viel kleiner geworden?“ Er sah verwundert hinunter auf ihren weißen Scheitel.
Und sie lächelnd auf zu ihm. „. . . Ich war doch nie größer.“
Und das Leben könnte so schön und hell für alle sein, dachte der Dichter. — Arbeit, Freiheit. Eine Frau mit weißem Gesicht und dunklen Augen. Das Schlafzimmer . . . schön beleuchtet. „Hast du’s erfahren, Mutter? Einsperren wollten sie mich, wegen meines Artikels.“
„Ja, ich habs gelesen . . . Ich hab ihn aber verstanden. Ich sag dir, ich hab deinen Artikel ganz gut verstanden.“
Unversehens wurde der Dichter heiter. „Sie nannten mich einen Weltverbesserer.“
„Ja, ja . . . Wenn der Vater nächstes Jahr wirklich die drei Mark Wochenlohn mehr bekommt . . ., dann gehts uns auch besser. Dann wirds schön sein.“
„Sechzig ist der Vater jetzt?“
„Oh! ins Siebenundsechzigste geht er.“
Guter Gott, dann wirds schön sein, glaubt sie. Immer noch Illusionen, immer noch, dachte der Dichter. Und sein Leben lag entlarvt und gemein vor ihm. „Dann wirds schön sein“, sagte er zärtlich zur Mutter, in plötzlicher, trauriger, ungeheurer Liebe, worauf die Mutter beglückt ihn neben sich aufs Kanapee zog.
Und durch die nach vierzehn tödlich harten Jahren zum ersten Male wieder empfundene Weichheit schritt aufrecht der Lehrer. Das Gesicht des Dichters wurde spitzig.
Es klingelte.
So starr blickte der Dichter zur Wand, daß er das Aufstehen der Mutter nicht bemerkte, die lautlos aus dem Zimmer ging.
„Schulausflug . . . durch den Wald“, tastete er, den Atem angehalten, und horchte dabei auf das Schimpfen der fremden Stimme in der Küche.
Wie ein junges Mädchen sieht sie jetzt aus, dachte der Dichter gerührt, als er seine Mutter ansah, die verlegen zurückkam. Bis zum weißen Scheitel stieg in ihr die Schamröte.
Seine Gedanken kehrten sofort zum Schulausflug zurück.
„Die Milch . . .“
„Die Milch?“ unterbrach der Dichter entsetzt.
„Weil ich die Milchrechnung nicht bezahlen konnte.“
„Halt!“ brüllte er und sprang auf. „Nein, still!!“ Mit der Hand hielt er die Mutter weg und blickte starr auf das Schulerlebnis, das jetzt scharf aufhellte. Sein ganzer Körper begann zu zittern, sein Gesicht verzerrte sich wie das eines Verfolgungswahnsinnigen, den der Arzt in eine Krise versetzt hat. Bebend klammerte er sich an die Mutter an — der Traum blitzte auf. Und seine weißen Lippen formten die Worte: „Weil ich bei dem Schulausflug die zehn Pfennige nicht hatte, um das Glas Milch bezahlen zu können . . .“
„Anton! Anton! O Gott! Was ist denn! Trink Wasser . . . Willst du ein Glas Milch?“
„. . . ließ mich der Lehrer nicht mit ins Wirtshaus gehen. Ich mußte vor dem Zaune stehen . . . vor allen Schulkameraden.“
Er stieß ein klagendes Wimmern aus.
„Anton, komm doch zu dir! Ich geb dir Wasser . . . ein Glas Milch!“
Da flehte der Dichter kindlich: „Oh, bitte, Glas Milch . . . Mir auch Milch.“
Als die Mutter zurückkam, war die Krise vorüber. Wunderbar lächelnd saß er auf dem Kanapee und nahm, glücklich wie ein Knabe, die Milch aus der Mutter Hand. „Acht Jahre war ich alt, damals.“
„Was ist denn?“
„Ganz vergessen hatte ich es.“
„Was redest du?“
„Später. Ich erzähle dirs später.“ Er hob das Milchglas. „Die ist nicht bezahlt?“
„Jetzt warum redest du so . . . Das richt ich schon alles noch.“
„Mutter, Milch muß man bezahlen können . . . Sonst leidet man zweiundzwanzig Jahre lang darunter.“
„. . . Dich versteh ich nicht mehr.“
Er stellte das Milchglas auf den Tisch zurück, ohne getrunken zu haben. „Ihr seid also immer noch so furchtbar arm wie früher?“
„Oh, Anton! . . . Aber wenn der Vater jetzt die drei Mark mehr bekommt, dann gehts uns besser. Wir sehn getrost in die Zukunft.“
„So wird man zum Weltverbesserer.“
„Das Brot soll jetzt auch um sieben Pfennige billiger werden . . . Erinnerst du dich noch: als Junge bist du oft im Dunkeln mit einem Sack an die Rückseite der Infanteriekaserne geschlichen.“
„Um billiges Kommißbrot von den Soldaten zu kaufen.“
„Die wollen lieber Weißbrot essen.“
„Und einmal haben die Soldaten einen Eimer voll Spülwasser über mich geschüttet, anstatt mir Brot zu geben.“
„Tropfnaß bist du nach Hause gekommen.“ Die Mutter legte dem Dichter die Hand auf die Schulter und lachte. „Wie ein Hund, der ins Wasser gefallen ist. So naß. Oh, und fettig warst du!“
„. . . Und der Vater hat mich geprügelt dafür.“
„Ja no, weil halt dein ganzer Anzug verdorben war.“ Der Dichter sagte nachdenklich: „Viele solche Sachen . . . Aber das eine, das mit der Milch, habe ich nicht mehr gewußt.“
„Trink sie doch!“
„Warum nicht!“
„Und ich muß jetzt ins Bett, Anton. Um fünf Uhr früh geht der Vater auf die Arbeit. Ich richt dir das Kanapee zum Schlafen.“
An der Fensterwand hing die Schwarzwälder Uhr. Sie legten sich nieder.
Der Perpendikel ging zwischen Mutter und Sohn hin und her.
So viele Familien es gibt, so viele Wohnungsgerüche gibt es, dachte der Dichter. „Hier riechts nach Schweiß und süßem Stroh,“ flüsterte er im Halbschlaf, „nach Vater.“
„Der kommt auch bald heim.“
„Das Käfiggitter ist aus Gold.“
„Was sagst du?“
„Nein, ich hab doch kein Gepäck!“
„Schläfst du?“ Die Mutter horchte auf die Atemzüge ihres Sohnes und verlöschte die Kerze.
Am andern Tage, beim Spaziergang durch das Heimatstädtchen, schienen dem Dichter die Häuschen kleiner geworden, zusammengeschrumpft, zur Hälfte in die Erde gesunken zu sein.
Als er noch einmal durch die einzige Geschäftsstraße ging, war er schon im Bilde seiner Jugend. Nichts hatte sich verändert im Städtchen. Nur dreißig Meter Asphalt waren in der Geschäftsstraße gelegt worden. Unauffällig beobachtete er die Bürger, die stehen blieben und sich befriedigt über den Asphalt unterhielten.
Der Dichter ging ins Café, durchblätterte die neuesten Zeitungen und fand, daß er sie schon vor seiner Abreise in Berlin gelesen hatte. Wie einen Automobilrennfahrer, dessen Motor auf der Strecke aussetzt, befiel ihn Beklemmung, in dem Bewußtsein, sich in einer Stadt zu befinden, die drei Tage hinter der Welt herlebte.
Die Öde steigerte sich, da es ihn beim Rückweg wieder zur Geschäftsstraße zog, die ihm schon nichts mehr Neues bot.
Eigensinnig bog er in die Lochgasse ein. Die war dunkel und so eng, daß die Dachrinnen der krummen Häuserreihen einander fast berührten.
Erst als er schon vor dem Hause stand, dachte er daran, daß auf seine Frage hin die Mutter ihm gesagt hatte: Herr Lehrer Mager wohne jetzt in der Lochgasse.
„Früher wohnte er doch am Rennweg.“ Der Dichter las den Namen auf dem Porzellanschild, blickte am Hause empor und fragte sich mißtrauisch, wieso denn erst jetzt, da er schon vor dem Hause stand, ihm einfiel, daß die Mutter gesagt hatte: der Lehrer Mager wohne in der Lochgasse.
Da erinnerte er sich, daß er nach dem ergebnislosen Versuch in der Eisenbahn, sich seinen Traum ins Gedächtnis zu rufen, flüchtig daran gedacht hatte, den Lehrer zu besuchen. Dieser wiederholten Vergeßlichkeit wegen steigerte sich sein Mißtrauen. „Fehlt mir vielleicht der Mut, den Lehrer zu besuchen, weil ich diese Angelegenheit zweimal von mir wegschob?“
Und plötzlich klopfte rasend sein Herz, bei dem Entschluß, die Treppe hinaufzusteigen. Die Angst des Schulknaben war ihm in die Brust gesprungen. In Gedanken stand er vor dem Lehrer: achtjährig. Und mußte die Augen schließen und die Hände tastend vorstrecken, um ein Minimum von Selbstbeobachtung erübrigen zu können.
„Aber ich bin doch dreißig Jahre alt“, sagte er laut, las grübelnd den Namen auf dem Schild, klinkte die Haustür auf — da stiegen Jahre und Erfahrung von ihm weg in die Luft. Als Schulknabe schlich der Dichter angstbehangen aus der dunklen Lochgasse.
„Es ist mir also unmöglich?“ fragte er und blieb stehen, in der sonnigen Geschäftsstraße. „Bring die Furcht nicht heraus aus mir? . . . Ist das mit allem empfangenen Leid so?“ fragte er ganz langsam. „Dann trüge der Mensch alle erlittenen Demütigungen mit sich herum? Bis ins hohe Alter. Sein ganzes Leben würde davon bestimmt?“
„Gott, ich fahre sofort nach Berlin zurück. Was geht mich der Lehrer an“, sagte er und ging in der Richtung seiner Elternwohnung, um Abschied zu nehmen.
Im Spiegelglas eines Schaufensters sah er sein Gesicht — ein trotziges Schulknabengesicht. Verblüfft starrte er es an, so daß es sich unter seinem Blicke zu einem verblüfften Männergesicht verwandelte.
„Mit Trotz ist nichts erledigt“, flüsterte er.
Und ohne daß er bewußt den Willen dazu hatte, wandte er sich um und eilte, dicht an den Häuschen entlang, fluchtartig direkt zum Bahnhof.
2
„Den Sack mit Ihren Sachen habe ich auf den Speicher getragen“, sagte die Berliner Wirtin und blieb kampfbereit im Vorzimmer stehen. „Mein neuer Zimmerherr hat die zwei Großen vornehinaus gemietet. Und da hat er Ihre Kammer dazu gewollt.“
„Ich hatte ja nicht gekündigt.“ Der Dichter blickte unausgesetzt aufs Flurfenster, gegen das die harten Schneeperlen prasselten.
„Mein neuer Herr hat gleich für zwei Monate vorausbezahlt.“
„In vierzehn Tagen bekomme ich ganz bestimmt zwanzig Mark. Damit hätte ich Ihnen meine Schuld bezahlt.“
„Die zwanzig Mark sollen Sie jetzt schon . . . ich weiß gar nicht, wie lange Sie die schon bekommen sollen. Es ist ja möglich, daß Sie einmal zwanzig Mark bekommen . . . Mein neuer Herr bezahlt mich im voraus.“
„Ich bezahle auch.“
„Sie sagen immer: ich bezahle . . . Es ist ja möglich.“
„Aber Sie stehen der Sache skeptisch gegenüber“, rief fröhlich der eintretende neue Zimmerherr und reichte seinen Zylinder der Wirtin, deren fettige Hände die Schürze erst eifrig rieben.
Während sie den Zylinder vorsichtig hielt, zog der neue Herr seinen Pelz aus. Und verbeugte sich: „Doktor Wiener.“
Der Dichter sah gleich wieder zurück aufs schneebeschlagene Flurfenster. — Was hab ich hier noch zu suchen? Meinen Sack und fort!
„Von Ihnen weiß ich alles, alles, Herr Seiler. Sie kenne ich wie meinen Bruder“, sagte Doktor Wiener und tätschelte der erschreckenden Wirtin beruhigend die Schulter. Sein Tonfall sank: „Was wollen Sie, warum soll denn der Mensch nicht plappern?“ Doktor Wieners gesundrotes, hübsches Gesicht lachte ununterbrochen. Sein blondes Schnurrbärtchen sprühte Frische und Glanz.
Der Dichter dachte: entweder fort, oder ein gleichgültiges Gesicht machen!
„Also, in einem Vierteljahr übernehme ich das Sanatorium meines alten Herrn, sehen Sie, und bis dahin praktiziere ich noch in der Klinik. Da bin ich fast den ganzen Tag nicht zu Hause. Sie können demnach ruhig in der Kammer wohnen, Herr Seiler. Darum handelt sichs doch . . . was?“
„Wenn Sie denken“, stotterte der Dichter und suchte, trotz seiner Verlegenheit, herauszubekommen, was für ein Parfüm vom Doktor ausströmte. „Ich könnte ja ein ganz anderes Zimmer suchen gehen.“
„Ganz anderes? . . . Überhaupt, bei dem Wetter! Papperlapapp! Sie bleiben hier“, schnitt der Doktor das Gespräch ab. „Ist gut geheizt bei mir?“
„Jaaa, freilich, angenehm durchwärmt.“
„Ist ja großartig!“ rief der Doktor, ohne die Wirtin anzusehen, die neben ihm herlief und beteuernd auf ihn einredete.
„Na, da holen Sie halt Ihren Sack wieder runter!“ sagte sie, nachdem der Doktor in seinen Zimmern verschwunden war.
Und als der Dichter neben seinem Sack in der Kammer saß, dachte er darüber nach, ob er auf eigene oder auf des Doktors Rechnung die Kammer bewohne.
„Wo waren Sie denn heute nacht wieder?“ Sie stand unter dem Türrahmen.
„Nirgends. Gar nirgends!“
„Das geht nicht. Die Leute im Haus . . . Und überhaupt!“
Der Dichter wandte sein einziges Mittel an, die Wirtin in Bewegung zu setzen: blickte ihr wortlos in die Augen, die abschweiften, wieder auf den Dichter sahen, in die Ecke.
Dann hörte er sie in der Küche schimpfen.