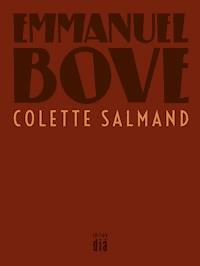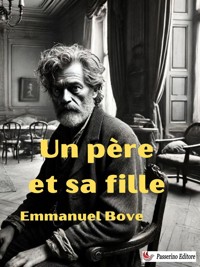Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Werkausgabe Emmanuel Bove
- Sprache: Deutsch
In "Die Verbündeten", einem seiner Hauptwerke, das 1927 in Paris erschienen ist, porträtiert Emmanuel Bove seine Mutter und seinen Bruder Léon, die sich im Kampf gegen ihr Schicksal zusammengetan hatten. Geld, eine wahre Obsession im Leben und Werk Emmanuel Boves, ist auch hier eines der wichtigsten Themen. Seine Beziehung zu Mutter und Bruder war lebenslang schwer davon belastet, dass die beiden ihn als ihren Ernährer betrachteten – ihn, den Schriftsteller, der selbst kaum über die Runden kam. Radikal und schonungslos zeigt Bove seine Figuren in ihrer Unfähigkeit zu handeln, in ihrem ausweglosen Scheitern. Peter Handke, ein großer Bewunderer Emmanuel Boves, meinte zu "Die Verbündeten": "Ich könnte so ein Buch nicht schreiben. Man bräuchte viel Mut dazu." "Bove-Leser haben eines gemeinsam: Sie werden süchtig, und je mehr sie lesen, nach desto mehr verlangen sie." [Quelle: Wolfgang Matz, Die Zeit] Zum Weiterlesen: "Emmanuel Bove. Eine Biographie" von Raymond Cousse und Jean-Luc Bitton ISBN 9783860347096
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
In »Die Verbündeten«, einem seiner Hauptwerke, das 1927 in Paris erschienen ist, porträtiert Emmanuel Bove seine Mutter und seinen Bruder Léon, die sich im Kampf gegen ihr Schicksal zusammengetan hatten.
Geld, eine wahre Obsession im Leben und Werk Emmanuel Boves, ist auch hier eines der wichtigsten Themen. Seine Beziehung zu Mutter und Bruder war lebenslang schwer davon belastet, dass die beiden ihn als ihren Ernährer betrachteten – ihn, den Schriftsteller, der selbst kaum über die Runden kam.
Radikal und schonungslos zeigt Bove seine Figuren in ihrer Unfähigkeit zu handeln, in ihrem ausweglosen Scheitern. Peter Handke, ein großer Bewunderer Emmanuel Boves, meinte zu »Die Verbündeten«: »Ich könnte so ein Buch nicht schreiben. Man bräuchte viel Mut dazu.«
»Bove-Leser haben eines gemeinsam: Sie werden süchtig, und je mehr sie lesen, nach desto mehr verlangen sie.« (Wolfgang Matz in Die Zeit vom 14. Dezember 2000)
Mehr zum Autor und seinem Werk unter www.emmanuelbove.de
Der Autor
1898 als Sohn eines russischen Lebemanns und eines Luxemburger Dienstmädchens in Paris geboren, schlug sich Emmanuel Bove mit verschiedenen Arbeiten durch, bevor er als Journalist und Schriftsteller sein Auskommen fand. Mit seinem Erstling »Meine Freunde« hatte er einen überwältigenden Erfolg, dem innerhalb von zwei Jahrzehnten 23 Romane und über 30 Erzählungen folgten.
Nach seinem Tod 1945 gerieten der Autor und sein gewaltiges Œuvre in Vergessenheit, bis er in den siebziger Jahren in Frankreich und in den achtziger Jahren durch Peter Handke für den deutschsprachigen Raum wiederentdeckt wurde. Heute gilt Emmanuel Bove als Klassiker der Moderne.
Der Übersetzer
Thomas Laux, geboren 1955 in Düsseldorf. Studium der Germanistik und Romanistik, Staatsexamen, Promotion 1987 in Romanistik. Literaturkritiker und Übersetzer aus dem Französischen (u. a. Bove, Henri Thomas, Hervé Guibert, Jacques Chauviré).
Die Verbündeten
Roman
Aus dem Französischenvon Thomas Laux
Edition diá
Für H. de S.
Kapitel I
Als Madame Louise Aftalion in Begleitung ihres Sohnes Nicolas in Paris ankam, ließ sie sich unverzüglich zu ihrer Schwester Thérèse Cocquerel fahren, die sie seit mehr als fünfzehn Jahren aus den Augen verloren hatte. Gemeinsam mit ihrem Mann bewohnte diese in unmittelbarer Nähe der École militaire eine Sechszimmerwohnung in der fünften Etage eines alten Mietshauses, das der Eigentümer, sobald Wohnungen frei wurden, aus Freude am Renovieren ebenso wie aus Gewinnsucht mit modernem Komfort ausstatten ließ, um auf diese Weise die Mieten verdoppeln zu können. Die Wohnungen waren geradezu lächerlich bescheiden. So lag die Wohnung der Cocquerels, deren Fenster fast alle auf die Avenue Bosquet gingen, bei einer Jahresmiete von zweitausend Franc. Thérèse hatte eine Rumpelkammer in ein Badezimmer umbauen lassen. Da es kein Fenster hatte, beschlugen die Spiegel wegen des Dampfes innerhalb von wenigen Sekunden, während sich unter der Decke eine Dunstwolke bildete. Der Salon befand sich an einer Ecke des Hauses. Deshalb, aber auch wegen der länglichen Fenster, die bis auf den Fußboden reichten, war es im Winter bitterkalt. Allen Gegenständen in diesem Zimmer haftete etwas Provinzielles an. Auf einem Konsoltischchen lag ein Fotoalbum mit Kupferverschluss. Um es zu füllen, hatte Benjamin, Thérèses Mann, Postkarten hinzugefügt, Ansichten, die er mit der Schere bearbeitete, damit keine weiße Litze ihre Herkunft verriet. Überall lagen Muschelschalen, Glöckchen und Strandsouvenirs herum. Zwei Porträts von Madame Perrier, der Mutter Thérèse Cocquerels und Louise Aftalions, zierten die Wände. »Bilias Hand hat es verstanden, die Ähnlichkeit einzufangen.« Bilia, ein Freund der Eltern der beiden Schwestern, war der Schöpfer dieser Porträts. Er war ein Künstler, dem ein Platz in der Familie eingeräumt worden war, ein Künstler, über dessen Ruf sich die Perriers überall erkundigten, dessen Namen sie in den Kunstrubriken suchten, dessen Werke sie in den Ausstellungen bewunderten. Der Vater hatte nie Modell stehen wollen, unter dem Vorwand, er sei zu hässlich. »Dein Gesichtsausdruck ist zu eigen, als dass ich dich nach einer Fotografie hinkriegen könnte«, meinte Bilia. Und alle Jahre wieder malte er das Porträt von Madame Perrier. Damals bewohnte Bilia ein großes Atelier in Passy, wo ihn die Familie Perrier des Öfteren aufsuchte, nicht ohne dass zuvor tausend Ermahnungen, bloß nichts anzurühren, an die Kinder – Thérèse, Louise, Charles und Marc – ergangen wären. Die Besuche bei dem Maler waren ein Fest. Madame Perrier versäumte es nie, auf den Hängeboden zu steigen, wo sein Zimmer eingerichtet war, und von der Balustrade aus, auf die sie ihre Ellbogen stützte, das Atelier darunter bewunderungsvoll zu betrachten. Die Wände waren bedeckt von Gemälden und Masken aus Gips, die, wie sie glaubte, von Toten abgenommen worden waren, sowie Farbskizzen, wie Bilia seine Landschaften und Entwürfe nannte.
Vom Salon aus gelangte man durch zwei Türen, die bedingt durch eine mechanische Vorrichtung gleichzeitig aufgingen, in den vollständig getäfelten Speiseraum, dessen Zimmerdecke mit Kassetten verziert war, denen die Maler den Farbton und die Maserung von Eichenholz gegeben hatten. Nachdem man einem langen Flur gefolgt war, von dem die Küche sowie die kleine Kammer abzweigte, in der das Badezimmer eingerichtet war, kam man ins Schlafzimmer. Das durch zahlreiche Vorhänge, Stores und Gardinen fallende Licht war sanft und verlieh diesem Zimmer eine intime Atmosphäre. Man ahnte, dass Benjamin dort auf andere Gedanken kommen, seine Sorgen vergessen und sich an kindlichen Beschäftigungen erfreuen sollte.
Das Nachbarzimmer gehörte der Tochter der Cocquerels, Edmonde, die es im Übrigen nicht bewohnte, denn sie war auf einem Gymnasium in Saint-Germain. Das letzte Zimmer, normalerweise ein Abstellraum, war für die Aftalions hergerichtet worden. Für Nicolas hatte das Dienstmädchen ein Sofa vom Dachboden heruntergeschafft; es verschwand hinter einem Wandschirm. In einem Wandschrank war ein eiserner Waschtisch, wie man sie in Krankenhäusern findet, verstaut worden. Da der Wasserkrug wegen der gebogenen Tischfüße nicht in den Wandschrank hineinpasste, war er in einer Zimmerecke versteckt und mit einem Handtuch überdeckt worden.
Thérèse hatte kurz nach dem Tod ihres Vaters dessen Sekretär geheiratet. Ein Jahr später hatte sie ihre Tochter Edmonde bekommen und war in diese Wohnung gezogen, in der Benjamin geboren und seine Eltern gestorben waren. Verbittert von einem Leben, in dem die Höhepunkte fehlten, brachte sie ihrer jüngeren Schwester einen tiefen Hass entgegen. »Ich bin nicht schlecht«, sagte sie, »aber ich wünschte, ihr würde etwas zustoßen. Das brächte sie zum Nachdenken.« Nein, bösartig war sie nicht. Es kam oft vor, dass sie angesichts des Schicksals unglücklicher Menschen Mitleid empfand. Aufrichtig wünschte sie, ihnen helfen zu können. Doch immer gab es etwas, das sie, wie ihr schien, letztendlich daran hinderte.
Verbissen verteidigte sie ihren Mann. Sie war egoistisch, aber sie war es auch in seinem Sinne. Sie lebte ebenso sehr für ihn wie für sich selbst. So achtete sie, wenn sie sich zum Ausgehen bereitmachten, auf seine Kleidung gleichermaßen wie auf die ihre. Sie kochte ihm komplizierte Gerichte, nahm seinen Arm, sobald sie im Freien waren, ja manchmal sogar im Haus, wenn sie von einem Zimmer ins andere gingen. Sie wollte, dass die anderen Frauen sie um diesen Mann beneideten. Sie hatte eine Art, die anderen anzusehen und sich gleichzeitig an ihn zu drücken, womit sie zu sagen schien: »Dies ist ein rechtschaffener Ehemann. Der ist nichts für euch.« Wenn sie in ihrem Automobil saß und darauf wartete, dass Benjamin den Wagen vollgetankt hatte, verspürte sie tiefe Genugtuung darüber, ihn beschäftigt zu sehen, und dabei so gleichgültig gegenüber den vorbeigehenden Leuten.
Den Sonntag brachte sie zu einem guten Teil damit zu, sich anzukleiden. War sie damit fertig, verließ sie mit Benjamin zusammen das Haus, und beide gingen in eines der Cafés an den Boulevards, um sich Musik anzuhören. Ihr Gatte war der Inbegriff des Mannes. Er war größer und stärker als sie. Immer wieder stellte sie dies gern fest, und es gefiel ihr, ihm vorzuwerfen, dass er seine Zigarettenasche überall verstreute und keine Ordnung hielt, was sie dann zu der Bemerkung veranlasste: »Ein Mann ist doch die Unordnung in Person«, und weiter, dass er nicht imstande sei, sich sein Essen zu machen oder zu nähen, und dass er seine Kleidung schneller abnütze als sie. »Dein Verschleiß ist unglaublich. Ich werde dir Schuhe aus Eisen kaufen müssen.« Zweimal die Woche gingen sie ins Theater und aßen nach der Vorstellung zu Abend. Vor den Festtagen gingen sie in ein vornehmes Restaurant: er in einen Cut gezwängt, sie vor lauter echten und falschen Steinen glitzernd. Manchmal empfingen sie Freunde. Das artete dann zu nicht enden wollenden Mahlzeiten aus, während denen sie redete wie ein Wasserfall, sich ereiferte, sich so stark erregte, dass sie am Ende des Abends derart nervös war, dass sie nicht mehr wusste, was sie sagte.
Benjamin war ruhiger als sie. Dennoch kam es ihm nicht in den Sinn, seiner Frau ihre Entgleisungen übelzunehmen. Im Gegenteil, ihr Überschwang und ihre Erregtheit gefielen ihm. Ständig schien er sagen zu wollen: »Meine Frau ist nicht irgendeine Dahergelaufene.« Hinter seiner Neutralität spürte man, dass er sich nur in den äußersten Fällen einmischte. Er hatte etwas von diesen sanftmütigen und starken Männern an sich, die einen zu unangenehmen Verabredungen begleiten, wo sie dann so, als wären sie vom Himmel gefallen, dasitzen und nicht wissen, was sie mit ihren Händen anfangen sollen, während sie nur auf ein Zeichen warten, um einen endlich in Schutz nehmen zu können.
Am Tag vor der Ankunft der Aftalions hatte er lange mit seiner Frau über sie gesprochen. Er wollte, dass nicht der leiseste Vorwurf an ihm hängenblieb und sich alles nach den Gesetzen der Gastfreundschaft abspielte. Sein Gefühl ihnen gegenüber war recht komplex. »Bevor ich sie nicht gesehen habe, kann ich mir keine Meinung bilden«, sagte er seit mehreren Tagen immer wieder. Tatsächlich war es für ihn Ehrensache, sie nicht im Voraus zu verurteilen. Neugierde verleitete ihn freilich dazu, Thérèse allerlei Fragen zu stellen: »Nun erzähl mir schon, wie sie sind!« – »Das ist zu kompliziert. Du wirst sie schon noch sehen«, gab Madame Cocquerel zur Antwort. Vor allem wollte sie kein Detail außer Acht lassen, damit alle Schuld später bei den Aftalions lag. Das Ersuchen ihrer Schwester bewirkte, dass sie dunkel dachte: »Ich bin gerächt«, freilich ohne diese Worte auszusprechen, die zu hart gewesen wären. Nur ein blasser Schatten dieses Satzes geisterte in ihrem Hinterkopf. »Immerhin gibt es noch Gerechtigkeit«, sagte sie in einem fort. Sie hatte ihre Anwandlung bereits unter Kontrolle. Sie würde sich der Person gegenüber, die sie so sehr beneidet hatte, großherzig und gütig zeigen, doch sobald sich eine Gelegenheit böte, würde sie eine kleine böse Bemerkung anbringen.
* * *
Kaum hatten die Aftalions geläutet, rief Thérèse auch schon nach ihrem Mann und sagte ihm, er solle in den Salon kommen. Sie setzte sich unverzüglich hin, griff nach einem Buch und tat, als würde sie lesen. Benjamin ging, die Hände in den Hosentaschen, an ein Fenster und gab sich Mühe, das Hin und Her auf der Straße mit Interesse zu verfolgen. Wenige Sekunden später führte das Dienstmädchen die Aftalions herein, die in ihrer Verlegenheit auf ein aufmunterndes Wort warteten. Jäh erhob sich Thérèse, lief auf ihre Schwester zu und umarmte sie lange, während ihr Mann kräftig Nicolas’ Hand drückte.
»Setzt euch, ihr beiden. Wir haben uns seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wie du dich verändert hast, Louise, und wie groß dein Sohn ist! Edmonde würde ihm nicht einmal bis an die Schultern reichen.«
Dieser Größenunterschied demütigte Thérèse eine Sekunde lang, und sie erinnerte sich plötzlich daran, dass sie ein Jahr älter als ihre Schwester war.
»Aber sie ist ein Mädchen!«, stellte Benjamin fest.
»Wie groß mein Neffe ist! Fast schon ein Mann!«
Nicolas senkte den Blick. Monsieur Cocquerel betrachtete ihn von oben bis unten.
»Ein ganzer Kerl … aus einem Stück …«
»Und er ist sehr gut zu seiner Mutter«, bemerkte Louise. »Nicht wahr, Nicolas?«
Alle nahmen Platz, außer Benjamin, der die Hände hinter dem Rücken verschränkte und sich Mühe gab, die Haltung eines Mannes einzunehmen, der seine Arbeit eine Weile ruhen lässt, um seiner Frau eine Freude zu machen. Schweigen machte sich breit. Benjamin wandte sich um und strich mit der Fingerspitze über den Zierhenkel einer Vase, um das Relief abzutasten. Thérèse spielte mit ihrer Halskette, die so lang war, dass sie wie eine Schleuder kreiste, wenn sie sie in der Mitte fasste.
»Und, hattest du eine angenehme Reise?«, fragte sie ihre Schwester.
»Zum Glück hatten wir Eckplätze.«
»Umso besser. Habt ihr schlafen können?«
»Nicolas hat geschlafen. Ich kann im Zug nicht gut schlafen.«
»Du bist noch immer dieselbe, immer noch so empfindlich. Ich werde dir Tee machen. Wenn man müde ist, muss man was Warmes trinken.«
Benjamin war auf Nicolas zugegangen. Er wanderte eine Weile um ihn herum, bevor er ihn endlich ansprach:
»Sie sind das erste Mal in Paris?«
»Ich bin hier geboren, Monsieur. Ich war hier sogar auf der Schule.«
»Stimmt … ich vergaß. Sie sind Pariser. Und freuen Sie sich, wieder hier zu sein?«
»Ja, sehr. Ich erinnere mich undeutlich an einige Straßen. Die würde ich gerne wiedersehen.«
»Das kann ich verstehen. Es ist immer schön, einen Ort wiederzusehen, wenn man jahrelang fort war. Als ich bei der Armee war, dachte ich häufig an diese Straße, an dieses Viertel zurück. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich immer sehr gerührt war, wenn ich auf Urlaub kam. Aber damals konnte man nicht sicher sein, überhaupt noch mal wiederzukommen.«
In diesem Augenblick vernahm Nicolas seine Mutter, die zu Thérèse sagte: »Er sucht eine Stellung.« Er wandte sich um. Benjamin tat dasselbe und fragte:
»Geht es um eine Anstellung?«
»Der junge Mann hier«, sagte Thérèse und zeigte auf ihren Neffen, »sucht eine Arbeit.« Sie heftete ihren Blick so nachdrücklich auf ihren Gatten, dass Nicolas spürte, dass sie nur einen Satz wiederholte, den sie wahrscheinlich schon unzählige Male unter vier Augen zu Benjamin gesagt hatte, als sie unter sich waren.
»Ach ja, Sie suchen eine Stelle?«
»Ich müsste halt arbeiten.«
»Natürlich … das wäre schon gut … Aber wissen Sie auch, was sie gern tun würden?«
»Eine Stelle als Sekretär«, sagte Madame Aftalion.
»Sekretär von was?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte Nicolas.
»Zum Beispiel bei einem Politiker«, fuhr seine Mutter fort.
»Na, Sie gehen ja ganz schön ran! Glauben Sie, so etwas findet sich so leicht? Im Übrigen, unter uns, er würde da nichts verdienen.«
»Was weißt du schon davon!«, sagte Thérèse, um ihren Mann zum Weiterreden zu veranlassen.
»Ich sage das, weil ich es weiß. Erinnere dich an den kleinen Gérard. Wie schlecht es ihm ergangen ist …«
»Stimmt. Da hast du recht.«
Dann, zu ihrer Schwester gewandt:
»Mein Mann hat zu einem Haufen Leute Beziehungen. Wenn er nein sagt, dann heißt es auch nein. Du solltest dir so was nicht in den Kopf setzen, Louise.«
»Wirklich? Sie hatten die Absicht, Sekretär bei einem Politiker zu werden?«, sagte Benjamin, der wieder näher an Nicolas herangegangen war.
»Nicht unbedingt.«
»Aber eine bestimmte Vorstellung haben Sie doch? Denn die muss man haben. Man muss wissen, was man will. Zugegeben, es gibt Fälle, da haben Leute Erfolg, und man weiß gar nicht, woher das kommt. Aber das sind Ausnahmen. Zählen Sie nicht auf einen Ratschlag. Das Glück packt man am Schopf, wenn es da ist, aber wenn es nicht kommt, dann geht es auch ohne. Und damit hat man es auch nicht schlechter. Es ist mir peinlich, mich selbst als Beispiel zu nehmen, aber ich, sehen Sie, ich habe nie Glück gehabt.«
»Das solltest du nicht sagen, Benjamin«, unterbrach ihn Thérèse. »Du kannst dich doch nicht beklagen.«
»Lass mich ausreden. Ich sage, ich habe nie Glück gehabt, und das ist die Wahrheit. Weißt du, was das Glück ist? Schau dir die Vidals an. Die haben Glück gehabt.«
»Und ich sage dir, du hast auch Glück«, fuhr Thérèse fort, die großen Wert darauf legte, dass der Unterschied zwischen ihrer Lage und der von Madame Aftalion deutlich wurde.
Monsieur Cocquerel erriet mit einem Mal, worauf seine Frau hinauswollte.
»Natürlich«, nahm er den Faden unverzüglich auf. »Verglichen mit anderen habe ich Glück. Ich sprach von außergewöhnlichen Erfolgen!«
»Aber darum geht es doch nicht.«
Nachdem man eine Stunde lang in dieser Art herumgeredet hatte, ohne dass das Gespräch ein einziges Mal eine freundlichere Note angenommen hätte, führten die Cocquerels Madame Aftalion und ihren Sohn in das vorbereitete Zimmer.
»Du nimmst das große Bett«, sagte Thérèse zu ihrer Schwester. »Dein Sohn kann sich auf das Sofa legen. Meine Tochter hat lange Zeit darauf geschlafen.«
»Ihr entschuldigt mich«, sagte Benjamin. »Ich habe noch zu tun.«
Kaum war er fort, stellte Madame Cocquerel fest:
»Wie er schuftet, mein Benjamin! Hast du bemerkt, er fühlte sich gar nicht recht wohl. Heute Abend wird er besser aufgelegt sein. Wenn er morgens nicht zum Arbeiten kommt, ist er wie verloren. Und er arbeitet wirklich, weißt du? Er geht nicht nur hin, um sich sehen zu lassen. Er muss Anleitungen geben, Befehle erteilen. An ihm hängt die ganze Verantwortung. Früher rief man ihn sogar zu Hause an. Ich wollte das nicht mehr. Ich habe zu ihm gesagt: ›Arbeiten musst du natürlich, aber wenn du zu Hause bist, ruh dich aus.‹ Dein Sohn sollte sich ein Beispiel an ihm nehmen.«
»Hast du gehört, Nicolas?«, sagte Madame Aftalion, um ihrer Schwester zu gefallen.
»Natürlich.«
»Aber ja, nehmen Sie sich ein Beispiel an ihm«, sagte Thérèse kurz angebunden, denn die Antwort ihres Neffen hatte sie ein wenig gekränkt. »Er ist älter als Sie. Man kann sich an ihm ein Beispiel nehmen. Es gibt Leute, die tun das!«
»Ich behaupte ja nicht das Gegenteil.«
Diesen Satz hatte Nicolas vielleicht schon tausendmal in seinem Leben gesagt. Er kam ihm ebenso häufig über die Lippen wie »Danke schön« oder »Verzeihung«, er kam geradezu automatisch aus seinem Mund. Sprach man mit ihm, gab er alle Augenblicke diese Antwort.
»Es fehlte gerade noch, dass Sie das Gegenteil behaupten!«
Dann, sich ihrer Schwester zuwendend, fuhr Thérèse mit leiser Stimme fort:
»Wie hast du ihn bloß erzogen? Gestattest du ihm solche Antworten? Du wirst sehen, glaub mir: Ihr werdet noch Schwierigkeiten kriegen.«
* * *
Mit jedem Tag wurde das Leben bei den Cocquerels schwieriger. Bereits am Abend des Tages, als die Aftalions angekommen waren, hatte Thérèse nach dem Essen die Bemerkung fallenlassen: »Gehen wir schlafen. Das wird euch bestimmt guttun. Hier gehen die Leute früh zu Bett. Ihr seht, das Leben in Paris ist keineswegs so, wie ihr es euch vorgestellt habt.« Ab und zu nahm Madame Cocquerel ihre Schwester beiseite und flüsterte ihr ins Ohr: »Sag deinem Sohn, er soll sich besser benehmen. Zu Mittag hat er sich schon wieder vor uns an den Tisch gesetzt. Darf er sich denn alles erlauben, als wäre er hier zu Hause? Benjamin wird bestimmt böse werden. Ich kann ihm nicht alles verheimlichen, er bekommt es doch mit. Wenn man bei anderen Leuten ist, muss man etwas feinfühliger sein.« Auf die gleiche Weise verhielt sich Benjamin gegenüber Nicolas. »Ihre Mutter bildet sich wohl ein, sie wäre in einem Hotel. Sie sollten ihr klarmachen, dass nicht nur sie bedient werden will. Das Dienstmädchen kann nicht alles machen.« Derlei Bemerkungen häuften sich. Gingen die Cocquerels aus, schlossen sie stets die Schränke ab und riefen durch die Tür zum Zimmer der Aftalions (womit sie zu verstehen gaben, dass sie keinerlei Wert darauf legten, ihrer ansichtig zu werden): »Richtet euch darauf ein, dass ihr auswärts esst. Wir werden nicht da sein. Das Dienstmädchen hat heute Waschtag.« Wenn Nicolas zufällig einmal zu spät zum Essen kam, sagte Thérèse zu ihm: »Wir hatten angenommen, Sie würden nicht kommen!«
Eines Abends, als sie mit ihrem Sohn allein war, brach es aus Madame Aftalion hervor:
»Nein, ich will nicht mehr bleiben. Das ist ja die Hölle hier.«
Nicolas, der sich am Vorabend mit seiner Tante gestritten hatte, stimmte zu.
»Das kann so nicht weitergehen. Sie können uns nicht leiden. Wir werden ihnen zeigen, dass wir nicht auf sie angewiesen sind. Hör zu, Nicolas, morgen müssen wir Charles aufsuchen. Er hat mehr Charakter. Wir werden ihm unsere Lage schildern. Vielleicht kann er etwas für uns tun. Wenn wir hierbleiben, sind wir in einem Monat kein Stückchen weiter. Und du musst unbedingt eine Stelle finden. Sonst weiß ich nicht, was passiert.«
»Wenn’s dir Spaß macht.«
Das war ein Lieblingsspruch von Nicolas, so wie: »Ich behaupte nicht das Gegenteil.«
»Aber das sagst du mir schon seit einer Woche, und jedes Mal verschiebst du es auf den nächsten Tag.«
»Morgen gehen wir. Ich schwöre es dir, Mama.«
»Nicht doch, schwöre nicht, Nicolas. Du schwörst das Blaue vom Himmel. Nie weiß man, ob man sich auf dich verlassen kann.«
Kapitel II
Bei einem polnischen Bildhauer, Loukomski mit Namen, war Louise vorzeiten Alexandre Aftalion, Nicolas’ Vater, begegnet. Seitdem Bilia – mit richtigem Namen Billet – versichert hatte, der Bildhauer sei ein Genie, hatte sie diesen Loukomski bereits zweimal aufgesucht. Damals empfing er die unterschiedlichsten Leute in seinem Atelier in der Rue d’Alésia. Es war ein großer Raum, dessen Glasdach von völlig verstaubten Gemälden verdeckt war. Basreliefs mit allegorischen Szenen verstopften das Atelier, Büsten mit fratzenartigen Gesichtern, Statuen mit fliegendem Haar und mit Gipsgewändern, die wie Schals wehten, denn seine Spezialität war es, seine Werke mit einem heftigen Wind zu umgeben. Vom Hängeboden, der aussah wie eine mit schwarzem Samt drapierte Bühne, hörte man ein Harmonium, das Kirchenlieder spielte. Loukomski gefiel es, seine Geschichte zu erzählen. Wie Caruso, wie Inaudi war er einst Schäfer gewesen. Eines Tages waren einem englischen Bankier auf der Durchreise die holzgeschnitzten Nippsachen aufgefallen, und er hatte sie seinen Eltern gekauft. Seitdem überwies er ihm ein monatliches Gehalt unter der Bedingung, dass er nach Belieben aus dem bildhauerischen Werk auswählen dürfe. Loukomski beteuerte, er könne ausschließlich in einer Art Ekstase arbeiten. Er musste sich glitzernde Stickereien umhängen. Es kam vor, dass er, auf solche Weise herausgeputzt, seine Einkäufe machte und von den Kindern der Nachbarschaft verfolgt wurde, denen er alle zehn Meter ein paar Sou zuwarf. Ging ihm irgendein Gedanke durch den Kopf, setzte er ihn unverzüglich in die Tat um. Eines Tages bemalte er seinen Körper mit Goldfarbe und machte sich so an die Arbeit. An einem anderen Tag empfing er einige Bekannte und empfahl ihnen zu schweigen, um sie dann unvermittelt anzuschreien: »Macht schon … brüllt los … brüllt los … Das hier ist eine Arena. Seht euch Cäsar an …« Und er wies auf das Harmonium. Nicht nur, wenn Freunde um ihn geschart waren, verhielt er sich so. Auch wenn er allein war, kam es zu diesen Ausfällen. Nachts legte er sich tiefe Meditation auf, und das stundenlang, obgleich er sich dabei tödlich langweilte. Wenn ihn dann irgendein Bekannter in dieser Haltung überraschte, war er vor Freude ganz außer sich. Er richtete sich auf und sagte: »Adieu Inspiration. Guten Tag, Freund.« Und er begann, zu tanzen und herumzuspringen, so glücklich war er, bei seiner Meditation überrascht worden zu sein und sich nun erholen zu können.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!