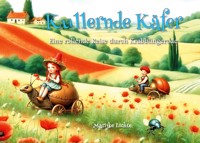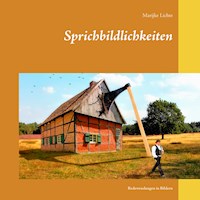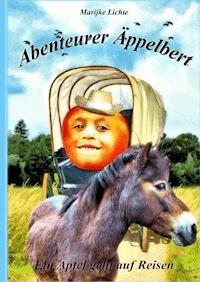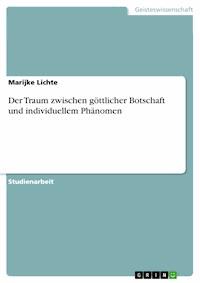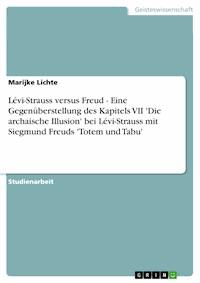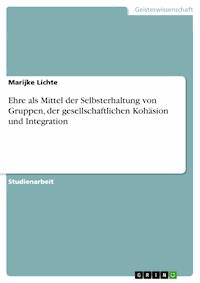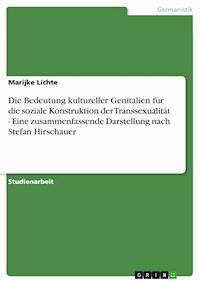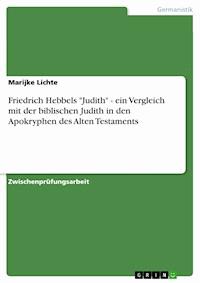18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Germanistik - Sonstiges, Note: keine, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Seminar für deutsche Literatur und Sprache), Veranstaltung: Verführungs-Künste, Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser Untersuchung liegt im Wesentlichen die antike Tragödie Die Eumeniden des griechischen Dichters Aischylos zugrunde. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Verwandlung der mythologischen Rachegöttinnen, der Erinyen, in die freundlichen und wohlwollenden Eumeniden. Diese Verwandlung ist auch in soziologischer Hinsicht interessant, denn Aischylos’ Werk deutet die gesellschaftspolitische und kulturelle Entwicklung des Landes an, den Wandel vom Kultischen bis zu ersten demokratischen Ansätzen und insbesondere die Stellung der Hauptstadt Athens in eben dieser Entwicklung. Daher wird hier am Beispiel der Erinyen ein Gesamtzusammenhang hergestellt, angefangen bei ihrem mythologischen Ursprung, bis hin zu ihrem Eingang in das Heilsgefüge der athenischen Polis. Im ersten Abschnitt wird die entstehungsgeschichtliche Rolle der Erinyen im Rahmen der mythologischen „Genesis“ und besonders unter dem Gesichtspunkt der von Zeus konzipierten „neuen Weltordnung“ anhand Hesiods Theogonie dargestellt. Diese Weltordnung soll die Überleitung zum „Hier und Jetzt“ der Rachegöttinnen, zum Zeitpunkt der Niederschrift der Tragödie herstellen. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den objektiven Merkmalen, dem äußeren Erscheinungsbild und den Assoziationen, die mit den Erinyen verknüpft sind. Dies geschieht zum besseren Verständnisses ihres gesellschaftlichen Images, welches die Grundlage der im vierten Abschnitt behandelten Notwendigkeit ihrer Verwandlung darstellt. Dort ist ein wichtiger Untersuchungspunkt, wer im Zuge der Gerichtsverhandlung um Orestes die Gewinner und wer die Verlierer sind und ob im Verlauf dieser Verhandlung tatsächlich eine Verwandlung, eine Überzeugung oder vielmehr eine Verführung der Erinyen stattfindet. Anders als Aischylos haben sich dessen Nachfolger Sophokles und Euripides der Blutschuld des Orestes literarisch angenommen. Welche Rolle bei ihnen die Erinyen spielen, steht im Mittelpunkt des vierten Abschnitts, welcher wiederum dazu gedacht, die Beweggründe Aischylos’ herzuleiten und seine Tragödie in einem Lobgesang auf seine Vaterstadt Athen gipfeln zu lassen, denen sich der letzte Punkt der Betrachtung widmen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 4
Einleitung
Dieser Untersuchung liegt im Wesentlichen die antike TragödieDie Eumenidendes griechischen Dichters Aischylos zugrunde. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Verwandlung der mythologischen Rachegöttinnen, der Erinyen, in die freundlichen und wohlwollenden Eumeniden. Darüber hinaus ist aber eben diese Verwandlung auch in soziologischer Hinsicht interessant, denn Aischylos’ Werk ist mehr als nur ein Theaterstück, welches dem Publikum des antiken Griechenlands zur Unterhaltung gereichte. Es deutet ferner die gesellschaftspolitische und kulturelle Entwicklung des Landes an, den Wandel vom Kultischen bis hin zu ersten demokratischen Ansätzen und insbesondere die Stellung der Hauptstadt Athens in eben dieser Entwicklung. Daher soll hier versucht werden, am Beispiel der Erinyen ein Gesamtzusammenhang hergestellt zu werden, angefangen bei ihrem mythologischen Ursprung, bis hin zu ihrem Eingang in das Heilsgefüge der athenischen Polis. Im ersten Abschnitt soll die entstehungsgeschichtliche Rolle der Erinyen im Rahmen der mythologischen „Genesis“ und besonders unter dem Gesichtspunkt der von Zeus konzipierten „neuen Weltordnung“ anhand HesiodsTheogoniedargestellt werden. Diese Weltordnung soll die Überleitung zum „Hier und Jetzt“ der Rachegöttinnen, zum Zeitpunkt der Niederschrift der Tragödie herstellen, besonders im Bezug auf deren Funktion, welche eng an die damals herrschende und als zu überwinden geltende rechtsstaatliche Praktik gekoppelt ist. Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den objektiven Merkmalen, dem äußeren Erscheinungsbild und den Assoziationen die - sowohl bei Aischylos und seinen Nachfolgern, als auch bei Homer - mit den Erinyen verknüpft sind. Dies soll zum Zwecke eines besseren Verständnisses ihres gesellschaftlichen Images geschehen, welches die Grundlage der im vierten Abschnitt zu behandelnden Notwendigkeit ihrer Verwandlung darstellt. Hier wird darüber hinaus ein wichtiger Untersuchungspunkt sein, wer im Zuge der Gerichtsverhandlung um Orestes die Gewinner und wer die Verlierer sind und ob im Verlauf dieser Verhandlung tatsächlich eine Verwandlung, eine Überzeugung oder vielmehr eine Verführung der Erinyen stattfindet. Anders als Aischylos haben sich dessen Nachfolger Sophokles und Euripides der Blutschuld des Orestes literarisch angenommen. Welche Rolle bei ihnen die Erinyen vor dem kulturhistorischen und gesellschaftspolitischen Hintergrund ihrer Zeit spielen, soll im Mittelpunkt des vierten Abschnitts stehen. Dieser Abschnitt ist wiederum dazu gedacht, die Beweggründe Aischylos’ herzuleiten, seine Tragödie in einem Lobgesang auf seine Vaterstadt Athen gipfeln zu lassen, denen sich der letzte Punkt der Betrachtung widmen wird.
Page 5
Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Zitate aus der von mir verwendeten Literatur, in ihrer ursprünglichen Schreibweise belassen und - aus Gründen der Authentizität - nicht der neuen deutschen Rechtschreibung und Grammatik angeglichen habe. Daher schreibe ich „Erinyen“ auch nur mit einem „n“. Dasselbe gilt für „Oidipus“, „Ouranos“ usw. Außerdem benutze ich für Orestes Mutter zwei Schreibweisen: Bei Aischylos heißt sie „Klytaimestra“, bei Sophokles hingegen „Klytaimnestra“. Den Unterschied versuche ich dadurch deutlich zu machen, dass ich - immer wenn ich mich auf Sophokles beziehe - das „n“ in ihrem Namen in Klammern setze.
Page 6