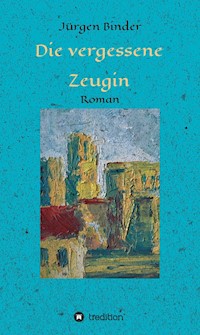
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reinhard Graubner, Professor am Trinity College in Dublin, ist auf dem besten Weg, dem Alkohol zu verfallen und seine wissenschaftliche Reputation zu verspielen. Als ihn ein Brief aus Peru erreicht, lässt er sich auf eine Reise nach Lima ein. Dort beginnt für ihn ein Abenteuer, das er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Und ein uraltes Schriftstück scheint seine allgemein belächelten Theorien zu bestätigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jürgen Binder
Die vrgessene Zeugin
© 2019 Jürgen Binder
Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-3152-3
Hardcover:
978-3-7482-3153-0
e-Book:
978-3-7482-3154-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Umschlagabbildung: Jürgen Binder,
Thmuis (Ausschnitt), Öl auf Leinwand 2018
Für meinen Vater
Die Wahrheit liegt in der unersetzbaren, flüchtigen Farbe unserer Tage.
In den vorüberhuschenden Augenblicken.
Wie ein Lied, dessen Worte man nicht behalten kann.
Ein Lächeln, das man nicht mehr wiederfindet.
Unterägypten, 39 n.Chr.
Der Wüstenwind zerrte an den Gewändern der einsamen Gestalt, die sich mit schweren Schritten über den sandigen Boden schleppte. Die erbarmungslose Sonne hatte längst das Gesicht des Mannes verbrannt und ihm die Kräfte aus den Gliedern gesogen.
Seit Wochen war er nun schon unterwegs, seit er die Stadt Gottes verlassen hatte, um sich auf die Suche nach einer Wahrheit zu begeben, die ihm abhanden gekommen war.
Auf der alten Handelsroute der Nabatäer war er entlang der Küste gewandert und hatte sich manchmal Karawanen angeschlossen, mit denen das Volk aus Arabien Spezereien und Teer ins Land am Nil brachte.
Weite Strecken durch die karge Landschaft aber hatte er alleine zurückgelegt und das eine oder andere Mal war er nur knapp den Räuberbanden entkommen, die auf der Lauer lagen, um reiche Reisende zu überfallen. Doch bei ihm wäre sowieso nichts zu erbeuten gewesen, denn außer seinem Wasserschlauch und dem Brief hatte er nichts bei sich.
Was sonst hätte er auch mitnehmen sollen?
Als er sich von seinen Glaubensbrüdern verabschiedet hatte, war er voller Vertrauen gewesen, darauf, daß Gott ihn geleiten und an sein Ziel gelangen lassen würde. Und auch wenn auf dem langen Weg, wenn er die letzte Kraft zu verlieren schien, dieses Vertrauen manchmal brüchig geworden war, so hatten ihm doch die Gebete, die er immer wieder in seinen Nachtlagern gesprochen hatte, erneut den Mut verliehen, weiterzuwandern.
Fast sechs Jahre war es nun her, daß er eine Antwort auf das Schreiben bekommen hatte, in dem er sich damals, nach all den Streitereien in der Heimat und den aufkommenden Zweifeln, hilfesuchend dorthin gewandt hatte, wohin er jetzt unterwegs war. Ja, es hatte lange gedauert, bis er sich entschieden hatte, aufzubrechen und damit einige seiner Brüder vor den Kopf zu stoßen, die es verurteilt hatten, daß er sich an jemanden wenden wollte, der nicht mehr zu ihnen gehörte.
Doch schließlich war er sicher gewesen, das Richtige zu tun und jetzt, wo er so weit gereist war und seinem Ziel so nah, würde er nicht mehr schwach werden.
Sand wehte ihm in die Augen und erschwerte ihm das Sehen. Er setzte sich auf einen Felsen und wischte mit dem Stoff seines Gewandes den Schmutz aus dem Gesicht. Dann löste er die Riemen seiner verschlissenen Sandalen und massierte die schmerzenden Füße.
Wie er so da saß, trug der Wind Geräusche an sein Ohr und er schaute auf. Von Westen her näherte sich ihm eine Gruppe Handelsreisender, die er in der Ferne erkennen konnte. Vielleicht war er in der Nähe eines Karawanenrastplatzes, hoffte er, eines jener kleinen Orte, an denen er immer hatte Nahrung erbeten können. Bei diesen Gedanken begann sein Magen zu schmerzen und ihm wurde wieder bewusst, daß er seit Tagen kaum etwas zu sich genommen hatte.
Er blieb sitzen, bis die Karawane ihn erreicht hatte, dann fragte er einen der vermummten Männer, wie weit es wohl noch bis zu der Ansiedlung sei, zu der er unterwegs war. Und zu seiner Freude bekam er die Auskunft, daß er nur noch eine knappe Tagesreise vor sich hatte. Der fremde Händler schaute ihn mitleidsvoll an und schien erschrocken über die ausgezehrte Gestalt, die da vor ihm stand. Schließlich holte er einige getrocknete Früchte aus der Tasche an seinem Gürtel und reichte sie dem einsamen Reisenden zur Wegzehrung. Er lächelte kurz und beeilte sich dann, wieder Anschluss zu finden an die weiterziehende Karawane.
Nachdem er sich noch eine Weile auf dem Felsen ausgeruht hatte, machte sich auch der Mann aus der Heiligen Stadt wieder auf den Weg. Wenige Meilen weiter tauchten vor ihm die flimmernden Schemen einer kleinen Oase auf, in welcher er seinen Wasserschlauch auffüllen und die Nacht würde verbringen können.
Früh am nächsten Morgen brach er wieder auf und nutzte die noch kühle Luft, um einen guten Teil seines restlichen Weges zügig zurückzulegen.
Dann, am späten Nachmittag, als die Sonne wieder heiß vom Himmel brannte, sah er sie vor sich, die Stadt, in der er Antworten auf seine Fragen zu finden hoffte.
Auf dem Markt zwischen den Lehmhäusern fragte er mehrere der Bewohner nach dem Aufenthaltsort seiner einstigen Mitgläubigen aus der Heimat, bis er auf jemanden traf, der ihm die gewünschte Auskunft geben konnte.
Der Beschreibung folgend verließ er den Ort an seinem anderen Ende wieder und fand schließlich recht weit außerhalb das einzelne, größere Gebäude, das ihm genannt worden war.
Im Licht der tief stehenden Abendsonne klopfte er erschöpft an das hölzerne Tor und nach einer Weile wurde die Pforte von einer, ganz in Schwarz gekleideten Frau geöffnet, die ihn überrascht ansah und offenbar überlegte, wer ihr da gegenüberstand. Dann spiegelte sich Erkennen in ihrem Gesicht und sie lächelte.
"Du bist es", sagte sie. "Ich hatte gar nicht mehr mit Deinem Kommen gerechnet."
1
Graubner würgte einen Klumpen Schleim ins Waschbecken. Schweiß hatte seine Haare an die Kopfhaut geklebt und lief ihm jetzt in dünnen Bächen ins Gesicht. Diese endlose feuchte Hitze brachte ihn um. Vielleicht auch die Zigaretten und der Alkohol. Aber vielleicht spielte dies letztlich auch gar keine Rolle.
Er richtete sich auf und starrte in den blinden Spiegel. 'Du bist am Ende', dachte er, 'wirklich am Ende.'
Doch das hier würde er noch durchziehen und wenn es das Letzte war, was er tat.
Sein Blick fiel auf die schimmligen Tapetenfetzen, die sich von den Wänden des Zimmers lösten und einen unappetitlich dreckigen Putz freilegten, der leise zu Boden rieselte und kleine Häufchen bildete.
Seit drei Tagen saß Graubner in dieser elenden Absteige und fragte sich, ob er dabei war, den Verstand zu verlieren.
Ein krakelig handgeschriebener Brief hatte ihn veranlasst, nach Peru zu fliegen und als ob dies nicht schon abwegig genung gewesen wäre, hatte er sich auch noch auf die Bedingung eingelassen, hier in diesem sogenannte Hotel im wahrscheinlich vergammeltsten Viertel der Hauptstadt abzusteigen.
Graubner beobachtete, wie der Schleimklumpen Richtung Abfluss rutschte und dabei eine helle Spur in der ursprünglichen Farbe des Waschbeckens hinterließ. "Scheiße", murmelte er heiser und wandte sich ab.
Er fischte die Zigarettenpackung aus der schweißnassen Hemdtasche, nahm die Bierflasche vom Tisch und setzte sich auf das schmierige Bett. Der Deckenventilator verteilte den Zigarettenrauch in der stickigen Luft. Graubner unterdrückte einen Brechreiz und trank den Rest des warmen Biers.
Normalerweise herrschte in Lima ein gemäßigtes Klima, doch er hatte offenbar die heißesten und schwülsten Tage seit langem erwischt. Er starrte aus dem Fenster auf das Gewirr von Leitungen aller Art, welches die schmale Gasse überspannte und fragte sich, wohin diese Unternehmung hier führen würde.
Die Angaben in dem Brief waren vage, aber konkret genug, um sein ernsthaftes Interesse zu wecken. Und der Schreiber schien zu wissen, wovon er sprach.
Graubner hatte keine Ahnung, warum der anonyme Absender sich an ihn gewandt hatte. Seit vielen Jahren vertrat er eine Theorie, mit der er ziemlich alleine auf weitem Feld stand und die ihn schon längst seine wissenschaftliche Reputation gekostet hatte. Doch an der Richtigkeit seiner Annahmen hatte Graubner nur selten gezweifelt und nun tat sich hier womöglich die Gelegenheit auf, einen Beweis zu finden. Einen handfesten, unzweideutigen Beweis. Diese Chance konnte er sich nicht entgehen lassen, so gering sie auch sein mochte.
Er war jetzt Anfang 60, schon lange geschieden und kinderlos. Und ganz sicher nicht gesund. Was sollte es also.
Graubner steckte sich eine weitere dieser widerlichen peruanischen Kippen an und ein furchterregender Hustenanfall nahm ihm vorübergehend den Atem. "Verdammt", keuchte er und hielt sich am Bettgestell fest, bis ihm nicht mehr schwindlig war. Vielleicht würde ihm noch mehr lauwarmes Bier Linderung verschaffen. Einen Kühlschrank gab es in diesem Loch nicht. Er riss die Flasche auf und nahm einen langen Zug. In der Ecke lief ununterbrochen ein winziger Fernseher, der Graubners Meinung nach seit Tagen die immer gleiche Sendung ausstrahlte, unscharf und in grellbunten Farben.
Nein, dachte er, er hatte wirklich nichts zu verlieren.
In dem Brief hatte gestanden, er würde einen Anruf erhalten. Und heute war dieser Anruf gekommen. Vor etwa einer Stunde. Graubner war jetzt noch schlechter als zuvor schon.
Der Dodge mußte mindestens 40 Jahre alt sein und bestand auf den ersten Blick überwiegend aus Rost. Graubner hing in dem völlig durchgesessenen Beifahrersitz aus undefinierbarem, zerschlissenem Material, vor sich in Augenhöhe das Handschuhfach und die Ablage aus verschrammtem Edelholz. Oben an der Winschutzscheibe baumelte eine Girlande aus Maskottchen und Lokalheiligen. Ganz sicher dringend nötige Talismane in Limas mörderischem Straßenverkehr.
Er hatte keine Ahnung, wohin genau sie fuhren. Er hatte dem dürren Taxifahrer mit der Baseballkappe einfach wiederholt, was ihm die Stimme am Telefon gesagt hatte. Irgendeine, ihm nicht bekannte Adresse in einem Stadtviertel namens San Isidro.
Sie fuhren scheinbar planlos durch ein Gewirr düsterer Gassen. Durch Häuserlücken konnte Graubner hier und da Slums erkennen, die über die Hänge kleinerer oder größerer Hügel wucherten. Die Wellblechdächer flirrten in der Nachmittagshitze.
Sein Fahrer sprach kein Wort, bleckte nur gelegentlich die Zähne und nickte ihm aus irgendeinem Grund aufmunternd zu.
Heiße Abgase wehten durch die offenen Seitenfenster und brachten Graubner in Kombination mit seinem eigenen Zigarettenqualm an den Rand einer Ohnmacht.
'Lima', dachte er, 'ein 10-Millionen-Molloch, der sich von der Pazifikküste bis zu den Ausläufern der Anden erstreckte und praktisch immer unter einer Smogglocke lag, gebildet aus Emissionen der Industrieanlagen und des Straßenverkehrs. Und gegründet von den Mördern des Inka-Volkes.'
Graubner war noch nie hier gewesen und er glaubte, daß er da verdammt nochmal nicht viel verpasst hatte. Seine Augen brannten und er spürte Übelkeit in sich aufsteigen. Auf die nächste Fahrt dieser Art würde er Bier mitnehmen müssen.
Als er vor drei Tagen am Flughafen "Jorge Chávez" in Callao angekommen war, war er so betrunken gewesen, daß er davon und vom Weg in seine Absteige kaum etwas mitbekommen hatte. Das hätte er sich jetzt auch gewünscht, doch die einzige Flüssigkeit, die ihm hier in den Mund lief, war sein eigener Schweiß.
"Rio Rimac", sagte die Gestalt neben ihm völlig unerwartet und Graubner fuhr zusammen. Die Worte rissen ihn aus seinen Gedanken und er bemerkte, daß der alte Dodge sich im Schritttempo inmitten eines Staus über eine Brücke schob. Und sein ansonsten stummer Fahrer hatte wohl in einem Anfall von Fremdenführertum auf den Fluss hinweisen wollen, der Lima träge fließend in zwei Hälften teilte.
Vielleicht selbst erschrocken von seinem Wortschwall drehte der Fahrer nun das Radio auf und für den Rest der Reise plärrte blecherner peruanischer Singsang aus den Lautsprechern.
Sie waren mittlerweile seit über einer Stunde unterwegs und tauchten nun offenbar in so etwas wie die Innenstadt ein. Links hinter der Brücke sah Graubner an einem prächtigen, großen Gebäude den Schriftzug "Estación de Desamparados". Ein großer Bahnhof, wie es schien.
Auf schier endlosen, breiten Straßen passierten sie bröckelnde Kolonialbauten und moderne Wolkenkratzer und nach einer weiteren dreiviertel Stunde im nie nachlassenden Verkehrschaos, war Graubner endgültig überzeugt, daß er diese Fahrt nicht überleben würde.
Doch just in diesem Moment lenkte der Fahrer den rostigen Oldtimer in eine etwas ruhigere, baumbestandene Nebenstraße, ganz offensichtlich eine wesentlich bessere Gegend als die, in der sie gestartet waren. Der Wagen rumpelte noch einige hundert Meter über den unebenen Straßenbelag zwischen den wild parkenden Autos zu beiden Seiten und kam dann vor einem großen, schmiedeeisernen Tor zu Stehen, welches Graubner sofort als dasjenige erkannte, das ihm am Telefon beschrieben worden war.
Flankiert von zwei verfallenden Torhäuschen bildete es die Einfahrt zu einem großen Grundstück und einer Villa, die Graubner teilweise hinter hohen Bäumen sehen konnte.
Nach wie vor wortlos bedeutete ihm sein merkwürdiger Fahrer auszusteigen, eine Aufforderung, der Graubner gerne nachkam. Auf der Straße stehend, in einer Luft, die kein bißchen besser war als im Fahrzeug, blickte er dem davonholpernden Wagen nach. Offenbar war sein Chauffeur schon bezahlt worden.
Er überlegte kurz, ob es wohl möglich wäre, sich noch schnell irgendwo Alkohol zu besorgen, doch das Quietschen des sich automatisch öffnenden Tores unterbrach diesen Gedankengang. Obwohl er nirgendwo Kameras entdecken konnte, war seine Ankunft offenbar schon bemerkt worden.
'Hol's der Geier', dachte Graubner und trat auf die staubige Auffahrt.
Langsam und erschreckend kraftlos ging er auf das Gebäude zu. Er schwitzte und fühlte sich dem Ende seiner Kräfte nahe.
Die vor ihm aufragende Villa war eindeutig nicht die Behausung eines armen Mannes. Von den einst weißen Außenwänden fiel der Putz und aus verschiedenen Rissen wuchsen unbekannte Pflanzen, doch der einstige Glanz war noch zu erahnen. Schmutzige Stufen aus edlem Stein führten hinauf zu einer von Säulen gerahmten, doppelflügligen Eingangstür.
Noch bevor Graubner das Ende der Treppe erreicht hatte öffnete sich ein Türflügel und eine einheimische, unscheinbare Frau mittleren Alters trat ins Sonnenlicht.
"Willkommen Professor Graubner", sagte sie erstaunlicherweise auf Deutsch, "Treten Sie ein. Ihr Gastgeber erwartet Sie".
"Danke", murmelte Graubner und hoffte, daß es in diesem Gemäuer kaltes Bier gab.
Dann trat er in das muffige Halbdunkel der Eingangshalle.
Im Gebäude war es etwas kühler als draußen. Graubner sah Treppenaufgänge rechts und links, die auf eine Galerie im ersten Stock führten.
"Folgen Sie mir", sagte die Frau bevor er sich weiter umsehen konnte. Sie führte ihn zu einer schweren Holztür am anderen Ende der Halle, die sie mit einiger Anstrengung aufzog und geleitete ihn in den dahinterliegenen Raum.
Hohe Bücherregale bedeckten fast alle Wände des Zimmers, Bücher stapelten sich zudem auf Tischen und Kommoden. Durch halb geschlossene Holzläden vor den hohen Fenstern fielen staubige Sonnenstrahlen auf den Dielenfußboden.
Graubner wußte gar nicht, was er erwartet hatte, aber irgendwie war er von dem Anblick doch überrascht. Der Bewohner dieser Villa schien ein vielseitig interessierter Mensch zu sein.
"Wenn man Jahrzehnte lang mehr oder weniger hier eingesperrt ist, hat man viel Zeit zum Lesen", sagte eine dünne, brüchige Stimme rechts von Graubner. "Und es sammelt sich einiges an".
Graubner wandte sich um und bemerkte jetzt die Gestalt, die in einer Ecke hinter einem großen Schreibtisch saß. 'Mein Gott', dachte er, 'der Mann muß uralt sein. Eine lebende Mumie'
Dieser Vergleich war nicht ganz unangebracht angesichts der dürren Erscheinung, der er sich gegenüber sah. Pergamentartige, dünne und fleckige Haut spannte sich über die kantigen Gesichtszüge des Mannes. Einige weiße Haarsträhnen bedeckten einen ansonsten fast kahlen Schädel. Und sein Gastgeber saß im Rollstuhl, wie Graubner nun auffiel.
Er trat näher und ergriff die knochige Hand, die sein Gegenüber ihm entgegenstreckte.
"Erstaunlich, daß Sie tatsächlich gekommen sind", sagte der Alte.
"Das finde ich auch", erwiderte Graubner, "aber die Andeutungen in Ihrem Brief haben ausgereicht, meine wissenschaftliche Neugier zu wecken."
"Das freut mich. Ich habe ausgiebige Erkundungen über Sie anstellen lassen, bevor ich mich entschlossen habe, Ihnen zu schreiben. Ich denke, ich weiß so gut wie alles über Sie. Deshalb nehme ich auch an, daß Sie im Moment vor allem Sehnsucht nach Bier haben."
Graubner war vorübergehend sprachlos und zuckte zusammen, als wie aus dem Nichts die Frau auftauchte, die in hereingelassen hatte und ihm ein Tablett mit mehreren Flaschen Bier entgegenhielt.
'Das gleiche Gebräu wie im Hotel', dachte er, 'aber immerhin kalt'.
"Meine Haushälterin Sunita", sagte der Mann im Rollstuhl. "Seit vielen Jahren bei mir und daher mittlerweile auch meiner Muttersprache mächtig."
Nachdem Graubner die halbe Flasche geleert und den anschließenden Schweißausbruch überstanden hatte, fand er seine Sprache wieder.
"Sie scheinen ja wirklich gut informiert zu sein. Und nachdem Sie so viel über mich wissen, würde es ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen uns sehr befördern, wenn Sie mir jetzt auch etwas über Ihre Person verraten würden."
"Das hatte ich auch vor", sagte der Mann, "und zwar in aller Offenheit. Nach fast siebzig Jahren Versteckspiel habe ich keine Lust mehr auf all die Lügen. Mein Name ist Altmann. Dies ist mein wirklicher Name, nicht das Pseudonym, unter dem ich die letzten Jahrzehnte in diesem Drecksland und in dieser verdammten Villa verbracht habe. Die meiste Zeit alleine und in Angst, entdeckt zu werden."
'Hört sich an, als wollte er tatsächlich reinen Tisch machen', dachte Graubner.
"Können Sie sich denken, worauf dies hinausläuft?", fuhr Altmann fort, ohne eine Antwort abzuwarten.
"Ja, ich bin einer der letzten Nazi-Kriegsverbrecher, die sich in Südamerika verkrochen haben. Ich kam 1947 auf der 'Rattenlinie' hierher, mit Hilfe des Vatikan und der 'Odessa'. Und habe seitdem fast wie ein Gefangener in diesem Haus gelebt, auf einem mit Kameras, Alarmanlagen und anderen Vorrichtungen gesicherten Grundstück. Von diesen Anlagen funktioniert heute einiges nicht mehr. Mit den Jahrzehnten wird man nachlässiger. Und mittlerweile, in meinem Alter ist es mir egal, ob meine Identität doch noch gelüftet wird. Meine Tage sind gezählt."
Graubner brauchte einen Moment, um zu begreifen, was er gerade gehört hatte. Als er dann sprechen wollte, versagte seine Stimme. Er nahm einen Schluck Bier und räusperte sich.
"Mit Hilfe der 'Odessa'?", fragte er. "Die 'Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen' ist ein Mythos.
"Ist sie nicht", sagte Altmann, "sie existiert in Teilen bis heute und sie hat seit Kriegsende unzähligen Nazis bei der Flucht geholfen, ihnen neue Identitäten beschafft, Schutz geboten und sie finanziell unterstützt. Wie glauben Sie, bin ich an diese Villa gekommen? Die 'Odessa' war eine mächtige und reiche Organisation. Heute ist sie das nicht mehr. Es gibt nicht mehr viele Nazis. Sie sterben aus."
Graubner fingerte nervös seine Zigaretten aus der feuchten Hemdtasche.
"Haben Sie was dagegen, daß ich rauche?", fragte er. Der alte Mann schüttelte den Kopf.
"Ihr verdammter Zigarettenrauch wird es nicht sein, der mich umbringt."
"Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich sagen soll zu dem, was Sie da erzählen", sagte Graubner, "aber nach Ihren ausführlichen Recherchen dürften Sie wissen, daß mir mittlerweile auch so einiges egal ist. Ihre NS-Vergangenheit interessiert mich eigentlich nur, sofern sie etwas mit dem zu tun hat, weswegen Sie mich hierhaben wollten. Ich habe kein Interesse daran, Sie irgendwelchen Behörden auszuliefern, damit Sie für das, was Sie möglicherweise verbrochen haben bestraft werden. Außerdem habe ich den Verdacht, daß siebzig Jahre angsterfüllten Lebens im Untergrund vielleicht schon Strafe genug sein könnten. Und Angst haben Sie doch immer noch. Trotz Ihrer Beteuerungen, es sei Ihnen inzwischen egal. Kann es sein, daß der Besitzer des Etablisements, in dem ich abgestiegen bin, ebenso wie der angebliche Taxifahrer zu der, sagen wir, Handvoll Leute gehören, denen Sie vertrauen können? Die für Geld den Mund halten. Haben Sie deshalb auf meine Unterbringung dort bestanden?"
Der Greis im Rollstuhl wirkte auf einmal noch zerbrechlicher. Sein Hände zitterten. Sein Gesicht war grau. Mühsam rollte er um den Schreibtisch herum und auf eine Sitzecke im hinteren Teil des Raumes zu.
"Vielleicht haben Sie recht, Graubner", sagte er mit leiser Stimme, "wichtig ist aber nur, daß ich vorerst auf Ihre Verschwiegenheit vertrauen kann."
"Das können Sie. Wie gesagt bin ich an dem interessiert, was Sie mir zeigen wollten."
"Dann kommen Sie und nehmen Sie hier Platz." Altmann deutete auf einen Sessel. "Ich erzähle Ihnen jetzt, worum es geht."
Graubner nahm eine weitere Flasche Bier vomTablett und folgte dann Altmanns Aufforderung.
"Ist Ihnen 'El Alamein' ein Begriff?", begann der alte Mann.
"El Alamein?", überlegte Graubner laut. "Soweit ich weiß eine Stadt in Ägypten und Schauplatz einer bedeutenden Schlacht des Zweiten Weltkriegs."
"Richtig, die zweite Schlacht von El Alamein leitete die endgültige Niederlage der Deutschen auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz ein. Vom 23. Oktober bis zum 04. November lagen dort das deutsche Afrikakorps unter Generalfeldmarschall Rommel und die mit uns verbündeten, aber unfähigen italienischen Verbände mit der britischen 8. Armee unter Lieutenant-General Bernard Montgomery im Kampf. Ich erspare uns Einzelheiten. Jedenfalls waren wir schließlich dem Gegner nicht gewachsen und Rommel war zum Rückzug durch Libyen gezwungen. Am Ende mußten die deutschen Truppen nach mehreren weiteren Niederlagen im Mai 1943 in Tunesien kapitulieren. Eine enorme Schmach für uns."
Graubner hielt sich an sein Bier und die Zigaretten und verkniff sich eine Bemerkung dazu, daß der alte Nazi immer noch von "wir" sprach. In gewisser Weise hatte er irgendwie Mitleid mit diesem Greis.
"Ich war damals auch in El Alamein", fuhr Altmann fort, "mit zwanzig Jahren einer der Jüngsten im Rang eines SS- Sturmbannführers. Aber ich nahm nicht an der Schlacht teil."
'Meine Güte', dachte Graubner, 'der Mann ist vierundneunzig Jahre alt.'
"Sie nahmen nicht an der Schlacht teil?", sagte er.
"Nein, zusammen mit zwei Kameraden war ich im Auftrag des 'Deutschen Ahnenerbes' dort, mit besonderem Auftrag. Ich nehme an, Sie haben von der 'Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e.V.' schon gehört. Das berührt ja in gewisser Weise Ihr Forschungsgebiet."
"Teilweise", erwiderte Graubner, "aber ich möchte meine Arbeit nicht mit dem unseligen Wirken dieser 'Forschungsgemeinschaft' verglichen sehen. Ich weiß, daß Ihr Reichsführer SS Himmler diese Einrichtung 1935 ins Leben rief, um in der Folge umfangreiche archäologische, anthropologische und geschichtliche Forschungen zu betreiben. Einige Expeditionen wurden im Namen des 'Ahnenerbes' durchgeführt, allerding kaum mit dem Ziel, ernsthafte wissenschaftliche Arbeit zu leisten, sondern vor allem, um Kulturgüter, Kunstwerke und religiös bedeutsame Gegenstände in den Besitz des Deutschen Reiches zu bringen und so auch auf diesen Gebieten die angebliche Vorrangstellung Ihres arischen Volkes zu untermauern. Himmler war besessen von okkulten Themen und geheimnisvollen, alten religiösen Überlieferungen. Sein 'Ahnenerbe' war unter anderem auch auf der Suche nach dem Heiligen Gral, der Bundeslade und Ähnlichem. Ich möchte nicht wissen, wie vielen Menschen diese Suche das Leben gekostet hat. Von den Menschenversuchen, die der 'Forschungsgemeinschaft' zur Last gelegt werden ganz zu schweigen."
"Ich widerspreche Ihnen nicht", sagte Altmann nach kurzer Pause, "nicht umsonst wurde ich als Angehöriger des 'Ahnenerbes' als Kriegsverbrecher eingestuft. Aber doch betrifft das Folgende spätestens jetzt, wo Sie hier sind, Ihr Forschungsgebiet. Sie sind Professor für Biblische Archäologie mit dem Schwerpunkt Christentum, richtig? Und ich denke, was ich Ihnen anzubieten habe, interessiert Sie nach wie vor sehr. Egal, woher es stammt. Sonst wären Sie schon gegangen."
Graubner schwieg.
Altmann atmete schwer, bevor er fortfuhr.
"Schon bevor die Schlacht von El Alamein begonnen hatte, waren meine Kameraden und ich dabei, uns in Zivil zum etwa 100 km entfernten Alexandria durchzuschlagen. Unser Auftrag war, etwas aus der dortigen koptischen St. Markus Kathedrale in unseren Besitz zu bringen. Dies in den Wirren der Kriegshandlungen zu tun, erschien unseren Auftraggebern offenbar einfacher, als in Friedenszeiten. Und um es kurz zu machen: Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir erreichten Alexandria Ende Oktober 1942 zwangen den Patriarchen der koptischen Gemeinde, uns den Aufbewahrungsort dessen was wir suchten in den Katakomben der Kathedrale zu verraten, stahlen es und sorgten dafür, daß der Geistliche nicht über diese Vorgänge würde berichten können."
Altmann machte den Eindruck, als würde er gleich das Bewustsein verlieren und lockerte sich mit bebenden Händen den Hemdkragen. Offenbar traf ihn die Erinnerung an diese Greueltat gerade mit besonderer Wucht.
Dieser Schwächanfall gab Graubner die Gelegenheit zu rekapitulieren, was er über die St.Markus Kathedrale in Alexandria wusste.
Der Legende nach kam Markus, der Autor des gleichnamigen Evangeliums, in den 40er oder 50er Jahren des 1. Jahrhunderts nach Alexandria, gründete dort eine christliche Gemeinde und wurde schließlich erster Bischof der Stadt. Auch der Bau der Kathedrale, die seinen Namen trägt, geht der Überlieferung nach auf die Initiative des Evangelisten zurück. Im Jahr 68 n.Chr. soll Markus in Alexandria den Märtyrertod erlitten haben und unter seiner Kirche begraben worden sein.
828 n.Chr. stahlen die Venezianer den Leichnam und bestatteten ihn im eigens dafür errichteten Markusdom in Venedig.
Die heutige St. Markus Kathedrale von Alexandria stand, wie Graubner zu wissen glaubte, nach mehreren Zerstörungen und Wiederaufbauten immer noch auf den Grundmauern der von Markus gegründeten Kirche.
Natürlich wurde solchen altkirchlichen Überlieferungen in der Forschung kaum irgendein Geschichtswert beigemessen, wenn man seinen Ruf als seriöser Wissenschaftler nicht aufs Spiel setzten wollte.
Doch Graubner war da durchaus anderer Ansicht.
Ein Röcheln aus dem Rollstuhl ihm gegenüber unterbrach seine Überlegungen. Altmann stemmte sich auf den mageren Armen nach oben, um wieder bequemer zu sitzen. Scheinbar hatte er sich weitgehend erholt.
"Ein Flugzeug ohne Hoheitskennzeichen mit einer Besatzung aus Kollaborateuren flog uns schließlich von irgendwo außerhalb Alexandrias aus nach Europa zurück", sagte er mit rauer Stimme.
"Was haben Sie aus der Kathedrale geholt?", fragte Graubner. Altmanns Brief hatte Andeutungen enthalten, aber noch immer war nicht klar, um was genau es ging.
"Das werde ich Ihnen jetzt zeigen", antwortete der alte Mann und drückte einen Knopf an der Wand neben ihm. Fast augenblicklich erschien seine peruanische Haushälterin in der Tür.
"Warten Sie hier", sagte Altmann.
Graubner ging auf den knarrenden Dielen zu einem der großen Fenster, stieß den Laden weiter auf und warf einen Blick auf das verwilderte Grundstück, das die Villa umgab. Ein leiser Windhauch wehte ihm warme Luft ins Gesicht. Ihm war immer noch übel und mittlerweile leicht schwummrig vom Bier. Einen Augenblick lang fürchtete er, er müsse sich aus dem Fenster übergeben, doch es gelang ihm, diesen Impuls zu unterdrücken. 'Was tust du hier, Graubner?, fragte er sich zum wiederholten Mal. 'Ein abgehalfterter Wissenschaftler, der Deals mit einem greisen Nazi-Kriegsverbrecher macht? Unglaublich. Aber genau das bist du. Doch, genau das.' Graubner stieß ein heiseres, rasselndes Lachen aus und schüttelte den Kopf. Er starrte in den bleiern heißen Himmel Limas, bis er hinter sich das Quietschen der Gummireifen von Altmanns Rollstuhl hörte.
Er wandte sich um und sah einen Gegenstand in der Hand des alten Mannes, den er sofort als Kanope erkannte, einen jener kunstvoll verzierten und bemalten Miniatursarkophage, welche die alten Ägypter zur Bestattung der Eingeweide ihrer Toten verwendeten.
Das Exemplar, welches Altmann nun auf den Tisch legte, war ca. 40 cm lang und offenbar aus Holz.
"Sie haben mich doch nicht hierher geholt, um mir das zu zeigen.", sagte Graubner, "Die altägyptischen Kanopen waren aus Stein oder Ton. Das Ding hier ist nicht besonders alt."
"Dies ist nur das Behältnis, in dem das eigentliche Objekt im Laufe der Zeit unentdeckt über verschiedene Grenzen geschmuggelt wurde", sagte Altmann. "Öffnen Sie es."
Behutsam hob Graubner das Oberteil des kleinen Sarkophages ab und warf einen Blick ins Innere. Er spürte, daß sein Puls sich beschleunigte. In der Kanope lag eine Papyrusrolle mit Schriftzeichen auf dem sichtbaren oberen Teil.
"Das ist das, was wir aus der Kathedrale in Alexandria geholt haben", sagte Altmann, "und obwohl ich nicht viel Ahnung davon habe, denke ich, daß es sehr wertvoll sein muß. Himmler wollte es unbedingt haben. Als wir kurz vor Kriegsende die Schätze des 'Deutschen Ahnenerbes' in Kisten verpackten, um sie in Sicherheit zu bringen, habe ich es gestohlen und seither nicht mehr aus den Augen gelassen."
Graubner schluckte. "Warum ist der Papyrus so gut erhalten?, fragte er. "Das Klima, in dem er die letzten Jahrzehnte hier verbracht hat, ist nicht gerade dazu geeignet, solches Material zu erhalten."
"Ich bin vom Wert dieses Schriftstücks so überzeugt", erwiderte Altmann, "daß ich es die ganze lange Zeit über in einem Schutzbehälter in klimatisierter Umgebung aufbewahrt habe. Der Raum befindet sich im Keller."
Beeindruckt sah Graubner sein Gegenüber an.
"Darf ich mir die Rolle etwas genauer ansehen?", fragte er. Seine Benommenheit war verschwunden und einer gespannten Neugierde gewichen.
"Natürlich", sagte Altmann, "deshalb wollte ich Sie hierhaben."
Graubner drehte die Kanope so, daß die am oberen Ende der Rolle sichtbaren Schriftzeichen in seine Richtung zeigten.
"Dieser Papyrus ist definitiv sehr alt", sagte er, "soviel kann ich schon mal sagen. Darauf deutet auch der Stil hin, in dem er beschrieben ist."
"Unglaublich", murmelte er, "das ist Aramäisch."
Graubner versuchte die sichtbaren Zeilen zu lesen, doch ihm wurde schwarz vor Augen, als er auf den Namen stieß.
"Großer Gott", flüsterte er und unter dem Schweißfilm auf seinem Körper bildete sich eine Gänsehaut.
2
"Die Kirche interessiert nicht, ob Gott existiert", schrie Kardinal Maldini.
Das Einzige, was die Kirche interessiert, ist ihre eigene Existenz. Daß sich nichts ändert und ihre Autorität erhalten bleibt."
Die Worte hallten von den marmorverkleideten Wänden des großen Raumes wider.
Wie er diese von Idealismus umnachteten, niederen Ränge hasste, die im Vatikan immer wieder ihr Unwesen trieben.
Vor seinem schweren Mahagonischreibtisch stand eine Gruppe von fünf Männern in Priesterkleidung, unter ihnen ein junger, französischer Kaplan, Clément, glaubte Maldini sich zu erinnern, der ihm schon wiederholt unangenehm aufgefallen war. Durch lästige Fragen.
"Aber", meldete sich nun wieder dieser Clément zu Wort," es ist doch unsere Aufgabe vor Gott, den Menschen von der Wirklichkeit seiner Existenz zu künden und die Wahrheit der Botschaft Jesu weiterzugeben. Und wenn uns neue Erkenntnisse, diese Wahrheit betreffend, geschenkt werden, dürfen wir sie den Menschen nicht vorenthalten."
Maldini rückte das große Silberkreuz auf seiner Brust zurecht. Hatte dieser Kleingeist ihm nicht zugehört?
"Eigentlich sollte die Tatsache, daß Sie in einem Archiv des Vatikan arbeiten, von dem außerhalb dieser Mauern niemand etwas weiß, obwohl doch das Geheimarchiv offiziell geöffnet ist, Ihre Frage schon beantwortet haben.
Und was immer Sie jetzt in den unbekannten Gewölben des Vatikan gefunden haben wollen, wird die Wahrheit nicht ändern.
Die Kirche hat vor langer Zeit gut sortiert, was wahr zu sein hat und was nicht. Die Tatsache, daß sie seit zwei Jahrtausenden an dieser, ihrer Wahrheit festhält, egal was passiert, hat sie zur ältesten existierenden und noch funktionierenden Institution der Welt gemacht.
Und ich habe nicht vor, jetzt an dieser Strategie irgendetwas zu ändern."
Tatsächlich hatte der alternde Kardinal hier seit Jahrzehnten ein Amt inne, in dem seine Funktion genau darin bestand, als graue Eminenz und möglichst unbemerkt dafür zu sorgen, daß nichts ans Tageslicht kam, was der Lehre der Kirche allzusehr widersprach und Probleme aufwerfen würde, die nicht mehr durch schweigendes Aussitzen zu lösen wären.
Selbst der Papst wusste nicht immer, was Maldini tat und das gläubige Volk musste es erst recht nicht wissen.
Und nun stand dieser Clément samt Verstärkung vor ihm und meinte, etwas, das er bei seiner Arbeit in einem alten Archiv entdeckt hatte, sollte unter Mitwirkung außerkirchlicher Experten weiterverfolgt werden.
Maldini versuchte, sich zu beruhigen.
"Mein lieber Kaplan", sagte er und beugte sich dem jungen Mann über den Schreibtisch entgegen, "wir haben 'Q' im Keller. Ja, Sie haben richtig gehört. 'Q', die legendäre, verschollene Quelle des Matthäus- und des Lukasevangeliums.
Und wir haben große Teile des hebräischen Ur-Matthäus, von dem schon Papias von Hierapolis zu Beginn des 2. Jahrhunderts berichtet hat. Aber ihm hat keiner geglaubt. Auch der große Eusebius von Caesarea, der Papias im 4. Jahrhundert zitiert, hält ihn für größtenteils unglaubwürdig.
Doch Papias hatte recht.
Wissenschaftler auf der ganzen Welt würden sich die Finger lecken nach diesen Dokumenten, doch sie sind verschollen. In unseren Kellern.
Sie wollen wissen, was in 'Q' und dem ursprünglichen Matthäusevangelium steht?
Nun, wir haben die Texte übersetzt und entschieden, daß ihr Inhalt in Teilen der Wahrheit nicht zuträglich ist, weshalb er auch unbekannt bleiben wird."
Die fünf Männer standen mit offenen Mündern da und starrten Maldini ungläubig an.
Clément fand als Erster die Sprache wieder.
"Das kann doch nur ein Scherz sein", murmelte er heiser, obwohl er wusste, daß Maldini nicht für Scherze dieser Art bekannt war.
"Was?", fragte der Kardinal und fixierte Clément.
"Ein Scherz, oder?", sagte dieser. "Ich kann nicht glauben, was Sie da sagen, Eminenz."
"Sollten Sie aber", erwiderte Maldini, dessen Gesichtsfarbe sich schon wieder dem Kardinalspurpur seines Gewandes annäherte. "Sie werden schon bald merken, wie ernst ich meine, was ich sage. Mit dem, was Sie glauben entdeckt zu haben, wird nichts anderes geschehen, als mit den Dokumenten, von denen ich gerade gesprochen habe.
Verstehen Sie endlich." Der Kirchenmann wurde wieder lauter.
"Der Felsen, auf dem die Kirche gebaut ist, ist nicht Petrus, sondern die Verschwiegenheit seiner Nachfolger. Und wir besitzen weder die Schlüssel zum Himmelreich, noch die zur Wahrheit.
Die Kirche verkauft seit zwanzig Jahrhunderten teuer, was ihre Autorität stützt und erhält. Die Kirche umarmt die ganze Welt und die Welt gibt der Kirche Unterstützung, damit die Umarmung nicht aufhört. Wir verkaufen keine Ablässe mehr, aber die Leute bezahlen trotzdem dafür. Vorsichtshalber sozusagen.
Die Schlüssel von St. Peter sind nicht die zum Himmelreich, sondern die zur Kasse.
Finanzielle Mittel, Verschwiegenheit und Autorität garantieren der Kirche ihr Fortbestehen. Und sie hat noch Autorität.
Das Wirken des Vatikan, in Gestalt Johannes Pauls II., hat den eisernen Vorhang zu Fall gebracht.
Der Tag, an dem Franziskus Bogota besuchte, war der einzige Tag im Jahr, an dem in der Stadt kein Mord begangen wurde.
Das ist die Autorität der Kirche, völlig unabhängig davon, was die Wahrheit ist oder nicht."
Maldini keuchte. Ihm war heiß und sein Hals war rauh.
"Verschwinden Sie", stieß er hervor, "tun Sie Ihre Arbeit und halten Sie den Mund. Es wird Ihnen sowieso niemand glauben."
Der Kardinal wartete, bis die Tür hinter den Männern ins Schloß gefallen war, dann ließ er sich in den Schreibtischsessel sinken und lehnte sich zurück.
Mit seinen fahrigen Händen hatte er Mühe, die Pakkung Diazepam aus der Hosentasche unter der Soutane zu ziehen. Er griff nach dem Glas Wasser auf seinem Schreibtisch und spülte eine der Tabletten hinunter.
In der vatikaneigenen Apotheke bekam man dieses Zeug jederzeit und in beliebigen Mengen. Offenbar war er nicht der Einzige hier, dem das alleinige Vertrauen auf Gottes schützende Fürsorge nicht ausreichte, um Ruhe und Frieden zu finden.
Den Blick ins Leere gerichtet, saß Maldini eine halbe Stunde lang reglos da, bis er spürte, wie die Wirkung einsetzte. Seine Muskeln entspannten sich, der Druck in seinem Kopf verschwand und eine warme Ruhe breitete sich aus.
Er beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf den Tisch und fuhr sich mit den Händen durch das schüttere Haar.
Manchmal sehnte er sich nach dem Glauben, der ihn einst bewogen hatte, Priester zu werden. Doch er konnte ihn nicht mehr finden. Er dachte an die Zeit als junger Pfarrer einer kleinen Gemeinde in den Abruzzen, als er so gewesen war, wie die Männer, die er gerade niedergemacht hatte. Voller Enthusiasmus für die Sache Jesu, die Sache Gottes. Doch wo war all dies geblieben? Es war ein langer Weg gewesen und irgendwo auf diesem Weg hatte er seinen Glauben verloren.
Zuerst war er in die Dienste des Bischofs seiner Diözese berufen worden und dann, 1975, mit 30 Jahren und auf Empfehlung seiner Vorgesetzten hin, in den Vatikan gewechselt.
Vier Jahre später starb Johannes Paul I. nach nur 33 Tagen Pontifikat und Maldini hatte in der Überzeugung, daß dies seine Pflicht sei, entscheidend daran mitgewirkt, daß die genauen Umstände dieses mysteriösen Todes für die Öffentlichkeit ungeklärt geblieben waren.
Dies war der Beginn seiner Karriere als oberster Geheimniswächter des Vatikan gewesen. Offenbar hatte er seinen Job so gut gemacht, daß er nach kurzer Zeit zum Kardinal der Kurie ernannt worden war.
Und nun saß er hier, ein Kirchenfürst, den niemand kannte, weil er im Verborgenen wirkte, als Leiter einer inoffiziellen Kongregation, die im Laufe der vielen Jahre dafür gesorgt hatte, daß nichts Beweisbares die Festungsmauern des Kirchenstaates verließ, was die Katholische Kirche irgendwie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen könnte.
Nicht im Fall des spurlos verschwundenen fünfzehnjährigen Mädchens Emanuela Orlandi, die mit ihren, vom Kirchenstaat angestellten Eltern im Vatikan lebte.
Nicht im Fall der Ermordung eines Schweizer Gardisten oder einer ganzen Reihe weiterer unangenehmer Vorfälle auf vatikanischem Staatsgebiet.
Und eben auch nicht, wenn alte Dokumente auftauchten, die Zweifel an der Lehre der Kirche wecken könnten.
Kardinal Maldini hob den Kopf aus den Händen und stieß ein kraftloses Stöhnen aus.
Er war vom Diener Gottes zum Diener der Kirche geworden und es kotzte ihn an.
Dies hier war ganz sicher nicht das, was Jesus gewollt hatte. Es war der Weg, den die Kirche gewählt hatte und den er, Maldini, nun schon so lange mitging, daß er keine Abzweigung mehr fand.
Der großgewachsene, hagere Mann erhob sich mühsam und schritt über die kostbaren Teppiche auf dem Marmorboden zu einer Tür im hinteren Teil des Raumes. Er trat in ein kleines Gemach und begann, sich seiner Kardinalsgewänder zu entledigen. Er tauschte sie gegen einen schlichten schwarzen Anzug und ein schwarzes Hemd ohne Priesterkragen. Nichts an seinem Äußeren verriet mehr den Kirchenmann.
Maldini ignorierte das Telefon, das gerade zu klingeln begann, verließ sein prunkvolles Büro und machte sich auf den Weg durch die langen Gänge des Vatikan.





























