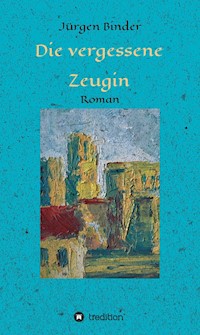9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kirchenschatz von Lima. Verborgen auf einer kleinen, unbewohnten Insel im Pazifik. Hat es ihn überhaupt je gegeben? Oder ist er nur Mythos und Legende, existent lediglich in der Phantasie all derer, die sich auf die Suche nach ihm gemacht haben? Jede Schatzsuche ist, vielleicht wie das Leben überhaupt, eine Geschichte vom Finden und Verlieren, und ebendies ist auch das Abenteuer der Protagonisten dieses Romans, die aufbrechen, um die Wahrheit von der Legende zu trennen und Schatten von Schimmer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jürgen Binder, geboren 1961 in Butzbach,
Wetteraukreis, lebt seit 1993 mit seiner Frau in Frankfurt am Main.
Vom selben Autor außerdem bei tredition erschienen:
Die vergessene Zeugin[,.] Roman
Staub der Himmel, Roman
Das einsame Herz des Nebelfängers[,.]
Erzählung.
JÜRGEN BINDER
***
INSELN AUSSCHATTEN UNDSCHIMMER
Roman
© 2023 Jürgen Binder
ISBN Softcover: 978-3-347-80963-5
ISBN Hardcover: 978-3-347-80967-3
ISBN E-Book: 978-3-347-80973-4
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10,
22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Der vorliegende Roman stellt eine fiktive, aber auf realen Ereignissen basierende Geschichte dar.
Umschlagabbildung: Jürgen Binder, o. T., Öl auf Karton 2020
Für meine Schwester Christine
Tempus est umbra in mente
Manchmal,
wenn Wirklichkeit, Traum und Phantasie
zu einer einzigen Realität verschmelzen, existiert alles gleichzeitig,
verlieren Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ihre Bedeutung.
Alles ist gleich real, alles ist jetzt.
Und Zeit nur ein Schatten in unserem Geist.
Erster Teil
Aufbruch
Mahabalipuram, Golf von Bengalen
Ein milchiger Dunstschleier bedeckte den Himmel über der Küste und ließ das hindurchdringende Sonnenlicht, das auf den Strand der kleinen Stadt fiel, merkwürdig diffus und kraftlos erscheinen. Die Schatten der in den Sand gezogenen Fischerboote und der Bäume, die weiter hinten die Bucht säumten, waren blass und ohne Tiefe, wenig mehr, als konturlose Schemen.
Und als würde die feucht-heiße Luft des Vormittags schwer auf ihr lasten, erstreckte sich die Wasserfläche des Meeres fast spiegelglatt in die Ferne, wie mattes Metall, dessen Farbe irgendwo am Horizont mit der des Himmels verschmolz, zu einem unwirklichen Etwas, das einem Kopfschmerzen verursachte, wenn man den Blick zu lange darauf gerichtet ließ.
Es war einer der seltenen windstillen Tage an der Küste vor Mahabalipuram, wo sich sonst beständig die Wellen brachen, und selbst den alteingesessenen Fischern des Ortes schien die brütende Hitze zu schaffen zu machen, denn bis jetzt war kaum eines der vielen Boote vom Strand hinausgefahren, und überall im Sand verteilt lagen die Netze noch genauso, wie sie Gestern zum Trocknen dort ausgebreitet worden waren.
Nur um den alten Küstentempel herum war vereinzelt Bewegung zu sehen, wenn unverzagte Touristen erschienen, um das Bauwerk zu bewundern, einen dem Gott Shiva geweihten Schrein aus dem Ende des 8. Jahrhunderts, der zu den ältesten Steintempeln Südindiens zählte.
Direkt am Strand gelegen, war auch er normalerweise von den heranrollenden Wogen des Meeres umspült, doch heute schwappte das Wasser des Golfs von Bengalen nur träge an die zu seinem Schutz errichteten Wellen-brecher, zu schwach, um Gischt emporspritzen zu lassen, die den Touristen vielleicht etwas Abkühlung hätte verschaffen können.
Mahabalipuram, ein Ort mit rund 16.000 Einwohnern, lag im Südosten Indiens, im Bundesstaat Tamil Nadu an der Koromandel-Küste, circa 60 Kilometer entfernt von Madras und war berühmt für seinen Tempelbezirk, der seit 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählte.
Ebenso wie der Küstentempel, gehörten auch die Bauwerke dieses mitten in der Stadt liegenden Areals zu den ältesten des Landes, allesamt entstanden im 7.und 8. Jahrhundert, als Mahabalipuram der wichtigste Hafen des Pallava-Reiches gewesen war, des Herrschaftsgebietes eines gleichnamigen altindischen Geschlechts.
Die Baudenkmäler an Land waren jedoch nicht die einzigen, die Mahabalipuram zu bieten hatte.
Schon seit langer Zeit waren im Meer vor der Küste weitere antike Bauten vermutet worden, eine Vorstellung, die genährt wurde von alten Überlieferungen und den Erzählungen von Fischern, die sie bei klarem Wasser von ihren Booten aus gesehen haben wollten.
Die Legenden besagten, dass der Küstentempel der einzig erhalten gebliebene aus einem Komplex von sieben Tempeln war, der sich einst über eine Strecke von 10 Kilometern die Küste entlang gezogen hatte, bevor die ganze Anlage von einer Flut vernichtet und auf dem Meeresgrund begraben worden war.
Und tatsächlich hatten diese Geschichten eine unerwartete Bestätigung erfahren, als am 26. Dezember 2004, ausgelöst von einem starken Seebeben im Indischen Ozean, ein verheerender Tsunami auch auf die Küsten des Golfs von Bengalen zugerollt war.
Vor Eintreffen der gewaltigen Flutwelle, im ihr vorauseilenden Sog, hatte sich das Meer zunächst weit zurückgezogen und für kurze Zeit den Blick freigegeben auf Ruinen, die bis dahin unter der Wasseroberfläche verborgen gewesen waren.
In den Jahren nach der Flutkatastrophe hatten diese Beobachtungen schließlich verstärkt Unterwasserarchäologen auf den Plan gerufen und bis heute waren an mindestens fünf verschiedenen Stellen vor der Küste die Überreste einander ähnelnder Anlagen entdeckt worden, bestehend aus rechteckigen Steinquadern, Mauern und Treppen sowie weiteren bearbeiteten, Gebäude-strukturen.
Jene Funde waren es auch, die den Mann angezogen hatten, der sich jetzt mit einigen kräftigen Schlägen der Flossen an seinen Füßen nach oben bewegte, auf den Rumpf des kleinen Fischerbootes zu, das über ihm auf der Oberfläche der glatten See dümpelte.
Bertrand Dubois war kein Unterwasserarchäologe, ehrlich gesagt hasste er Tauchgänge sogar, weil er sich nie ganz von der beklemmenden Befürchtung hatte befreien können, hier unten gleich die Orientierung zu verlieren und dann, wenn ihm der Sauerstoff ausging, jämmerlich zu ertrinken.
Nicht dass er jemals in eine solche Situation geraten wäre, aber das Gefühl wollte einfach nicht verschwinden.
Deshalb war er froh, als er nun die Wasseroberfläche durchstieß und sich das Atemgerät vom Gesicht riss, erleichtert, wieder normale Luft in seine Lungen zu bekommen.
Mit beiden Händen umfasste er den Rand der hölzernen Bordwand und begann, sich nach oben zu ziehen. Fast brachte er das Boot dabei zum Kentern, doch der hagere Inder in dem schmierigen, weißen Hemd, der auf den Planken des Kahns gedöst hatte, jetzt aufgeschreckt durch die plötzliche Bewegung, bemühte sich hektisch, auf der anderen Bordseite ein Gegengewicht zu bilden.
Nach zwei erfolglosen Versuchen gelang es Bertrand Dubois schließlich, sich ins Boot zu hangeln und die Gurte mit den Sauerstoffflaschen abzustreifen.
Keuchend ließ er sich auf einen der Sitzstege sinken und führte Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand an die Lippen, um seinem Begleiter deutlich zu machen, wonach ihm jetzt der Sinn stand.
„Cigarettes“, sagte er auf Englisch, der Sprache, in der er sich, in Verbindung mit Handzeichen, hier einigermaßen verständigen konnte.
Von dem Tamil, welches die Einheimischen sprachen, erschloss sich ihm kein einziges Wort, ja, er vermutete sogar, dass nicht einmal sie selbst immer verstanden, was sie sagten. Vielleicht entstand dieser Eindruck aber auch durch andere Aspekte der ganz und gar fremdartigen, indischen Mentalität, welcher er in den vergangenen Tagen häufig ratlos gegenübergestanden hatte.
„Beach“, sagte er jetzt und deutete in Richtung des Strandes, der in vielleicht 500 bis 700 Metern Entfernung im dunstigen Sonnenlicht lag.
Der Inder, der inzwischen Dubois' Zigarettenpackung aus einer Art Seesack hervorgekramt hatte, warf daraufhin den kleinen Außenbordmotor an und begann, das Boot in gemächlichem Tempo zurück zur Küste zu lenken.
Bertrand Dubois, ein Mann von 45 Jahren, mit Neigung zu einem leichten Bauchansatz, ansonsten aber in erstaunlich guter körperlicher Verfassung, war vor einer Woche mit einer Air India Maschine aus Paris gekommen und nach einem 13-Stunden Flug, einschließlich einer Zwischenlandung in Karatschi, endlich in Madras gelandet, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu.
Man schätzte, das Madras mindestens 6,5 Millionen Einwohner hatte, genau schien das niemand zu wissen, und an der Rezeption des Hotels, in dem er eine Nacht verbracht hatte, war ihm dringend davon abgeraten worden, in dieser Stadt selbst Auto zu fahren oder auch die 60 Kilometer bis Mahabalipuram auf eigene Faust zurückzulegen.
Doch er hatte darauf bestanden, die Reise in einem Mietwagen alleine fortzusetzen. Schließlich war er als Einwohner von Paris in Sachen Straßenverkehr einiges gewohnt.
Doch diese Annahme sollte sich als furchtbare Fehleinschätzung erweisen.
Von dem Wagen, der ihm schließlich zur Verfügung gestellt worden war, hatte sich unmöglich sagen lassen, um welche Fahrzeugmarke es sich handelte, möglicherweise war er aus verschiedenen Modellen zusammengeschraubt worden, und nach mehrstündiger Fahrt durch ein unvorstellbares Chaos aus Menschen, Autos, Motorrädern, LKWs, Bussen, Fahrrädern, Karren und heiligen Kühen, das zwischen Müll und Dreck praktisch lückenlos auf allen Straßen herrschte, und nachdem er mindestens zehnmal nur um Haaresbreite schwere Unfälle hatte vermeiden können, war er, der verkehrserfahrene Pariser, am Stadtrand ausgestiegen und hatte zitternd und einem Nervenzusammenbruch nahe im Hotel angerufen, um sich einen Fahrer schicken zu lassen.
Mit einem wissenden Grinsen im Gesicht hatte dieser ihn dann nach Mahabalipuram gefahren, eine Erfahrung, die kaum weniger angsteinflößend gewesen war, als seine eigenen Fahrversuche, doch nach einiger Zeit hatte er einfach die Augen geschlossen und sich seinem Schicksal ergeben.
Verglichen damit fühlte er sich jetzt, in dem kleinen Boot, mit dem sein Begleiter ihn in den vergangenen Tagen für ein paar Rupien hinaus zu den Tauchplätzen gefahren hatte, ausgesprochen wohl.
Die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens war Bertrand Dubois das gewesen, was manche Leute einen Lebenskünstler nennen würden, andere vielleicht einen Taugenichts oder gar Hallodri, der überwiegend sinnlosen Tätigkeiten nachging, mit denen nichts zu verdienen war und sich dabei von Anderen aushalten ließ.
Diese Einschätzung war nicht völlig aus der Luft gegriffen, denn ja, er hatte sich nach einem abgebrochenen Studium der Anthropologie nur jeweils über Zeiträume von wenigen Jahren mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs selbst über Wasser halten können, war zwischendurch immer wieder auf die Unterstützung seiner wohlhabenden Eltern angewiesen gewesen, die in der Gegend um Marseille seit langem im Fischhandel erfolgreich waren oder hatte mehr oder weniger vom Geld der Frauen gelebt, mit denen er zusammen gewesen war.
Und immer wieder war er aufgebrochen, um einer Leidenschaft nachzugehen, die spätestens seit der Zeit in ihm wohnte, als er Bücher wie „Die Schatzinsel“, „Robinson Crusoe“ und andere gelesen hatte, deren Geschichten wahrscheinlich so ziemlich jeder Junge irgendwann fasziniert gefolgt war.
Es war die Leidenschaft für das Entdecken unbekannter Welten, für die Suche nach verlorengeglaubten Schätzen, materieller oder immaterieller Art, Dinge, an deren Existenz er glauben wollte.
Darum reiste er, wann immer es seine finanzielle Situation erlaubte, meistens alleine und ohne vernünftige Vorbereitung durch die Welt, auf den Spuren irgendwelcher Legenden und Sagen, die seine Phantasie beflügelten und vielleicht eines Tages zu Orten führten, die all das Suchen wert waren.
Aber es gab noch etwas anderes, das es ihm erschwerte, ein irgendwie geregelteres Leben zu führen.
Es war der Verlust seiner großen Jugendliebe, eines wunderbaren Mädchens namens Sandrine Lestrange, über deren Verschwinden aus seinem Leben er nie hinweggekommen war.
Sie waren beide Siebzehn gewesen und so sehr verliebt, als Sandrine mit ihren Eltern aus Marseille hatte wegziehen müssen, weil diese sich am anderen Ende der Welt, in Neuseeland ein besseres Leben erhofft hatten.
Bevor sie gegangen war, hatten sie einander geschworen, sich nie zu vergessen und immer in Kontakt zu bleiben, wohin es sie auch verschlagen mochte.
Ein Jahr lang, in dem sie Briefe voller Sehnsucht geschrieben und fast täglich telefoniert hatten, war dies auch gutgegangen, doch dann, von Heute auf Morgen, hatte Sandrine nicht mehr angerufen, keine Briefe waren gekommen und unter ihrer Nummer war niemand mehr an den Apparat gegangen.
Irgendwann, Monate später, war der Hörer von jemandem abgehoben worden, den Bertrand nicht kannte und der ihm nur hatte erklären können, dass keine Sandrine Lestrange hier wohne und ihm der Name auch noch nie zu Ohren gekommen sei.
Sandrine war verschwunden und seitdem hatte sich Bertrand Dubois nirgendwo mehr wirklich zuhause fühlen können. Nicht in den Beziehungen mit anderen Frauen, nicht in seinen Jobs und auch nicht in den verschiedenen Wohnungen, in denen er gelebt hatte. Höchstens in sich selbst und sogar das war keineswegs immer uneingeschränkt der Fall.
Mit Zwanzig war er bei seinen Eltern ausgezogen, weil er es auch dort nicht mehr ausgehalten hatte und manchmal vermutete er, dass all sein rastloses Umherziehen nichts anderes war, als die Suche nach etwas, das die Leere füllen konnte, die Sandrines Weggehen in ihm hinterlassen hatte.
Oder vielleicht, auch wenn er jetzt auf seinen verschlungenen Wegen nicht mehr ständig an sie dachte, vielleicht war es überhaupt nur sie, die er auf seinen Reisen, irgendwo in der Welt wiederzufinden hoffte.
Er hob den Kopf und sah, dass sie die Küste gleich erreicht haben würden.
Bis jetzt hatte er nichts gefunden, draußen im Golf von Bengalen, obwohl er den zahlreichen Hinweisen der Fischer gefolgt war, die behaupteten, die Ruinen gesehen zu haben. Säulengeschmückte, große Bauwerke, von denen die offiziell forschenden Unterwasserarchäologen noch gar nichts wussten.
Zweifellos gab es in diesem Land noch vieles zu finden, wie vor nicht allzu langer Zeit erst die Entdeckungen in den Kellergewölben des Sri-Padmanabhaswamy-Tempels in der südindischen Stadt Thiruvananthapuram gezeigt hatten. Gott, wie er diese indischen Wortmonster hasste.
Säckeweise waren dort Goldmünzen, goldene Statuen, Edelsteine und Kronen gefunden worden, deren Wert mindestens 15 Milliarden Euro betrug, was den Schatz wahrscheinlich zum größten, jemals gefundenen machte.
Und dabei waren noch nicht einmal alle unterirdischen Kammern geöffnet worden. Kammer „B“, verschlossen mit einer verzierten Eisentür, ohne Schloss, Schrauben oder Riegeln, hatte man bis heute unangetastet gelassen, weil religiöse Vertreter auf einer alten Überlieferung beharrten, der zufolge die Öffnung der Tür Unheil über die ganze Welt bringen würde.
Ebenso würden die gefundenen, gewaltigen Schätze wohl ungenutzt in den Gewölben liegenbleiben, obwohl das Land jeden Zuwachs an finanziellen Möglichkeiten dringend hätte brauchen können.
Doch praktisch alle Angehörigen der indischen Religionsgemeinschaften hatten mit Hungerstreik, Revolten und Ähnlichem mehr gedroht, sollte der Staat jemals Hand an die Reichtümer legen. Und kein indischer Politiker hatte je ernsthaft gewagt, sich mit den Vertretern der tief in der Gesellschaft verwurzelten, religiösen Traditionen an-zulegen.
Bertrand Dubois bemerkte, dass sein Begleiter den Motor des kleinen Fischerbootes gestoppt hatte und sie nun langsam die letzten Meter bis zum Strand trieben, wo das Gefährt schließlich auf den Sand auflief.
Und erst jetzt fiel ihm der braunhäutige Mann mit den schwarzen Haaren auf, der in einiger Entfernung zwischen den Fischernetzen stand und sie zu beobachten schien.
Er trug eine bunte Kurta, das traditionelle knielange Hemd mit Knopfleiste und seitlichen Taschen, eine weite, weiße Hose und in der Hand etwas, das von hier aus wie ein brauner Din A4-Umschlag aussah.
Ohne sich zu bewegen verfolgte der Mann, wie Dubois seine Ausrüstung zusammenraffte, dem Fischer, der ihn gefahren hatte einige Geldscheine in die Hand drückte und sich dann auf den Weg den Strand hinauf machte.
„Mister Dubois?“, sagte der Mann, als Bertrand an ihm vorbeigehen wollte.
„Mister Bertrand Dubois?“
Dubois zögerte mit einer Antwort, weil er befürchtete, sein Gegenüber könne der Vertreter irgendeiner Institution sein, der seine eigenmächtigen Tauchexpeditionen im Golf missfielen.
„Ja“, sagte er dann nur und nach einer kurzen Pause: „Darf ich erfahren, wer Sie sind?“
„Entschuldigen Sie“, erwiderte der Mann in bestem Englisch. „Mein Name ist Mahendra Sharma. Ich bin gekommen, weil ich von Ihnen gehört habe. Von dem Franzosen, der nach den alten Ruinen im Meer sucht. Wissen Sie, Mahabalipuram ist nicht besonders groß. Die Dinge sprechen sich hier schnell herum.“
Dubois sah den Mann verständnislos an und ein Lächeln breitete sich in dessen Gesicht aus.
„Keine Sorge“, sagte er, als könne er Gedanken lesen. „Mich interessiert nicht, ob das, was Sie hier tun vollständig legal ist. Ich suche jemanden mit offenem Geist, jemanden der außergewöhnliche Dinge auf unkonventionelle Art angeht, jenseits der üblichen Vorgehens-weisen.
Und nach allem, was ich über Sie gehört habe, könnten Sie ein Mann sein, der meinen Vorstellungen entspricht.“
„Ausgerechnet ich?“, sagte Dubois, der keine Ahnung hatte, auf was der Fremde hinauswollte. „Was haben Sie denn über mich gehört?“
„Dass Sie alleine hier sind“, erwiderte sein Gegenüber, „und dass Sie ohne komplizierten Plan gekommen sind. Ohne die altbekannten Dokumente, die Karten und theoretischen Berechnungen. Sie sind einfach gekommen und haben die Fischer gefragt.“
„Ja, das habe ich.“ Dubois fuhr sich durch die zerzausten Haare. „Sie haben gesagt, dass die Fische in den Ruinen leben. Sie haben gesagt, ich soll den Fischen folgen.“
Der Inder lächelte wieder. „Sehen Sie,“ sagte er, „aus genau diesem Grund halte ich Sie für geeignet, mich auf einer Expedition zu begleiten.“
Er machte eine längere Pause und sah auf das Meer hinaus.
„Mister Dubois“, sagte er dann, „ich will ohne Beteiligung irgendwelcher offizieller Stellen arbeiten und ohne weitere Partner. Aber ich habe bisher niemanden gefunden, der bereit gewesen wäre, sich darauf einzulassen. Auch, weil Verlauf und Ergebnis der Unternehmung, von der ich spreche, völlig ungewiss wären. Sind Sie ein Mann, der so etwas wagen würde?“
Bertrand Dubois nahm den Seesack von seiner Schulter und fischte die Zigarettenpackung heraus.
Sich auf Dinge einzulassen, deren Ausgang nicht abzusehen war, hatte ihm noch nie Probleme bereitet. Oft genug hatte er einfach seine Zelte abgebrochen und sich in Abenteuer gestürzt, ohne zu wissen, wohin der Weg führen würde.
Trotzdem ging ihm das hier irgendwie zu schnell.
„Ich weiß nicht“, sagte er schließlich und blies den Zigarettenrauch in die Luft, „welche Art von Unternehmung Ihnen vorschwebt, Mister Sharma. Aber selbst, wenn ich interessiert wäre… Ich habe nicht die finanziellen Mittel, mich an einem größeren Projekt zu beteiligen.“
Tatsächlich war das Geld, mit dem er hierher nach Indien gekommen war, so gut wie aufgebraucht. Bald würde er zurück nach Paris fliegen und sich um irgendeine Arbeit bemühen müssen.
„Machen Sie sich um die Finanzierung keine Gedanken“, sagte der Mann in der bunten Kurta. „Meine Mittel sind mehr als ausreichend. Es gibt nur eine Bedingung für Ihre Teilnahme an der Expedition. Sie stellen keine Fragen zu meiner Person. Wer ich bin, spielt keine Rolle. Und Sie können sich auch sparen, im Internet nach Informationen über mich zu suchen. Sie werden keine finden.“
Dubois warf den Zigarettenstummel auf den Strand und häufte mit dem Fuß einen kleinen Berg Sand darüber. Hatte er etwas zu verlieren? War das hier irrer, als irgendwelche anderen Sachen, die er schon getan hatte?
Er trat den Sandberg über der Zigarettenkippe platt und als er wieder aufsah, hatte er sich entschieden. Genauso spontan und ohne sich um mögliche Bedenken zu kümmern, wie er dies schon so oft getan hatte.
„Ok, Mister Sharma“, sagte er. „Worum geht es?“
Statt eine Antwort zu geben, zog der fremde Inder eine zerknitterte Karte aus dem braunen Umschlag, den er bei sich hatte.
Sie sah aus, als hätte er sie aus einem Atlas herausgerissen und schon lange mit sich herumgetragen.
„Sie werden wissen, was das ist“, sagte er, führte seine Hand über das Papier und deutete mit dem Finger auf einen winzigen Punkt im Pazifik.
Paris, Ménilmontant
Die Tropfen klatschten laut an die Fenster der kleinen Wohnung im dritten Stock, liefen die Scheiben hinunter und bildeten Pfützen auf dem verbogenen Blech des Fensterbretts, bevor sie, jetzt zu kleinen Sturzbächen angeschwollen, die Hauswand entlang nach unten fielen.
Die Geräusche unterbrachen Bertrand Dubois Konzentration. Er legte die Brille ab und erhob sich vom Schreibtisch, um nach draußen zu sehen.
Sein Blick wurde durch die Wasserschlieren auf den Scheiben behindert und nur verzerrt und unscharf erkannte er die Passanten, die unten auf der Rue du Cambodge mit ihren Regenschirmen kämpften oder im Laufschritt versuchten, einen überdachten Ort zum Unterstellen zu erreichen.
Es war einer der kurzen, aber heftigen Frühlingsregenschauer, die sich schon seit Tagen immer wieder mit Sonnenschein abwechselten und der Stadt auf diese Weise einen etwas durchwachsenen Mai bescherten.
Bertrand Dubois störte das nicht. Er mochte den Geruch des Regens, und er fand, dass, wenn er vorüber war, das frische, helle Grün der Bäume in den Straßen mehr leuchtete, irgendwie reingewaschen vom Staub und Dreck der Metropole, der bald schon wieder alles bedecken würde.
Er wandte sich vom Fenster ab und kehrte an den Schreibtisch zurück, auf dem inmitten mehrerer Stapel aus Büchern und Zeitschriften gerade noch genug Platz geblieben war für den Aschenbecher, die Kaffeetasse und den aufgeschlagenen Wälzer über Südamerika, in dem er gelesen hatte, als er vom Prasseln des Regens unterbrochen worden war.
Im Grunde stellte der alte Schreibtisch, Dubois' Lieblingsplatz, ein verkleinertes Abbild des ganzen Zimmers dar, dessen Einrichtung überwiegend aus Bücherregalen bestand, die praktisch alle Wände des Raumes einnahmen und nur die Fenster freiließen, die er nicht hatte zubauen wollen.
Neben einer ganzen Reihe von ans Herz gewachsenen Romanen und vielen seiner Kinder- und Jugendbücher, von denen er sich nicht trennen wollte und die er deshalb immer wieder, von Wohnung zu Wohnung mitgeschleppt hatte, waren die Regalfächer zum größten Teil mit Sachbüchern vollgestopft. Büchern zu so gut wie allen Mythen und ungelösten Mysterien der Vergangenheit oder der Gegenwart, von denen ihm je etwas zu Ohren gekommen war. Eine Bibliothek von jemandem, der auf der Suche nach Antworten war.
Und dort, wo der Platz in den Regalen nicht mehr ausgereicht hatte, waren die Bücher auf dem Boden davor zu kleinen Türmen gestapelt worden, mehr oder weniger unsortiert und oben von unterschiedlich dicken Staubschichten bedeckt. Bertrand Dubois war weniger an Ordnung interessiert, als am Sammeln von allem Möglichen, das sein Interesse weckte.
Jetzt ließ er sich wieder auf dem knackenden Holzstuhl nieder, setzte die Brille auf und suchte in dem aufgeschlagenen Buch nach der Stelle, an der er die Lektüre abgebrochen hatte.
„Zu Beginn des 19. Jahrhunderts“, las er und vertiefte sich wieder in den Text, „breitete sich in Amerika wie ein Steppenbrand die Revolte der unterdrückten Völker aus[,.]
Seit Francisco Pizarro in den Jahren 1531 bis 1533 das Inka-Reich für Spanien erobert hatte, umfasste das neugegründete spanische Vizekönigreich Peru fast ganz Südamerika. Die ursprünglichen Bewohner lebten seither unter der Knechtschaft der Besatzer, das Land wurde ausgebeutet[,.]
Doch jetzt tobte in Mexiko der Unabhängigkeitskampf und in Südamerika eilten Revolutionsarmeen von Sieg zu Sieg[,.]
Die Spanier gaben eine Provinz nach der anderen verloren und zogen sich nach Lima zurück, der von Pizarro 1535 gegründeten Hauptstadt des Vizekönigreichs Peru und zu jener Zeit eine der reichsten Städte der Welt. Von dort aus wurde das Gold aus den Minen Perus nach Spanien verschickt, ebenso das Silber aus den mexikanischen Bergwerken sowie ein Großteil der Schätze, die man den Inka, Maya und Azteken geraubt hatte[,.]
Im Juni 1821 herrschte Panik in Lima. Von Norden her stürmten die Truppen des südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers Simón Bolivar heran, aus dem Osten kam über die Anden der argentinische General José de San Martin und rückte bis auf 50 Meilen auf Lima vor. Im Westen schließlich bereitete die chilenische Flotte unter dem Kommando des schottischen Admirals Thomas Cochrane eine Seeblockade vor[,.]
Unter diesem Druck beschlossen die weltlichen und kirchlichen Würdenträger sowie die reichen Handelsherren von Lima, ihre wertvollen Schätze in Sicherheit zu bringen. Vor allem die Reichtümer aus den 63 prunkvollen Kirchen der Stadt und insbesondere die Kostbarkeiten, die in der großen Kathedrale aufbewahrt wurden, die meisten davon hergestellt aus dem gestohlenen Inka-Gold[,.]
Der Kirchenschatz wurde in Kisten verpackt und in einem schwer bewaffneten Konvoi auf Ochsenkarren zum 8 Kilo-meter entfernten Hafen von Callao geschafft[,.]
Dort verschanzten sich die dem spanischen König treu ergebenen Truppen unter Marschall José de la Mar, dem Gouverneur von Callao, in der als uneinnehmbar geltenden Festung 'Fortaleza del Real Felipe'[,.]
Kurz darauf, am 9. Juli 1821, flohen auch die Regierung und die geistlichen Würdenträger in die Festungsgebäude der Hafenstadt. Gerade noch rechtzeitig, denn am 12. Juli besetzten San Martins Truppen Lima[,.]
Als die Eingeschlossenen von Callao nach einer Belagerung von über einem Monat befürchteten, durch Aushungern zur Kapitulation gezwungen zu werden, beschloss José de la Serna, der gerade erst zum Vizekönig Perus ernannte ehemalige Kommandant der spanischen Truppen, im Einvernehmen mit dem Klerus, einen großen Teil der Schätze sicherheitshalber außer Landes zu schaffen[,.]
Die wenigen im Hafen von Callao verbliebenen spanischen Schiffe konnten jedoch keinen Ausbruch riskieren, da Admiral Cochranes Flotte die Ausfahrt blockierte[,.]
Dagegen würde er ein englisches Handelsschiff, im Vertrauen auf seine eigenen Landsleute, wahrscheinlich passieren lassen[,.]
So entschieden sich die Spanier für die gerade im Hafen liegende Brigg 'Mary Dear', deren schottischer Kapitän William Thompson an der Küste Handel trieb und das Vertrauen der Spanier genoss[,.]
Für eine hohe Prämie erklärte sich Thompson bereit, die Schätze herauszuschmuggeln und mit ihnen solange auf See zu kreuzen, bis er weitere Instruktionen erhielt oder ein sehnlichst erwartetes Entsatzheer die Belagerten befreit hatte[,.]
Anderenfalls sollte Thompson seine Fracht den spanischen Behörden in Panama übergeben, wo die Royalisten noch Stützpunkte besaßen[,.]
Und so wurden in einer Nacht- und Nebelaktion viele schwere Schatzkisten auf die 'Mary Dear' verladen, von denen die meisten den Kirchenschatz von Lima enthielten[,.]
Zeitgenössische Bericht erwähnen Kisten mit 9000 Gold- und Silbermünzen, acht Truhen mit über 8000 geschliffenen und ungeschliffenen Edelsteinen, ferner Gold- und Silberbarren in großer Zahl und etliche Kunstschätze. Das weitaus wertvollste Stück darunter, stammte aus der Kathedrale von Lima: Eine zwei Meter große Statue der Muttergottes mit dem Jesuskind, aus purem Gold, 390 Kilo schwer und verziert mit 1684 Edelsteinen. Den Gesamtwert der an Bord gebrachten Schätze taxiert man heute auf mindestens 200 Millionen Dollar[,.]
Zur Bewachung der kostbaren Fracht akzeptierte Kapitän Thompson vier schwerbewaffnete spanische Soldaten und zwei Priester, die zur Schiffsmannschaft stießen[,.]
Am 20. August 1821, um 4.30 Uhr morgens lief die 'Mary Dear' aus und segelte unbehelligt an den Blockadeschiffen vorbei aufs offene Meer hinaus.“
Dubois sah auf und dachte nach, während er unter den Papieren auf dem Schreibtisch nach der ausgedruckten Kopie eines bestimmten Dokuments suchte.
Was nach der Abfahrt aus Callao auf der 'Mary Dear' geschehen war, dachte er, war nicht ganz klar.
Den verfügbaren Quellen zufolge kam es wohl zu einer Meuterei, nachdem die Mannschaft des Schiffes erfahren hatte, aus was ihre Ladung bestand, eine Information, die Kapitän Thompson den Männern vorenthalten hatte.
Die Anwesenheit der spanischen Eskorte war zwar schon von Anfang an Anlass für wilde Spekulationen gewesen, doch am Ende hatte erst Thompsons Maat die ganze Wahrheit herausgefunden. Über diesen Maat war wenig bekannt, nicht einmal sein Name hatte sich in der Überlieferung erhalten. Er stammte offenbar aus dem schottischen Edinburgh, wo er ein Medizinstudium abgebrochen hatte, um zur See zu fahren und hatte schließlich in Bristol auf der 'Mary Dear' angeheuert.
Nach seiner Entdeckung hatte er nicht gezögert, die Mannschaft über die Schatzladung aufzuklären, mit der sie hier ahnungslos im Pazifik herumfuhren und sie zur Meuterei anzustacheln.
Mit dem schottischen Maat als Anführer waren schließlich die sechs Spanier umgebracht und über Bord geworfen worden und Kapitän Thompson hatte man vor die Wahl gestellt, ebenfalls zu sterben oder sich den Meuterern anzuschließen.
Den Überlieferungen nach hatte Thompson sich für die zweite Möglichkeit entschieden und als es dann um die Frage gegangen war, wohin man den Schatz zunächst einmal schaffen sollte, war offenbar er es gewesen, der vorgeschlagen hatte, die Isla del Coco anzulaufen, eine 532 Kilometer vor der Pazifikküste Costa Ricas gelegene, unbewohnte Insel, die Thompson gut zu kennen schien.
Und so war die 'Mary Dear' nach einigen Tagen dort, an der Nordostküste, vor Anker gegangen.
Elf Bootsfahrten waren dann angeblich nötig gewesen, um die Schatzkisten anzulanden.
Dubois unterbrach seine Gedankengänge, als er den gesuchten Ausdruck gefunden hatte, ein altes Schatzdokument, dessen Original sich im Museum von Carácas befand und welches Einzelheiten über die damalige Aktion auf der Kokosinsel enthielt. Er strich das Papier glatt und begann zu lesen.
„Wir haben vier Fuß tief in roter Erde vergraben:
- 1 Kiste mit goldbestickten Altardecken, Hostiengefäßen, Monstranzen und Kelchen, insgesamt 1244 Stücke
- 1 Kiste mit zwei goldenen Reliquienschreinen, 120 Pfund schwer, mit 624 Topasen, Karneolen und Smaragden, 12 Diamanten
- 1 Kiste mit drei Reliquienschreinen aus Silberguß, 160 Pfund schwer, mit 860 Rubinen und anderen Edelsteinen, 19 Diamanten
- 1 Kiste mit 4000 spanischen Dublonen, 5000 mexikanischen Kronen, 124 Schwertern, 64 Dolchen, 120 Schultergürteln, 28 Rondaches
- 1 Kiste mit acht versilberten Zedernholzschatullen, darin 3840 geschliffene Edelsteine, Ringe und Armbänder und 4265 ungeschliffene Edelsteine
28 Fuß östlich davon liegen 10 Fuß tief im Sand:
- 7 Kisten mit 22 Kandelabern aus Gold und Silber, 250 Pfund schwer, und 164 Rubine
12 Armlängen weiter östlich liegen 10 Fuß tief in roter Erde:
- Die zwei Meter hohe und 780 Pfund schwere goldene Statue der Jungfrau Maria mit dem Jesuskind mit seiner Krone und seinem Brustkreuz, eingehüllt in ein goldenes Messgewand, mit 1684 Edelsteinen, davon 3 Smaragde von vier Zoll Länge im Brustkreuz und 6 Topase von 6 Zoll Länge auf der Krone, sowie 7 Kreuze mit Diamanten“
Bertrand Dubois griff nach den Zigaretten und lehnte sich zurück.
Er sah diese Auflistung nicht zum ersten Mal und doch wurde ihm bei ihrer Lektüre auch jetzt wieder heiß. Das hier war immer wieder aufs Neue nahezu unglaublich. Und soweit er wusste, lag dieses ganze Zeug, oder zumindest der größte Teil davon, immer noch dort, wo es einst versteckt worden war.
Sicher, es war kaum zu entscheiden, ob die Angaben in dem Dokument den Tatsachen entsprachen. Und falls sie dies taten, ob sie vollständig waren. Die Gold- und Silberbarren zum Beispiel, die in anderen Berichten erwähnt wurden, kamen hier gar nicht vor.
Die Geschichten um den sagenhaften 'Kirchenschatz von Lima' hatten ihn schon früher beschäftigt, natürlich, und er glaubte auch, dass es ihn gab, aber er war nie ernsthaft auf die Idee gekommen, auf die Suche danach zu gehen. Zumal die Kokosinsel 1978 zum Nationalpark erklärt worden war, in welchem seitdem keinerlei Schatzsuche mehr stattfinden durfte.
Das war immer eine Sache gewesen, die ihm zu groß erschienen war.
Bis der geheimnisvolle Inder am Strand von Mahabalipuram auf die Karte gedeutet und die Finanzierung einer Expedition zur Isla del Coco in Aussicht gestellt hatte. Und darüber hinaus auch die Finanzierung seiner Wohnung hier in Paris während der Zeit, die die Unternehmung in Anspruch nehmen würde. Ein Umstand, der nicht unerheblich zu Dubois' Zustimmung beigetragen hatte, denn all das könnte ihm vorerst wieder einmal ersparen, sich ernsthaft um seine desaströse finanzielle Situation kümmern zu müssen.
Je mehr Zeit verging, desto stärker wuchs in Dubois allerdings der Verdacht, dass er einfach auf den Arm genommen worden war und nie wieder etwas von dem Mann hören würde.
Andererseits aber schien dieser Mahindra Sharma genau gewusst zu haben, wovon er sprach. Und es schien einen bestimmten Grund zu geben, der ihn so zuversichtlich an den Erfolg seines Vorhabens glauben ließ. Auch wenn er diesen Grund bisher verschwiegen hatte.
Drei Wochen lag ihr Gespräch am Strand und dessen Fortsetzung in einem Café in Mahabalipuram nun zurück. Er war nach Paris zurückgeflogen, mit der Zusicherung des Inders, sich zu melden, doch bis jetzt war nichts geschehen.
Ein Sonnenstrahl fiel durchs Fenster auf den Schreibtisch, und im wabernden Zigarettenrauch sah Dubois den Staub über den Bücherstapeln tanzen. Der Regenschauer war vorüber. Er würde nach draußen gehen und ein wenig herumlaufen. Das war immer eine gute Idee, wenn einem der Kopf qualmte.
Er trat auf die schmale Rue du Cambodge hinaus und überlegte kurz, ob er sich in Richtung Cimetière du Père-Lachaise wenden sollte, des größten und wahrscheinlich schönsten Friedhofs von Paris, der nur zwei, drei Straßen entfernt lag. Die Liste der berühmten Persönlichkeiten, die dort ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten, war lang. So lang, dass er fast jedes Mal, wenn er den parkähnlichen Friedhof besuchte, neue bekannte Namen entdeckte, die ihm bis dahin entgangen waren.
Und er war schon oft dort gewesen, war herumspaziert zwischen den schönen, verwitterten Mausoleen und den alten Bäumen, die manchmal den Blick freigaben auf die Stadt unten am Fuße des Hügels von Ménilmontant.
Doch heute entschied er sich für den Weg die Rue des Pyrénnées hinauf, bis diese sich mit einer seiner Lieblingsstraßen hier im Viertel kreuzte.
Wie eine enge Schlucht im Felsgestein der Häuser an ihren Seiten verlief die Rue de Ménilmontant hinab zur Innenstadt und Dubois mochte die Aussicht, die man von hier aus hatte. Auf das alte Quartier von Beaubourg, aus dessen Mitte sich wie eine Raffinerie das Monstrum des Centre Pompidou erhob und nicht weit davon entfernt, als Gegenpol zu den Auswüchsen der Moderne, die spätgotische Tour Saint-Jacques aus dem 16. Jahrhundert, ein übriggebliebener Glockenturm der ehemaligen Kirche Saint-Jacques-la-Boucherie.
An manchen Ecken, dort wo die Stadtsanierung den einstigen Charakter und Charme Ménilmontants noch nicht zerstört hatte, erinnerte das Viertel hier im 20sten Arrondissement, dem Pariser Osten, ein wenig an Montmartre. Hier und da führten schmale Gässchen den Hügel hinauf, verbanden Treppen zwischen den Häusern die Straßen, fast so wie auf den alten Fotografien, die er gesehen hatte oder wie in den Liedern von Edith Piaf, die in den 1930er Jahren das Flair dieses Viertels besungen hatte. In der Hausnummer 72 der Rue de Belleville, nur wenige Gehminuten entfernt, war sie zur Welt gekommen, war hier aufgewachsen und schließlich, berühmt geworden als der 'Spatz von Paris', wieder hierher zurückgekehrt, um zu bleiben. Auf Père-Lachaise, im Schatten der alten Bäume.
Während er noch ein Stück die Rue des Pyrénnées entlangwanderte und dann nach links einbog, um über kleine Seitenstraßen zum Parc de Belleville zu gelangen, fragte sich Dubois, wo seine Reise wohl einmal enden mochte und ob sich jemand an ihn erinnern würde, wenn er zum letzten Mal seine Zelte abgebrochen und das alte Leben hinter sich gelassen hatte. Endgültig dann und vielleicht doch nur auf dem Weg zu einem anderen Ort, viel zu weit weg, um ihn jetzt schon zu sehen.
Er dachte an Sandrine. Sandrine, die er nie vergessen hatte und für die er irgendwie noch immer dieselbe Liebe empfand, wie an dem Tag, als sie gegangen war. Wo mochte sie sein? Dachte sie manchmal auch noch an ihn?
Es gab ein Gefühl in ihm, das er nicht beschreiben konnte, eine besondere Art von Wissen, dass sie am Leben war. Denn hätte sie die Welt verlassen, dann wäre in seiner Seele eine Veränderung vor sich gegangen. Er hätte es gespürt. Vielleicht so, wie wenn die Luft in großen Höhen an Sauerstoff verlor und einem das Atmen schwerer fiel.
Einmal, vor vielleicht zwanzig Jahren, war er nach Neuseeland geflogen, hatte das Städtchen in der Nähe von Auckland aufgesucht, wo sie zuletzt gewohnt hatte und versucht, eine Spur von ihr zu finden. Doch ohne Erfolg. Es war, als wäre sie nie dort gewesen. Kein Nachbar, keine Behörde hatte ihm irgendetwas über sie sagen können.
Die Erinnerung daran ließ den Schmerz wieder aufleben und als er den Park erreichte, zu dem er unterwegs gewesen war, bemühte er sich, die Gedanken an Sandrine abzubrechen, bevor es zu schlimm wurde.
Der Parc de Belleville war nicht so groß und schön und auch nicht so bekannt wie der Parc des Buttes Chaumont weiter oben im Norden des Arrondissements, doch er bot eine wunderbare Aussicht über Paris, wie man sie aus dem Osten der Stadt besser kaum haben konnte.
Dubois sah das Meer der hellen, graublauen Dächer aus Schiefer und Zink, die dem Licht über der Seinemetropole seine vielgepriesene Einzigartigkeit verliehen und ein altbekanntes Gefühl von Verlorenheit stieg in ihm auf.
Auch die neue Schatzsuche, auf die sich einzulassen er im Begriff war, war nichts anderes, als ein weiterer Fluchtversuch. Einer, der genauso scheitern würde, wie alle anderen zuvor. Er wusste das, auch wenn er sich noch so sehr etwas anderes wünschen mochte.
Man konnte in keine Freiheit von sich selbst fliehen.
Es war mild in der Maisonne und so wollte er noch eine Weile einfach hier stehen bleiben, bis die Gedanken sich vielleicht vorübergehend in dem leichten Wind verloren, der von der Stadt her wehte.
Doch bevor dies geschehen konnte, begann hinter ihm jemand zu sprechen und die Zigarette, die er sich gerade hatte anzünden wollen, fiel ihm aus der Hand.
„Eine schöne Stadt, Ihr Paris“, hörte er eine Männerstimme sagen, die ihm irgendwie bekannt vorkam, und als die Schrecksekunde vorüber war, wusste Dubois, wo er sie schon einmal gehört hatte.
Er fuhr herum und starrte den Mann aus Mahabalipuram an, der schon seit einiger Zeit in seinem Rücken herumgeschlichen sein musste, ohne dass er es, verdammt nochmal, gemerkt hatte.
Dubois öffnete den Mund, doch in der Mischung aus Überraschung und Ärger, die sich in ihm breitmachte, fand er zunächst keine Worte.
Mahendra Sharma, diesmal nicht in der Kurta, sondern in einem hellgrauen Anzug, lächelte ihn an.
„Entschuldigen Sie, Mister Dubois“, sagte er. „Es war nicht meine Absicht, Sie zu erschrecken.“
„Ach was?“, erwiderte Dubois, der seine Stimme wiedergefunden hatte. „Wenn das nicht Ihre Absicht war, dann sind Sie das aber verdammt falsch angegangen.“ Er fummelte eine neue Zigarette aus der Packung. „Wie lange rennen Sie denn hier in Paris schon heimlich hinter mir her?“
„Zugegeben, ich habe Sie ein wenig beobachtet.“ Der Inder lächelte wieder. „Aber nicht sehr lange. Ein paar Tage. Sie müssen verstehen…Es ist wichtig für mich zu wissen, ob ich mich auf Sie verlassen kann. Auf Ihre Verschwiegenheit.“
„Ich muss gar nichts verstehen“, erwiderte Dubois und blies genervt eine Wolke Rauch aus. „Wer sagt mir denn, dass ich mich auf Sie verlassen kann? Dass Sie nicht eines Tages wieder wie aus dem Boden gewachsen hinter mir stehen und sagen, Sie hätten mich schon seit einiger Zeit beobachtet. Bevor Sie mich abstechen?“
„Mister Dubois“, sagte Mahendra Sharma. „Bitte versuchen Sie, sich zu beruhigen. Ich dachte lediglich, statt eines Telefonats wäre es besser, Sie persönlich aufzusuchen. Wie gesagt, in keinerlei schlechter Absicht.“
„Es fällt mir schwer, das zu glauben.“ Dubois warf die Zigarette weg und musterte sein Gegenüber.
„Ok“, sagte er schließlich, „was ist also Ihre Absicht? Was wollen Sie von mir?“
Mahendra Sharma ließ seinen Blick für einen Moment über die Dächer von Paris wandern, bevor er antwortete.
„Ich bin gekommen, um Sie abzuholen“, sagte er dann. „Wenn Sie bereit sind, kann unser Unternehmen beginnen. Mein Flugzeug steht auf Le Bourget. Dort werden wir morgen starten.“
„Ich frage nicht, was Sie mit 'Mein Flugzeug' meinen“, sagte Dubois, obwohl er liebend gerne gewusst hätte, was sich hinter diesem Typen hier noch so alles verbarg.
„Gut“, erwiderte Sharma. „Dann kommen Sie.“
Eigg, Sound of Arisaig
Der rote Kleinwagen verließ Glasgow im Nordwesten der Stadt, dort wo die A 82 jenseits der letzten Vororte hinauf in die West Highlands führte.
Gut zweieinhalb Stunden würde er brauchen bis Fort William und dann, auf der A 830 nochmal etwa eine Stunde bis zur Küste.
Er war am späten Nachmittag losgefahren, denn er wollte sein Ziel in der Dunkelheit erreichen, möglichst unbeobachtet von irgendwelchen Einheimischen. Obwohl auch das gewisse Risiken barg, doch man würde sehen.
Der Mann am Steuer schaltete die Scheibenwischer ein, weil ein plötzlich einsetzender Regenschauer ihm die Sicht nahm. Den ganzen Tag schon war das Wetter wechselhaft gewesen, und jetzt zogen Wolkenfetzen über die raue Gebirgslandschaft, vorangetrieben von einem kräftigen Wind aus Westen, der manchmal auch den Wagen erfasste und ihn unbeabsichtigte Schlenker auf der Fahrbahn machen ließ.
Die schnelltreibenden Wolken, die die kurzen Schauer brachten wurden immer wieder abgelöst von größeren Bereichen blassblauen Himmels und dem Schein der tiefstehenden Sonne, deren grelle Reflexionen auf der nassen Straße in den Augen schmerzten.
Er hatte das wilde Wetter und die wilde Landschaft Schottlands immer gemocht, weil ihn all das an seine Heimat erinnerte, doch heute hatte der Mann in dem kleinen Wagen keinen Blick für die Naturschönheiten der Highlands.
Der Wind würde ein Problem sein. Wenn er sich bis zum Abend nicht gelegt hatte, konnte dies das ganze Vorhaben gefährden.
Benjamin Boag sah auf die Uhr am Armaturenbrett. Noch war Zeit, dachte er und sah nach rechts hinüber zur aufgewühlten Wasserfläche des Loch Lomond, an dessen Ufer entlang die Autobahn hier weiter nach Norden führte. Der Regenschauer war vorüber und Boag beschleunigte wieder. Er hatte noch einiges an Strecke vor sich und er hoffte, dass ihn nicht irgendwo unterwegs der Mut verlassen würde.
2014, vor ziemlich genau vier Jahren war er aus St. John's in Neufundland weggegangen, hierher nach Glasgow, wo er gehofft hatte, den schmerzhaften Erinnerungen an die alte Heimat entfliehen zu können.
Völlig unerwartet und plötzlich war 2013 seine Frau einem schweren Schlaganfall erlegen, ohne dass zuvor irgendetwas auf das Blutgerinnsel hingedeutet hätte, das sich still und heimlich in ihrem Kopf gebildet hatte und sie eines Abends neben ihm auf der Couch tot hatte zusammensinken lassen.
Danach war nichts mehr gewesen wie zuvor und nichts würde auch jemals wieder so sein.
Wenn er nicht gearbeitet hatte, war er ziellos durch die Straßen von St. John's gelaufen, unfähig, an irgendetwas anderes zu denken, als an die Zeit mit Amy, an ihre Liebe und ihre Freundschaft, die sie so lange mit ihm geteilt hatte und an den Moment, in dem all das zusammen mit ihr gegangen war.
Monatelang hatte er darauf gewartet, dass der Schmerz ihn umbringen würde, denn er war überzeugt davon gewesen, kein Leben könne noch lange andauern, wenn alles innen und außen so sehr weh tat.
Oft war er hinunter zum Hafen gelaufen, weil der Wind und der Geruch des Meeres zu den wenigen Dingen gehörten, die er noch wahrnahm, und dort, ungefähr zehn Monate nach Amys Tod, war ihm eine andere Frau in die Arme gelaufen. Buchstäblich.
In ihrem nassen Ölzeug war sie von der Bordkante einer der vielen Fischkutter gesprungen, auf dem glatten Pflaster ausgerutscht und ihm, beim Versuch, das Gleichgewicht wiederzufinden, entgegengefallen.
Als er sie aufgefangen hatte, war es ihm vorgekommen, als fühle er mit den Händen den Körper eines jungen Mannes und auch ihre Bewegungen waren irgendwie eher maskulin gewesen als weiblich. Doch als sie schließlich die schmutzige Kapuze vom Kopf gezogen hatte, war langes, strohblondes Haar auf ihre Schultern gefallen und er hatte in das schöne Gesicht geblickt, das ihm von diesem Moment an nicht mehr aus dem Sinn gehen sollte.
Ihr Name war Keira, das hatte er während des kurzen Gespräches erfahren, das zwischen ihren wiederholten Entschuldigungen entstanden war und mit den wenigen Worten hatte sie sich in seine Gedanken geschlichen und war dort geblieben.
Schon bald nachdem sie wieder auf den Kutter geklettert war und er sich auf den Heimweg gemacht hatte, war ihm klargeworden, dass es falsch war. Es war nicht richtig, andere Frauen im Kopf zu haben, so kurz nach Amys Tod. Aber er hatte auch schon gewusst, dass er Keira nicht würde vergessen können. Zu stark war der Eindruck gewesen, den sie in wenigen Minuten bei ihm hinterlassen hatte. Zu tief. Fast schon unnatürlich tief, ohne dass er hätte sagen können, was genau es gewesen war, das ihn so berührt hatte.
In den folgenden Wochen war Amy von Keira nicht aus seinen Gedanken verdrängt worden, das würde nie geschehen, aber die Sehnsucht nach der Frau vom Hafen hatte fast so viel Platz eingenommen, wie die Erinnerung und die Trauer in ihm, wenn er an Amy dachte.
Gequält von einem schlechten Gewissen war er nun beinahe täglich am Hafen unterwegs gewesen, hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung, Keira einfach nicht mehr anzutreffen und dem verzweifelten Wunsch, sie wiederzusehen.
Und er hatte sie wiedergesehen. Drei oder vier Mal hatte sie ihm von ihrem Kutter aus zugewunken und einmal waren sie sich auf dem Hafengelände über den Weg gelaufen. Sie hatte gefragt, wie es ihm gehe und er hatte nicht gewusst, was er sagen sollte. Tatsächlich war ihm gar nicht in Erinnerung geblieben, was er geantwortet hatte. Er wusste nur noch, dass er nicht anders gekonnt hatte, als ihr noch lange nachzusehen, nachdem sie weitergegangen war. So lange, bis sie irgendwo zwischen den Häusern der Stadt verschwunden war. Als ob er keinen Augenblick, keine Gelegenheit verpassen wolle, sie noch zu sehen.
Doch mit jeder Woche, die vergangen war, hatte er mehr gespürt, dass er es nicht konnte. Schon zerrissen und fast zerbrochen vom Verlust seiner Frau, hatte er keine Kraft mehr gehabt, das Gefühlschaos auszuhalten, welches Keira in ihm ausgelöst hatte. Ein fremdes Wesen, das doch sicher überhaupt kein weiteres Interesse an ihm hatte und ihn dennoch gefangen hielt.
Und so hatte er nach zwei Monaten entschieden, zu fliehen.
Natürlich war ihm bewusst gewesen, dass dies eine Verzweiflungstat war, aber er hatte keinen anderen Ausweg gesehen, keine andere Rettung.
Ohne irgendwelche Fristen oder andere Formalitäten einzuhalten und auch ohne Erklärungen gegenüber irgendjemandem, hatte er seinen Job und den Mietvertrag für seine Wohnung gekündigt und war gegangen. Weg aus St. John's, weg aus Neufundland und von allem, was hier mit seinem alten Leben zusammenhing.
Im Grunde konnte er gar nicht sagen, warum er schließlich in Schottland gelandet war. Es hatte sich so ergeben und es war ihm auch egal gewesen.
Er war der Erste in der langen Reihe seiner Vorfahren, der nicht die Seefahrertradition der Familie fortgesetzt hatte, sondern stattdessen Zimmermann geworden war, ein Umstand übrigens, über den die Enttäuschung zu verbergen seinem Vater, der als Kapitän auf verschiedenen Kreuzfahrtschiffen die Weltmeere befahren hatte, heute noch schwer fiel. Abgesehen von dem fehlenden Verständnis für sein klammheimliches Verschwinden. Aber natürlich konnte niemand das verstehen, wenn er, Benjamin Boag, nicht darüber sprach. Und er konnte nicht darüber sprechen, immer noch nicht.
Doch zumindest hatte er hier in Glasgow, wo es ihm gelungen war, eine Anstellung in einer größeren, örtlichen Schreinerei zu finden, in den letzten Jahren etwas Abstand von allem gewinnen können.
Oder vielleicht sollte er besser sagen, es war ihm gelungen, mit den endlos schmerzenden Erinnerungen an seine Frau Amy und an Keira und dem Leben fern der Heimat einen zerbrechlichen Frieden zu schließen, der ihn seine Tage in einer Art tauber Ruhe verbringen ließ. Wozu in nicht unerheblichem Maße der schottische Whisky beitrug. Es hatte keinen Sinn, sich etwas anderes einzureden.
Dann, vor einigen Wochen war dies gewesen, hatte er durch ein Gespräch von Thekennachbarn in seiner Stammkneipe von dem Mann auf der Insel erfahren.
Irgendwann hatte sich der Tratsch um die Bewohner von Eigg gedreht, einer Insel 10 Kilometer vor der Westküste Schottlands, im Sound of Arisaig.
Mit ihren kaum mehr als 30 Quadratkilometern gehörte sie zu den sogenannten 'Kleinen Inseln' der schottischen Inneren Hebriden und seit die Einwohner das Eiland, ihre abgeschiedene Heimat im Atlantik, 1997 gekauft hatten, rankten sich die Erzählungen der Festlandbewohner immer wieder gerne um das Leben auf Eigg, teilweise geprägt von Sehnsucht, teilweise von Neid oder durchsetzt mit mysteriösen Gerüchten.
Und an diesem Abend war es vor allem um einen bestimmten der heute rund 100 Inselbewohner gegangen, der sich damals zwar am Kauf von Eigg beteiligt hatte, ansonsten aber völlig zurückgezogen in einem einzelnen Haus nahe der Küste lebte, welches er so gut wie nie verließ.
Benjamin Boag interessierte sich normalerweise nicht besonders für das, was rechts und links von ihm am Tresen gesprochen wurde und er beteiligte sich auch so gut wie nie an den Unterhaltungen.
Wenn er hierher kam, wollte er trinken, bis er das Gefühl hatte, wieder zurechtzukommen und dann nach Hause gehen. Weiter nichts.
Doch diesmal hatten der Name des Mannes, die wirren Gerüchte über seine Vergangenheit und die Tatsache, dass er, zumindest seit er hier aufgetaucht war, finanziell völlig unabhängig zu sein schien, ihn aufhorchen lassen.
Und weil er nicht glauben konnte, dass es sich bei all dem um Zufall handelte, hatte er in den letzten Wochen weitere Erkundigungen eingezogen, war sogar einmal mit einer der Fähren, die viermal in der Woche zwischen Eigg und dem Festland verkehrten, auf die Insel gefahren, um sich die Lage des Hauses anzusehen und schließlich hatte sich der Verdacht, der in ihm gewachsen war, zu einer Art Gewissheit verdichtet.
Deshalb hatte er sich jetzt entschieden, den Mann aufzusuchen, ohne Vorankündigung und unauffällig im Schutze der Nacht. Möglicherweise gab es Schulden aus lange vergangenen Zeiten zu begleichen und wenn diese Vermutung zutraf, hatte er vor, dem Fremden etwas wegzunehmen.
Er erreichte Fort William in der Abenddämmerung und hielt kurz an einer Tankstelle, um Benzin nachzufüllen und sich etwas zu trinken zu besorgen. Wenn er am Sound of Arisaig ankam, würde es dunkel sein und tatsächlich ließ jetzt, gegen Tagesende, auch der Wind langsam nach.
Benjamin Boag betrachtete dies als gutes Omen, als er auf die A 830 auffuhr, die nach Westen führte zur zerfurchten Schärenküste und den kleinen Fischerörtchen am Meer.
Außer ihm waren nicht viele Fahrzeuge unterwegs und so konnte er den Wagen in konstantem, gemächlichem Tempo dahinrollen lassen, ohne groß auf den Verkehr achten zu müssen. Die Landschaft um ihn herum verschwand langsam in der Dunkelheit, er hörte das Summen der Reifen auf dem Asphalt, sah die Fahrbahn im Licht der Scheinwerfer, wie sie vor ihm auftauchte und gleich wieder unter dem Auto und irgendwo hinter ihm verschwand.
Wieder schweiften seine Gedanken ab.
Es war nicht seine Rechnung, die er hier im Begriff war, zu begleichen. Es war diejenige eines weit entfernten Vorfahren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, so weit entfernt, dass man diese Vergangenheit auch gut einfach hätte ruhen lassen können.
Und auch jetzt, wie schon in den vergangenen Wochen immer wieder, kamen Benjamin Boag Zweifel.
Er kurbelte das Wagenfenster herunter, um frische Luft hereinzulassen und für einen Moment meinte er, das Meer schon riechen zu können.
Warum ließ er sich auf diese Sache hier ein? Warum blieb er nicht einfach in Glasgow, in der Gleichförmigkeit seiner Tage, bei dem Whisky und dem bisschen Ruhe, in dem er sich halbwegs und mühsam eingerichtet hatte?
Vielleicht, weil er gerade aus dieser Eintönigkeit ausbrechen wollte, dachte er. Vielleicht auch aus irgendeinem absurden Gefühl von Verantwortung für die Familienehre oder so, etwas, das ihm jedoch normalerweise völlig fremd war. Er fand keine überzeugende Antwort und versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken.
Wer wusste schon immer genau, warum er sich in bestimmten Situationen auf diese oder jene Weise verhielt?
Es war an einem der vielen nebligen Tage in St. John's gewesen, als sein Großvater ihn mit hinunter zum Hafen genommen hatte, so wie er dies zu jener Zeit öfter tat, um seinem Enkel, er mochte damals 13 Jahre alt gewesen sein, von den Schiffen und vom Meer zu erzählen.
Doch an diesem Tag und nur dieses eine Mal hatte ihm der Großvater die Geschichte von Kapitän William Boag und seinem Sohn Billy erzählt und von der Insel, zu der sie 1841 von hier aus mit der 'Edgecombe' aufgebrochen waren.
„Dort“, hatte er gesagt und zur im Nebel liegenden Hafenausfahrt zwischen Signal Hill und dem gegenüberliegenden Felsen gedeutet, wo die Schiffe auch heute noch ausliefen in die St.John's Bay und den Atlantik, „dort sind sie hinausgefahren auf dem Weg in ein großes Abenteuer, weit weg von hier, in einem anderen Ozean.“
Benjamin Boag hatte diese Geschichte fast vergessen gehabt, doch durch das kürzlich mitgehörte Gespräch in der Kneipe war die Erinnerung wieder zum Leben erwacht. Und er war erstaunt gewesen, wie viele Einzelheiten in seinem Gedächtnis die Zeit überdauert hatten.
Vor ihm tauchten jetzt Schilder auf, die auf die Abzweigung nach Bunacaimbe hinwiesen und er lenkte den Wagen nach links auf die schmalere Straße, der er nur noch ein kurzes Stück folgen musste, um sein Ziel zu erreichen.
Bunacaimbe war ein Nest am Meer und bestand im Wesentlichen aus einer Handvoll Häusern, einer Kirche, einem Hotel, einem Shop und einem Restaurant. Abgelegen und ruhig. Wie gemacht für sein Vorhaben. Hier hatte er vor ein paar Tagen ein ausgemustertes Lobster Boat gemietet, einst genutzt von Hummerfischern und jetzt ideal, um es an Touristen mit Bootsführerschein auszuleihen, die ein bisschen an der Küste auf und ab schippern wollten.
Benjamin Boag stellte den Wagen ab, stieg aus und blickte hinaus auf die weite Wasserfläche des Atlantik, wo sich vor dem noch etwas helleren Himmel im Westen die Silhouette der Insel Eigg abhob.
Kaum noch Wind, dachte er und hoffte, dass ihm die Überfahrt wie geplant gelingen würde.
Niemand beachtete das Holzboot mit der kleinen, offenen Führerkabine, das in der Dunkelheit langsam und vorsichtig durch die Felsen vor der Küste manövrierte, um dann auf dem offenen Meer an Fahrt aufzunehmen.
Benjamin Boag orientierte sich an den Leuchtbojen, die rechts von ihm die Fahrrinne der Fähren aus Mallaig markierten, was aber eigentlich gar nicht nötig gewesen wären, denn nach wie vor konnte er die Umrisse der Insel deutlich vor sich sehen.
Das Meer war ruhig, es gab nur leichten Wellengang und er konnte mit maximaler Geschwindigkeit fahren. Nicht dass diese bei alten Lobster Booten nennenswert gewesen wäre, doch aufgrund der günstigen Bedingungen erreichte er die Insel schneller, als er gedacht hatte.
Als er in die Kildonan Bay einfuhr, eine einsame Bucht, weitab vom südlicher gelegenen Fährhafen in Galmis-dale, sah er auf seine Armbanduhr. 22.30 Uhr zeigten die fluoreszierenden Zeiger an. Er hatte nur etwas über eine Stunde vom Festland bis hierher gebraucht.
Das Haus, dessen Bewohner er einen Besuch abstatten wollte, lag nicht weit von der Bucht entfernt und er hatte sich den Weg eingeprägt, als er hier gewesen war, um Bestätigung für seine Vermutungen zu finden.
Jetzt zog Benjamin Boag eine kleine Taschenlampe aus der Jackentasche, weil er sich auf dem zerklüfteten Gelände nicht die Beine brechen wollte und begann das Ufer hinaufzusteigen.
Nach vielleicht fünfzehn Minuten, als die Umrisse seines Zieles langsam aus der Dunkelheit auftauchten, knipste er die Lampe aus und begann sich vorsichtiger zu bewegen. Noch wollte er nicht gesehen werden.
Das Cottage aus Naturstein mit dem schiefergedeckten Dach unterschied sich durch nichts Besonderes von anderen, typischen schottischen Häusern dieser Art. Besonders war vielleicht sein Bewohner. Benjamin Boag blieb einen Moment stehen, beobachtete die Fenster, aus denen schwaches, gelbliches Licht hinaus in die Nacht drang und überlegte kurz, ob er einfach wieder umkehren sollte. Doch dann setzte er sich in Bewegung und ging langsam auf die hölzerne Eingangstür zu.
Puntarenas, Golf von Nicoya
Inmitten eines gewaltigen Schleiers aus aufstiebendem Regen hob die Boeing 737-400 kurz vor dem Ende der Rollbahn ab und stieg langsam hinauf in den wolkenverhangenen Himmel.
Das Wetter war umgeschlagen, während sie sich durch das Verkehrschaos in den Norden der Stadt durchgekämpft hatten, Richtung Le Bourget, dem kleinsten der Pariser Flughäfen. Das hieß, durchgekämpft hatte sich der Fahrer der mittelschweren Limousine, in die sie unweit des Parc de Belleville gestiegen waren, ein Inder offenbar, der nach einem kurzen Abstecher zu Dubois' Wohnung ohne weitere Zwischenstopps den Weg zum Flughafen eingeschlagen hatte.
Das hier war kein schnell vorübergehender Schauer, dachte Dubois während er aus dem Kabinenfenster sah. Das sah nach Dauerregen aus.
Eigentlich liebte er die Starts von Großstadtflughäfen, den weiten Blick von oben auf die steinernen Meere aus Gebäuden, die langsam immer kleiner wurden und die man dann hinter sich ließ und bald vergaß, weil sich die Gedanken auf die Orte richteten, zu denen man unterwegs war.
Doch abgesehen davon, dass im Regengrau da draußen