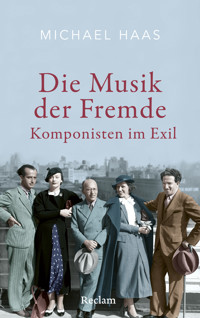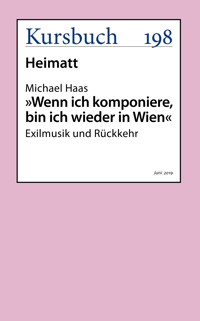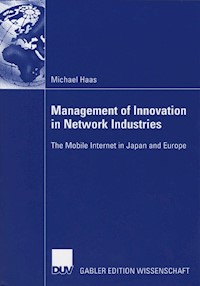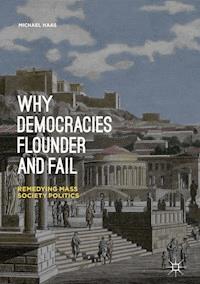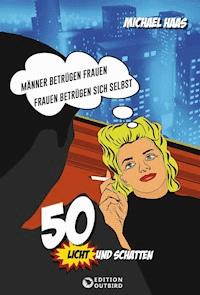Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
100 Kilometer entfernt von Messina, direkt an der sizilianischen Küste, wartet auf Luise und Clemens ein einsam gelegenes Haus. Dort, in der Fremde, wird sich entscheiden, ob es für sie eine Zukunft gibt: Clemens ist krank, ohne Hoffnung auf Heilung, und dennoch entschlossen, Luise glücklich zu machen … Siziliens archaische Landschaft und Städte bilden die Szenerie einer Liebesgeschichte, die in poetischen Bildern an die verletzliche Schönheit des Lebens erinnert. „Wir erreichten das Haus in Capo d’Orlando erst in der Dunkelheit. Die Küste lag unter jener violetten Lasur verborgen, die im Süden die Nacht überlagert und den Dingen ein Leuchten verleiht. Was sich dort inszeniert, ist dem Norden fremd. Der Norden kennt keine Farben, die gegen die Finsternis rebellieren. Ich dachte an Georg Heym. Umbra vitae, das Leben lag abseits, im Schatten, umgeben von Dunkelheit. Leise rumorte die Brandung, die Küste war nah, ich schmeckte die salzige Gischt auf den Lippen. Gläserne Stille umgab unsere Ankunft. Schweigen und Atmen und Müdigkeit. Sizilien hieß uns willkommen.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Haas
Die verletzliche Schönheit des Lebens
Sizilianische Erzählung
Engelsdorfer Verlag Leipzig 2024
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2024) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Umschlaggestaltung unter Verwendung einer Photographie
von Esra Nur Kalay [Pexels]
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
www.engelsdorfer-verlag.de
Meiner geliebten Kleinen Königin Barbara C. L.
Du rettest mich an jedem Tage neu.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
I Sterbliche Götter
II Die Frau in Weiß
Epilog
Prolog
Dieses Buch ist keine Hommage, es ist ein Bekenntnis. Ich spreche hier von Luise, dem Mysterium meines Lebens. Wie die Löwin im goldenen Licht der Savanne schreitet Luise durch meine Tage, hingegeben an ihre Schönheit, die alles verwandelt, was ihre Kreise berührt. Wer sie sieht, sieht, wie das Glück sich erfüllt, von Schönheit getragen, am Leben zu sein.
I Sterbliche Götter
Die Vergänglichkeit schweigt, wenn das Leben poetisch, die Liebe unsterblich wird.
I.
Als Luise mich fand, lebte ich einen seltsamen Traum. Mein Verstand war Rekrut auf dem Exerzierplatz des Zweifels, mein Leben wurde von Argwohn beherrscht. Ohne dass ich es merkte, wurde mir täglich fremder, wer ich früher gewesen war. Ich verfiel der fixen Idee, mir müsse gelingen, was niemand zuvor gelungen war: Unser Bewusstsein zu dechiffrieren, seine Sprache und die Gesetze zu lernen, die unseren Gedanken Worte und unseren Worten Semantik verleihen, war alles, worauf ich mich konzentrieren konnte. Nachts träumte ich Sprache in Bildern, Metaphern und Allegorien, Sprache begann für mich plastisch zu werden.
Mein geistiges Leben wurde ein Kaleidoskop, in dem sich Gedanken zu geometrischen Formen verbanden. Jede Form, die entstand, wurde bereits im Entstehen verändert und neu konfiguriert. Es fühlte sich an, als ginge mein Denken über in einen Plexus aus allen Formen Euklids. Formen wurden zu Sprache, in der sich Erkenntnis und Freiheit bedingten. Freiheit, wie ich sie verstand, war eine Freiheit, die aus der Liebe zur Sprache erwuchs. Über die sprachliche Konkretion von Symbolen hoffte ich, Freiheit im Denken zu finden, dann, dachte ich damals, würde sich alles von selbst erklären.
Heute verstehe ich nichts mehr von dem, was mir damals plausibel erschien, doch glaube ich, dass ich an etwas Verborgenes rührte, etwas, das unserer Sprache Leben und unserem Leben Bedeutung schenkt. Ich besaß, wenn auch nur kurze Zeit, eine Hellsicht, die mir erlaubte, mehr zu erkennen als nur den Schatten unserer Gedanken; langsam, unmerklich, verschwand dann schon bald, was mein Bewusstsein entgrenzt und verzaubert hatte.
Je älter ich wurde, je mehr erblindete meine Intuition, und Hellsicht wurde von Ignoranz verdrängt. Das Alter ist reaktionär, nicht wissbegierig und konziliant. Altersweisheit ist ein Mythos der Alten, erfunden, um ihre Wünsche mit Nachdruck durchzusetzen. Nur ein einziges Mal, im ersten Semester, lernte ich einen Menschen kennen, der, trotz seines biblischen Alters, den Leichtsinn – die Sprache der Jugend beherrschte. Hans-Georg Gadamer liebte es, mit Gedanken zu spielen, er liebte es, unsere Welt als Theater der Metamorphose zu sehen. „Wir verwandeln uns ständig“, erklärte er uns, die wir eben das Studium begannen, „nichts ist, was es scheint, und wer das Spiel auf der Bühne betrachtet, betrachtet immer sich selbst“. Er lächelte wissend und ich sah, was er meinte. Ich verstand ihn zu gut, um ihn nicht zu bewundern. Er warnte mich, ohne es selbst zu bemerken, denn ich dachte, er spräche zu mir von den letzten Dingen.
„Jeder Gewohnheit geht ein Erstaunen voraus, und jedes Wunder endet mit einer Normierung der Folgen“, sagte er sanft, und stellte danach die entscheidenden Fragen, die mich bis heute begleiten: „Was wäre die Welt, wenn wir sie nicht in allen Aspekten bejahten? Was wäre die Welt, die sich in alter Gewissheit verfinge? Was wäre die Welt, wenn wir nicht weiter nach Klarheit, Vollendung und Wahrheit strebten?“ Die Antwort gab ich mir selbst: Ein Ort der Ambivalenz, ein Königreich der Eitelkeiten.
Wer Schopenhauers strahlend erleuchtetes Hotel auf der Klippe der Zeit besucht, weiß, dass unser Wohnsitz des Lebens auf einem erodierenden Felsen ruht. Doch wissen wir wirklich, dass unser Leben ein temporäres Ereignis ist? Wer redet schon ernsthaft über den Tod? Und wenn, wer setzt sich selbst in Bezug zu ihm? Wir werden älter und unser Körper verfällt; er markiert mit Tagen, Wochen und Jahren, was wir sind und was wir werden. Altern ist ein Prozess, der uns das Wesen des Ephemeren lehrt. Indem wir uns selbst in ein flüchtiges Ding verwandeln, erleben wir, was es grundsätzlich heißt, sich aufzulösen. Auch das Denken ist ein Prozess, der sich in flüchtigen Abstraktionen verliert. Wir alle zitieren Bekanntes und finden Gefallen daran.
Wie Bäume, die sich aus Angst vor dem Herbst dem Frühling verweigern, lassen wir keinen Gedanken entstehen, der uns erlaubte, die öde Landschaft der Empirie zu verlassen. Gedankenlos leben zu können, ist eine Tragödie, in der die Opfer das Leiden durch Ignoranz ersetzen. Sie fühlen keinen Verlust, sie werden zu Laub, verwelken und nehmen doch keinen Anstoß daran.
II.
Meine Forschung hatte den festen Bezugsraum der Empirie längst verlassen. Ich glaubte, mich zu befreien, und agitierte mit Vorsatz gegen den eigenen Forschungsbereich, doch was mir wie Freiheit erschien, war nur die Flucht aus den Zwängen der Empirie. Mein Traum, das Rebus der Sprachentstehung zu lösen, war so groß wie die Sehnsucht, der Sprache ein symbolisches Äquivalent zu geben. Ich begann zu erfassen, was es bedeutet, mehr als am Leben zu sein. Jeder Gedanke wurde zu einer phonetischen Spur auf dem Weg zu einer neuen Erfahrung. Niemand, so dachte ich, würde mir folgen, niemand würde versuchen, mein Ziel zu erreichen. Niemand kannte mein Ziel, niemand durfte es kennen. Mein Ziel, selbst Sprache zu werden, hätte in anderen Ohren wie Wahnsinn geklungen. Was ich wollte, bedeutete mehr, als jedem Gedanken ein Wort zu verleihen, was ich wollte, war, wörtlich genommen, mein Leben für die Verwandlung des Körpers in Sprache aufzugeben.
Die Dichter glauben an ein stoffliches Äquivalent ihrer Worte. Sie übersetzen Gefühle in Verse, doch ohne Bewusstsein für das, was entsteht, wenn die Sprache, aus sich, eine eigene Ordnung kreiert. Metaphern und Allegorien sind nur ein Abbild des Abbilds von Sprache. Wir alle reden zu viel, um mehr als ein Raunen der Götter zu hören. Wer sein Schweigen als Sprachraum begreift, wird erstaunt sein, was er vernimmt, wenn die Sprache sich wortlos äußert. Stille ist dort, wo sich Geist und Sprache bedingen, wo aber Sprechen und Denken symbiotisch werden, erwachen Gedanken, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Freiheit des Denkens beginnt immer dort, wo das gesicherte Wissen endet.
Wer den Ozean liebt, sucht nach Entgrenzung, meidet die stillen Gewässer und den Geruch der Lagune. Wer zu denken beginnt, geht nicht in Bibliotheken, um sich mit Büchern und Referenzen abzusichern. Er geht hinaus in die Welt, wie ein Konquistador, weil er den Geist befreien will. Nur in Bewegung entsteht ein lebendiges Denken, das nicht in einer gemauerten Festung des Wissens verbleibt. Denken ist nicht nur auf Logik und Kausalität des Bekannten gegründet. Denken in Freiheit ist immer auch Rebellion und jeder Denker erstaunt, erlebt er das Wunder der Heteronymie. Humanismus jedoch ist keine Revolte, sondern die Antwort der Philosophen auf das Dilemma, als denkendes Wesen in irdischen Zwängen gefangen zu sein.
Die Wissenschaft des letzten und dieses Jahrhunderts ist dem Humanismus erwachsen, doch nur, um als Persiflage dieser Schule dem Nutzen zu dienen. Der Nutzen wurde zu einem Fetisch für viele, die Wissenschaft lehren, ohne die Ambition, Erkenntnisgewinn zu verzeichnen. Sie bleiben bei dem, was sie kennen, und folgen den Traditionen; sie glauben, das müsse genügen, und entscheiden sich früh, dem Methodenzwang ihres Fachs zu gehorchen. Hätten Newton und Einstein sich orthodox verhalten, wir würden Euklid noch immer als ultima ratio der Mathematik verehren.
Die Sehnsucht nach Nutzen hat vieles zerstört, was Wissenschaft war, am meisten das Freiheitsprinzip, die Freude am Wagnis, den Mut und die Fantasie. Wer heute studiert, wird in allem beschult, doch nie unterrichtet. Die Freiheit der Lehre und Forschung wird oft proklamiert, nur selten gelebt und kaum geliebt. Bisweilen kommt es mir vor, als leide die Universität an einem Fatigue-Syndrom. Die Wissenschaft unserer Zeit ist erschöpft, hermetisch und ausgezehrt, doch behauptet dreist, sie wisse, was unser Bewusstsein beherrscht. Diese Arroganz ist mir fremd. Mich umarmt ein
Gedanke und ich beginne zu zittern. Einen Gedanken in sich zu tragen und zu verstehen, ist ein Triumph, der alles bedeuten kann:
Wenn unser Geist zu sehen beginnt, ist alles präsent. Nichts mehr ist nur Erinnerung, nichts mehr Reflex einer fernen Vergangenheit. Wer diesen Zustand erreicht, fühlt, was er denkt, und denkt, was er fühlt. Harmonie verbindet dann jedes Fragment der zerrissenen Welt: Heraklits Formel wird endlich Wirklichkeit. Hen kai pan – Aus Allem Eins und aus Einem Alles.
Als ich das las, war ich noch jung, doch ich wusste sofort, wer diese Sätze verfasste, war dem Leben sehr nah. Er wusste, dass Körper und Zeit sich bedingen. Zeitloses Denken ist kein Prozess, sondern Ausdruck für ein Bewusstsein, das sich von der Bedingtheit des Körpers befreit. Wenn wir die Zeit als Prämisse setzen, verlieren wir alles, was unser Leben in Denken und unser Denken in Leben verwandelt.
Meine Überlegungen von damals klingen heute, aus der Distanz vieler Jahre, in meinen Ohren exaltiert und vermessen, und dennoch weiß ich, dass meine Studien zur Sprache, selbst in den hitzigsten Phasen, immer Abstand zu meinen Psychosen hielten. Meine Krankheit mochte mich als soziale Person bis zur Unkenntlichkeit zerstören, meine Gedankenwelt aber blieb davon unberührt. Ich lebte ein Leben jenseits des Lebens, ich lebte ein Leben, das einer Hypothese sehr nahekam.
III.
Ich hatte bereits ein Alter erlangt, das ich nie in Betracht gezogen hatte. Mein Körper war ruinierter, als es den Anschein erweckte, und ich fühlte mich selten mit ihm verwandt, dafür war ihm zu viel widerfahren. Ich lebte, entgegen jeder validen Prognose, nach einem mir fremden Naturgesetz.
Meine Kindheit und Jugend hatte ich wie ein Voyeur betrachtet. Ich sah auf mich selbst, doch eher bezugslos, befremdet und ohne Bedürfnis, mich mitzuteilen. Mit zehn Jahren erhielt ich die Diagnose, psychotisch zu sein, mit 34 Jahren erkrankte ich noch anatomisch und wurde zu einer neurologischen Kuriosität. Die Diagnose war hässlich, ich sprach sie nie aus, ich blieb indolent. Was mir widerfuhr, berührte mich nicht, ich hatte an meinem Schicksal schon früh das Interesse verloren. Lieblos und kalt waren die Jahre an mir vorübergezogen. Mein Gefühl war erloschen, doch dann kam Luise. Mit ihr erlebte ich meine kopernikanische Wende. Luise wurde zur Sonne und leuchtete dort, wo mein Herz im Schatten dunkler Planeten gelegen hatte. Der Wechsel war absolut, die Abkehr von früher vollständig.
Das Leben entfaltete sich plötzlich vor mir wie eine provenzalische Rose. Luise lehrte mich Glück, sie lehrt es mich noch. Sie ist es, die mich daran erinnert, dass Liebe, ist sie vollkommen, aus Schönheit entsteht. Sie ist mein Zentrum. Sie ist der Tag. Sie ist die Nacht. Sie ist das Leben. Die Sterne. Das Licht. Es gibt keine Zeit, nur Luises Gegenwart. Ihretwegen entschied ich mich, weiter in dieser Welt aus drei Dimensionen und dreitausend Paradoxa auszuharren.
IV.
Das Licht war an diesem Morgen intensiver als sonst und changierte ständig von rot zu orange und von orange zu gelb. Die Sonnenstrahlen tanzten über Luises Gesicht, das luzide wurde. Ihre Augen glänzten blau wie Saphire, um die sich konzentrische Kreise aus Silber legten. Meine Frau, dachte ich glücklich, berauscht von dem Anblick, meine Frau, ist die Antwort auf alles. Luise ist ein Bekenntnis. Zu Liebe, zu Licht, zu Unsterblichkeit.
Diese Augen und dieses Gesicht sind der Sonne verwandt, ihr Leuchten verliert sich nie. Luises Züge sind berückend symmetrisch, attisch und makellos, es gibt keine Fehler der Proportion. Die hohe Stirn wölbt sich in sanft gezirkeltem Schwung, in ihrer vollendeten Glätte erinnert sie mich an polierten Stein. Luises Nase ist majestätisch, breit und markant und löwenhaft. Ihr Mund und die vornehmen Lippen bezeugen, dass auch im Schweigen melodischer Wohllaut herrscht. Luises Lächeln berührt mich mehr als eine Nocturne von Chopin. Alles an ihr, ob verborgen, ob sichtbar, ist Harmonie.
Sobald ich sie sehe, verwandelt sich meine Welt in ein kosmisches Spiel. Ich folge Luise wie ein Planet seiner Sonne, die ihm die Richtung gibt. Luises Schönheit beschenkt mich, doch sie beschämt mich nicht. Ich nehme, was sie mir gibt, dankbar, doch ohne Bescheidenheit. Ich weiß, ich bin der Günstling einer Königin, doch frage mich nie, ob ich dieses Vorrecht verdiene. Privilegien werden geschenkt, nicht verdient.