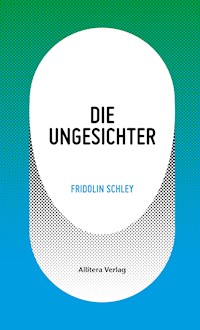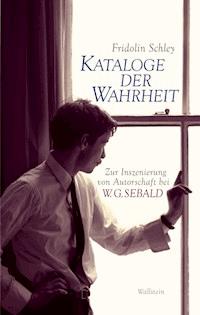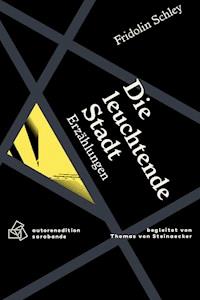Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
"Mit sprachlicher Virtuosität mischt Fridolin Schley Geschichte, Bilder und Quellen zu einem literarischen Sturm aus Fragen." (Lena Gorelik) über Ernst von Weizsäcker und die Nürnberger Prozesse.
1947, die Nürnberger Prozesse: Einer der Angeklagten ist Ernst von Weizsäcker, SS-General und Spitzendiplomat unter Ribbentrop. Zu seinen Verteidigern zählt auch sein Sohn Richard, der vier Jahrzehnte später als Bundespräsident in seiner Rede vom 8. Mai über Kriegsschuld und die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Gräuel sprechen wird. Eine historische Konstellation, die man kaum erfinden könnte: Hier stoßen – verkörpert in Vater und Sohn – das alte, schuldverstrickte Deutschland und die gerade erwachende Bundesrepublik aufeinander. In seinem literarischen Psychogramm tastet sich Fridolin Schley an die historischen Figuren heran und umkreist dabei die großen Fragen nach Gut und Böse, Schuld und Unschuld, emotionaler und moralischer Verpflichtung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
1947, die Nürnberger Prozesse: Einer der Angeklagten ist Ernst von Weizsäcker, SS-General und Spitzendiplomat unter Ribbentrop. Zu seinen Verteidigern zählt auch sein Sohn Richard, der vier Jahrzehnte später als Bundespräsident in seiner Rede vom 8. Mai über Kriegsschuld und die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Gräuel sprechen wird. Eine historische Konstellation, die man kaum erfinden könnte: Hier stoßen — verkörpert in Vater und Sohn — das alte, schuldverstrickte Deutschland und die gerade erwachende Bundesrepublik aufeinander. In seinem literarischen Psychogramm tastet sich Fridolin Schley an die historischen Figuren heran und umkreist dabei die großen Fragen nach Gut und Böse, Schuld und Unschuld, emotionaler und moralischer Verpflichtung.
Fridolin Schley
Die Verteidigung
Roman | Hanser Berlin
1
Die Wahrheit wird euch frei machen. Vielleicht geht ihm plötzlich sein Taufspruch durch den Kopf und stößt etwas an, das daraufhin erwacht, oder er flüstert ihn schon im selben Moment, um den Saal für das Kommende zu beschwören, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ihm muss warm sein, er hat sich beeilt herzukommen, ihm muss kalt sein, es ist Winter, sie haben über Nacht nicht geheizt. Niemand soll es hier gemütlich haben. Indem er seiner eigenen Stimme nachhorcht, tauchen auch andere Geräusche auf aus der Stille, steigt ein Lautgesumm ganz langsam an und bilden sich Konturen um ihn aus, erst blass das Geländer, auf das er sich stützt, der weite Raum unter ihm, seine rechten Winkel aus schweren Tischen, Stuhlreihen, angefügten Pulten, ihre Linien flächig verschwommen, so dass man sie für Felder eines großen verschachtelten Spielbretts halten könnte, bis sie zunehmend an Schärfe gewinnen und sich einzelne Figuren zwischen ihnen abzeichnen, lebendig werden, tastend umherblicken, als hätten sie zunächst nur eine Ahnung, schließlich Gewissheit voneinander.
Wenn Richard sich über den Zuschauerbalkon beugt und steil hinabsieht, kann er dann erkennen, dass es an den drei langen, vom eigentlichen Verhandlungsgeschehen etwas abgetrennten Tischen der Mitarbeiterstäbe bereits zu wimmeln begonnen hat? Dort könnten alle Plätze schon belegt sein, man taxiert sich, markiert sein Terrain mit Unterlagen, Stifte werden gezückt, Kabel entwickelt, Kopfhörer aufgesetzt, manche lauschen mit geweiteten Augen ins Nichts, wie im Voraus erschrocken über das, was sie hier hören werden, doch nur keine Unsicherheit mit der neuen Technik zeigen. Köpfe nicken, Fußspitzen wippen, die Emsigkeit im Saal fällt erst auf, weil jeder Einzelne um gebotene Beherrschung bemüht scheint, und die anschwellende Geräuschglocke, weil kaum einer spricht. Eine nervöse Ruhe aus Stühlerücken und dem Klacken von Schnallen an Ledertaschen, dem Blättern durch die Prozessordnung oder die Nürnberger Tageszeitung, schließlich stehen sie heute alle drin. Von hier oben kann Richard die ausgebreitete Schlagzeile wahrscheinlich nicht entziffern, aber er wird sie kennen, auf dem Weg zum Gericht titelte sie von den Litfaßsäulen, Nachfolgeprozesse gehen weiter!, und die Neue Zeitung in München hat schon vorab verkündet, das Verfahren ist das größte und umfassendste von allen — nicht nur wegen der Zahl der angeklagten Prominenten, sondern auch wegen der Aufgabe, die sich die Anklage gestellt hat. Sie will nachweisen, daß das Gros der deutschen Diplomatie und Ministerialbeamten in einem noch bis vor kurzem nicht vermuteten Maß direkte Verantwortung für die Vernichtung von Menschenleben, für Kriegsverbrechen, für Raub und Mord nach gemeinsamem Plan trägt, ja daß der deutsche Beamte bei der Durchführung der befohlenen Verbrechen seine Auftraggeber teilweise überbot. Darunter die erkennungsdienstlichen Fotografien einiger Angeklagter, Namensschilder vor der Brust, Verbrecherbilder, DARRÉ, Richard W., DIETRICH, Otto — und ganz links, den anderen voran, der Vater.
Die Zeitungen rascheln, alles knistert, als breite sich ein Feuer aus, springe über auf das Pult der Protokollantin, die dort gerade den Verschluss des Stenographen aufklickt, und bis in die Saalecke, wo zwei Techniker des Bayerischen Rundfunks die Gelenke eines Stativs einrasten lassen. Über ihnen ist auf dem Sims der Holzvertäfelung ein Lautsprecher angebracht, er knackt und pocht dann dumpf, weil ein Gerichtsdiener das Mikrofon auf dem Richtertisch testet, mit dem Zeigefinger auf die Chromrillen klopft, so dass sich überall im Raum Köpfe in seine Richtung drehen. Sämtliche Unruhe verebbt und wächst wieder an, sobald er zwei Glühbirnen daneben in die Tischplatte schraubt, die Gewinde knirschen und gehen in das schleifende, metallene Ziehen der Elektrischen über, die jetzt draußen auf der Fürther Straße vorbeifährt und Richard daran erinnert, dass es da eine Welt gibt, Städte, Gebirge und das Meer. Vielleicht ist er auch zu sehr in Gedanken, um das Tramgeräusch mitzubekommen und dass trotz der Kälte noch einmal die Fenster geöffnet wurden, die schweren grünen Vorhänge zur Seite geschoben, um durchzulüften, oder wie sich der dünne Gardinenstoff dahinter bauscht und die hereinfallende Morgensonne zerstreut. Staub wirbelt auf, als der Gerichtsdiener auf das gepolsterte Leder der Richterstühle klopft, und glitzert im Licht, das zugleich die polierten Schuhe der Ankläger aufblitzen lässt und gegenüber in den Seidenbesätzen an den Roben der Verteidiger glänzt, während sie ernst ihre Aktenstapel vor sich ablegen und Platz nehmen, es spiegelt sich im Glas der Übersetzerkabinen und fängt sich schließlich in den bronzenen Früchten über dem Eingangsportal, wo nackte Jünglinge mit Tüchern den Baum der Erkenntnis flankieren und Schlangen aus dem Haar der Medusa züngeln, Flügel wachsen aus ihrem abgeschlagenen, von Schmerzen verzerrten Haupt. Ohne eine Miene zu verziehen, stehen die beiden Wachsoldaten links und rechts des Eingangs mit seitlich aufgepflanzten Gewehren, blicken ins Leere oder sehen, wie einer der Angeklagten seine Brille abnimmt und die Gläser anhaucht, das muss Otto von Erdmannsdorff sein. Eingepfercht sitzen die zwanzig Männer so eng, dass sich kaum einer rührt, und schweigen eisern, als schützte sie jeweils die Verachtung für die anderen, starren mit müdem Blick vor sich hin. Ihr abgetrennter Bereich ist der stillste im Raum, die Zeiger der Uhr über ihnen stehen auf 8.43 Uhr, und der Gerichtsdiener legt den Hammer auf dem Richtertisch ab, schiebt den Ständer mit der amerikanischen Fahne ein Stück weiter zum Fenster, die Zeiger stehen auf 9.02 Uhr, und ein Kameramann stolpert auf den Stufen vorm Zeugenstand, fängt sich gerade noch ab, jemand lacht, worauf sich ein junger Dolmetscher mit schwarzem Brillengestell in seiner Kabine ertappt fühlt und den Bissen Brot, auf dem er kaut, nicht mehr herunterbekommt, verstohlen schiebt er ihn von einer Backe in die andere. Man hüstelt, prüft seine Nägel, und auf der Pressetribüne streichen schon Stifte über Papier, Atmosphäre einfangen, erste Eindrücke sammeln, von unruhig trommelnden Fingerspitzen der Verteidiger, dem Zischeln auf den Zuschauerrängen und wie fahl alles wirkt, wie unter Raureif, als die Deckenröhren flackernd anspringen und dabei hinter den Fensterscharten der Rundfunkreporter kurz schemenhafte Gestalten aufscheinen, aufgeschreckte Gespenster.
Möglich, dass Richard für einen Augenblick nicht mehr weiß, was er hier eigentlich soll. Dass ihn das leise, von sicher weit über hundert Zuschauern ausgehende Rauschen in seinem Rücken und das angespannte Gewusel vor ihm im Saal an den Fidelio in Göttingen erinnert oder an den Rosenkavalier, wenn das Orchester sich kurz vor Beginn einstimmt und sein missklingendes Durcheinander die Erwartung noch steigert, bis in die hintersten Plätze, wo Hartmut, Peter und Wolfgang nun ohne ihn sitzen, auf Karten zu einer Mark, er denkt an ihren Rückweg nach der Oper, ihr beflügeltes Summen der Melodien und wie sich die Sperrstunde um zehn bald drohend nähert, sie auseinanderstreben, erst gemächlich, der Zeit überlegen, aber mit jeder weiteren Minute eiliger, bis sie fast rennen, nichts freier, als alleine durch die Nacht zu rennen. In Göttingen sitzen die Kommilitonen gerade in zerschlissenen, umgefärbten Uniformteilen in der Vorlesung, während sich hier einer der Angeklagten den Schlipsknoten strafft, muss Schellenberg sein, und Richard denkt an die Gier nach Musik seit dem Krieg. Nach Wissen, nach weiten Gedankenwelten und ihren Maßstäben, die die juristische Fakultät ihnen nur in Klauseln und peniblen Paragraphen vermittelt, meist ohne größeren Zusammenhang, und je genauer er auch jetzt auf Einzelheiten im Raum vor sich achtet, desto weniger kann er ihn als Ganzes fassen. Schattierungen vom Braun des Holzes, vom Grau der Anzüge, nur der rote Samt einiger Stuhlbezüge sticht hervor zwischen Tischreihen, die nach Partei und Funktion besetzt sind, zwischen überfüllten Bänken hinter Trennwänden und aus Zuständigkeiten zusammengeschobenen Karrees — kantige Bereiche, eingeteiltes Prozedere, jede Form ist mit einer anderen verwinkelt und bildet mit ihr schon Teile einer nächstgrößeren Struktur, der heillose Versuch, aufs Engste zu gliedern, was sich noch während des Ordnens schon wieder entzieht. Wie sollen sie darin nur Gerechtigkeit finden.
Die Richter scheinen von solchen Zweifeln frei, sie müssen es sein. In wenigen Minuten werden sich Powers, Christianson und Maguire hinter den massiven Kasten ihres Tisches setzen, der drei Stufen erhöht über dem Geschehen thront, und der Vorsitzende wird das Mikrofon vor sich einschalten und nach einem schrillen Auffiepen der Tonanlage Fall 11 der Nürnberger Nachfolgeprozesse eröffnen, The United States of America versus Ernst von Weizsäcker et alii. Das Verfahren folge der Richtschnur des Hauptkriegsverbrechertribunals entsprechend dem Londoner Statut und Erweiterungen nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10, wird er ansetzen und sagen, dass in den folgenden Monaten das Verhalten von Einzelpersonen untersucht werde, die möglicherweise in dem Irrglauben waren, mit dem Teufel spielen zu können, oder dem alten, überkommenen Rechtssatz anhingen, Könige könnten nicht unrecht tun und Krieg sei nur der Sport der Könige.
Vielleicht wegen der überraschend sanften Stimme Christiansons, die seine Sätze behutsam trägt, wird Richard ihnen kaum folgen können und immer wieder abschweifen, obwohl er genau weiß, dass er sich zusammenreißen muss, dass doch jetzt gilt, wofür sie die letzten Monate Tag und Nacht gearbeitet haben. Selbst ihre eigenen, hundertfach formulierten Gegenargumente liegen nicht mehr sauber in ihm parat — nulla poena sine usw. und dass man so doch keinem Mann gerecht wird, der immer nur Frieden wollte und dafür vielfach sein Leben riskiert hat. Anstatt sich auf die Eröffnung und mögliche Widerworte zu konzentrieren, wird Richard sich fragen, ob sie alle hier im Saal nicht letztlich bloß Beteiligte am großen Drama der Geschichte sind, das sie zugleich übermannt. Vor Gott sind wir alle Sünder, er denkt: Niemand kann die Taten des Vaters verstehen, der jenseits der Akten nicht sein Wesen erkennt, und dass selbst er es im Grunde ausgerechnet dessen Verwicklung in das nun Stück für Stück, Seite für Seite freigelegte Unheil verdankt, ihm doch noch nahezukommen. Wie seinem Vater, der stets um vollendete Selbstbeherrschung bemüht ist, das Gesicht entglitt, als sie sich nach seiner Verhaftung das erste Mal wiedersahen. Wie sie ihre Hände vor den Gesprächen im Gefängnis zur Begrüßung an das Trenngitter legen. Ein Satz des Vaters, man versteht mich ganz — oder ganz falsch.
Aber das ist später, wenn überhaupt. Noch stützt sich Richard gegen das Geländer des Zuschauerbalkons, und wie auf seinen Wanderungen im Gebirge, wenn er in einen Abgrund blickt, gleichzeitig erschreckt und angezogen von der Tiefe, überlegt er, ob sich auch Fallen anfühlt wie Fliegen, für einen kurzen Augenblick. Er sieht die geschlossenen Linien von Anklage und Verteidigung entlang. Da ist Kempner, ihr Gegner, ihr Feind, wie Hellmut sagt, als Einziger hat er sich noch nicht gesetzt, sondern steht vor seinem Platz, ungeduldig wie ein Boxer, zum Angriff bereit, eine Hand aufreizend in die Hosentasche gesteckt, die andere hält eine schwarze Brille, den Bügel lässig zwischen die Lippen geschoben. In der Anklageschrift hat Kempner die Beamten aus den Ministerien als Mörderbande bezeichnet, ohne deren Facharbeit Hitlers Pläne früh gescheitert wären. Er hält sie für Pinkel in gestreiften Hosen, nicht weniger schuldig als die, die den Toten in Treblinka noch die Zähne herausbrechen ließen. Für Hellmut ist er ein tollwütiger Kläffer, der keine Wahrheit sucht, sondern Rache, weil Göring ihn aus dem preußischen Staatsdienst geworfen hat, wegen politischer Unzuverlässigkeit in Tateinheit mit fortgesetztem Judentum. Eine ganze Akte hat Hellmut über ihn angelegt. Flüsternd wird er unter den anderen Verteidigern Dr. Sixtus Beckmesser genannt oder Kempner-Freisler.
Ihm gegenüber sitzt Hellmut und würdigt ihn keines Blickes. Ruhig blättert er in seinen Unterlagen, die Pomade glänzt im streng zurückgekämmten Haar. Hellmut wirkt jung, wie verirrt im kolossalen Justizpalast, unerfahren in Strafsachen. Man wird ihn unterschätzen, aber das ist ein Vorteil. Er will sich vor Gericht zurückhalten, sich absetzen von der Aggression anderer Anwälte und der Anklage, die warten doch nur darauf, dass ich losgeifere, die einen, um sich hinter uns zu ducken, die anderen, um uns als Unverbesserliche hinzustellen. Sie müssen es versteckter spielen, über Bande, hat er gesagt, über Marion und die Boveri, und wir brauchen noch jemanden bei der Christ und Welt. Niemand darf erfahren, dass er in der Partei war, das wäre ein Fest für Kempner, un repas pour le bourreau, Französisch spricht Hellmut fließend. Sein Selbstbewusstsein ist Richard manchmal unheimlich.
Neben Hellmut sitzen Verteidiger der anderen Angeklagten, Achenbach und Elisabeth Gombel, die einzige Frau, ihre geschminkten Lippen leuchten zwischen all dem farblosen Zwirn. Hellmut findet ihre Nase griechisch. Sehr aufrecht und reglos ragt sie aus der Reihe, während sich die Männer rundherum wie nervöse Späne an ihr auszurichten scheinen, breitbeinig wippen, aufwendig gähnen. Ihr Mandant Bohle hat als einziger ein Schuldbekenntnis angekündigt, angeblich schneiden die anderen ihn in der Haft, Klassenkeile, ihm werden die dreckigsten Arbeiten zugeschanzt. Die Reichsminister und Brigadeführer titulieren sich noch hinter Gittern loyal mit Rängen. Der Anwalt schräg hinter der Gombel kann seinen Blick nicht von ihrem blonden Hinterkopf lassen, muss Fröschmann sein, der Verteidiger von Berger. Der soll in Weißrussland an Massenvergewaltigungen und der Ermordung von Frauen und Kindern beteiligt gewesen sein, reiste dafür eigens aus Berlin an und nahm gleich noch ein paar Zwangsarbeiterinnen mit zurück, die Dirlewanger ihm fürs Hauptamt beschaffte, gegen zwei Flaschen Schnaps pro Frau. Das Rohe ist ihm ins Gesicht geschrieben, alles zieht darin nach unten, die verkniffenen Mundwinkel, die Brauen, die Wangen aus tief gekerbtem Teig. Er malmt mit den Kiefern, blickt stumpf umher, selbst Dietrich und Schellenberg scheinen links und rechts von ihm abrücken zu wollen. Die grobschlächtigen SS-Männer wie Berger versuchen in unserem Schatten zu bleiben, vermutet Hellmut, aber das dürfen wir nicht zulassen, wir brauchen sie in ihrem ganzen Ungeist. Sie sind genau das, was dein Vater im Amt verhindern wollte.
Der Vater ist auf seinem Platz ein wenig nach unten gesackt und blickt nach vorne, scheinbar zum leeren Richtertisch, doch Richard glaubt, dass er über ihn hinwegsieht, etwas höher, durch den Spalt der Vorhänge zum Fenster hinaus, und den Horizont sucht, irgendein Abglanz dessen, was einmal als blendende Zukunft vor ihm lag. Die langgestreckte Linie, die großen Zusammenhänge, nicht das Kleingekritzel von Aktennotizen und Sichtvermerken. Die Haft hat ihn hager gemacht, sein Kinn noch fliehender, die Augen wie in karstigen Höhlen versunken, akkurat gescheitelt das lichte weiße Haar, aber sein Anzug ist ihm zu groß geworden, ein aufgetragenes Kostüm, das schlapp und formlos an ihm hängt. Schon der schwarze Dreiteiler setzt ihn vom Einheitsgrau der anderen ab, und Richard wundert sich, dass Hellmut das nicht vorhergesehen und verhindert hat. An deinem Vater soll ein Exempel der alten Funktionselite statuiert werden, hat er ihnen doch eingebläut, wir müssen jeden Eindruck des Herausgehobenen vermeiden. Schlimm genug, dass er ganz außen auf der Anklagebank sitzt, er führt das Verfahren an, es lautet auf seinen Namen. Letztes Jahr saß dort noch Göring, ausgerechnet Göring, dieser plumpe, aufgeplusterte Fasan. Mit gedrosselt dramatischer Betonung und der Unerschütterlichkeit dessen, der jede große Bühne auskostet, prahlte er tagelang in einem vor Entsetzen stummen Saal. Damals war Richard mit Marion und Axel aus Göttingen angereist, um ihn mit eigenen Augen zu sehen, sein verschlagenes Gehabe, mit dunkler Sonnenbrille im Licht der Scheinwerfer, das die Knopfleisten seiner Marschallsuniform blinken ließ, ohne militärische Abzeichen: ein grotesker Zirkusdirektor.
Wie klein der Vater dagegen von hier oben wirkt, gekrümmt sitzt er da, in sich gefallen, etwas ist aus ihm gewichen, das ihm Gewicht gab und Halt, aber auch so viel wog, dass es ihn festhielt, dass er blieb, sagt er, um zu retten, was nicht zu retten war, und während die Bürde des Scheiterns ihn nun langsam freigibt, legt sie sich vielleicht schon als kalte Hand in Richards Nacken, der sich fester am Geländer abstützen muss, weil ihn wieder Schwindel erfasst und das Gefühl, jemand stehe ganz dicht neben ihm und achte auf jede seiner Regungen oder flüstere sie ihm ein. Etwas ist auf ihn übergegangen, schon weil der Freie dem Gefesselten überlegen ist, in Umkehrung der Hilfs- und Schutzpflicht zwischen Eltern und Kindern, wird der Vater später schreiben. Die Röhren unter der dunklen Kassettendecke flackern wieder, der Raum entgleitet, es schwindelt Richard, doch nicht nur unter der Last, die auf ihm liegt, sondern auch, je mehr sie ihn drückt, vor einer seltsam euphorischen Lust und davor, wie er sich erstarken fühlt unter dieser schweren Nähe zum Vater, er spürt, er könnte ihn auf die Schultern nehmen und durchs Feuer tragen, und erinnert sich an einen Sommerurlaub seiner Kindheit in Tirol, wo der Vater mit ihm im Boot zur Mitte des Möserer Sees ruderte, in dem es Blutegel gab, und ihn dann aufforderte, alleine bis ans Ufer zurückzuschwimmen — wie er weinte und bettelte, er könne doch noch gar nicht schwimmen, aber der Vater drohte, wenn du nicht schwimmst, holen dich die Ungeheuer des Sees. Wie die Dumpfheit unter Wasser ihn kurz umgab, als der Vater ihn hineinwarf, das Eintauchen in die Kälte. Wie die Schatten in der Tiefe an ihm zogen und ihn gleichzeitig trugen, während er panisch durch ein Glitzern strampelte, das die Sonne vor ihm ins Wasser schüttete.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wird der Richter gleich vortragen, lege die Anklage ihm zur Last, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen, und fragen, wie der Angeklagte sich dazu erkläre, ob er einen Anwalt habe, und der Vater wird in der plötzlichen Stille, in der nur das leise Surren einer Kamera zu hören ist, ein wenig nach hinten wippen und sagen: »Bitte wiederholen Sie.«
»Do you have a counsel to represent you?«
»Ja.«
»Has the indictment in the German language been served upon you at least thirty days ago?«
»Ja.«
»Have you read the indictment?«
»Ja.«
»How do you plead to this indictment: guilty or not guilty?«
»Bitte wiederholen Sie! Sie sprechen zu schnell, das kann man nicht verstehen.«
Die ersten Worte des Vaters kommen noch wie belegt hervor, etwas stockend verhallen sie im Saal, als wären es die ersten, die er seit langem ausspricht, und er müsste sie erst einzeln erinnern und mühsam formen, aber mit jeder weiteren Antwort verraten seine gefasste Stimme und Haltung deutlicher, was dieser ganze Vorgang für ihn ist: eine Zumutung — dass man seine Aussagen als unglaubwürdig darstellen könnte, dass er öffentlich für seinen Charakter werben soll. Eine Unerhörtheit, schon die Anklageschrift, das auftrumpfende Misstrauen darin und dass er, der mit der feinwebenden Kunst der Diplomatie stets im Verborgenen nach Ausgleich suchte, hier von Amateuren an den Pranger gezerrt wird. Er erwartet, verstanden zu werden. Am liebsten würde er schweigen, stiller Protest gegen ein falsches Gericht, das ihn über seine eigenen Ideale nicht zu belehren braucht, Frieden und Menschlichkeit. Sein Scheitern soll ihm als Schuld ausgelegt werden. Doch die einzige irdische Instanz, die ihn dafür hätte anklagen können, wäre Freislers Volksgerichtshof gewesen, wegen Hochverrats, gegen Hitler. Moralisch urteilen darf nur Gott.
»Ich erkläre mich für nicht schuldig.«
Richard weiß, sie müssen aufpassen, der verletzte Stolz und die Empörung des Vaters können den Eindruck von Hochmut erwecken, ja von Verblendung, sie dürfen nicht den Fehler von Göring oder Dönitz machen und eine ritterliche Behandlung einfordern. Selbst Richard kommt der Vater manchmal wie ein Erblindender vor, immerzu gekränkt. Eigentlich kennt er ihn nur als gekränkten Mann, von Weimar bis Nürnberg. Ganz ungläubig, als sich im März eine Ermittlung gegen ihn abzeichnete, tief enttäuscht darüber, wie er schrieb, daß jedermann verfemt war, der mit diesem Regime zu tun gehabt hatte, sei es als Anhänger, Mitläufer oder auch in stiller und noch so rühriger Opposition — als würde man auf einen erfahrenen Strategen wie ihn doch nicht verzichten können. Noch in den Tagen nach der Kapitulation hat er von Rom aus weitschweifige Skizzen für eine mögliche Zukunftspolitik entworfen. Was jetzt vor sich geht, ist doch nichts anderes, als der Einbruch asiatischer Unkultur in Europa. Arm in Arm mit dem bolschewistischen Rußland würden wir physisch uns vielleicht erholen, moralisch aber gleichzeitig erliegen. Vorerst müssen wir uns auf ein langes, mühsames und kompliziertes politisches Spiel zwischen den Okkupationsmächten in West und Ost einrichten. Angesichts der jetzigen Lage Deutschlands mag diese ganze Betrachtungsweise überhaupt als veraltet und unzulässig erscheinen. Es ist aber kein nationalistischer Rückfall, wenn wir uns auf unserem Boden zunächst nach hergebrachter Methode neu zu sichern suchen. Das ist nur Ausübung unseres Naturrechtes.
Als wäre Deutschland tatsächlich noch in der Position gewesen, Bedingungen zu stellen, mit verdeckten Karten zu spielen. Als käme nach den dunklen Jahren nun endlich seine große Zeit.
Die Zeiger stehen auf 10.14 Uhr, und Richard hat die Augen geschlossen, damit der Schwindel vergeht, hinter ihm kratzen Stifte auf Papier, und er erinnert sich, dass der See in Tirol so kalt war, dass es von großer Hitze kaum zu unterscheiden war und er glaubte, im Wasser zu verbrennen, die Zeiger stehen auf 10.14 Uhr, und er denkt jetzt bestimmt nicht an Tirol, sondern hat anderes im Sinn, vielleicht fragt er sich, ob er wirklich hier ist, um seinem Vater das Leben zu retten, der Familie die Ehre, oder weil er wissen möchte, wer er überhaupt ist, wer sie beide sind, weil er etwas lernen muss, was ihm in Göttingen niemand nach Gesetzestexten aufschlüsseln kann — über die Zeit, aus der sie kommen, und die, in die sie gehen, er ist ein Lehrling, ein Satz des Vaters, Zauberlehrling, der ich war. Alles dreht sich, in Richard, dem Raum und um ihn, die Fragen, ob man sich das Böse vorzustellen vermag, bevor man es gesehen hat, oder noch verhindern, wenn es bereits vor sich geht, ob jemand ohne Schuld bleiben kann in einer Zeit, die nur noch verschiedene Wege des Fehlgehens bietet, und wo die Antworten zu finden sind, in den nachlesbaren Vermerken und Erlassen oder im Archiv des eigenen Gedächtnisses mit seinen verzweigten Gängen und Fluchten aus dicht gestaffelten Regalen und unbegrenzten Bezügen, durch die die Gedanken verloren geistern, die Wahrheit wird euch frei machen: Das war das Letzte, was die Mutter dem Vater mit auf den Weg gegeben hat, als er im Juli nach Nürnberg aufbrach, und Richard wird einmal sagen, dass nun keine Gefühle mehr geschont werden sollten, denn je ehrlicher wir sind, desto größer unsere Freiheit. Dass der Blick zurück in einen dunklen Abgrund führt, aus dem die Deutschen befreit werden mussten, dass selbst wenn die meisten geglaubt hatten, für die gute Sache ihres Landes zu kämpfen und zu leiden, keiner, der Augen und Ohren aufmachte, die rollenden Deportationszüge leugnen konnte, er wird sagen, eine jüdische Weisheit laute, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, und dass es keine endgültige moralische Vollkommenheit gibt, für niemanden und kein Land, denn als Menschen haben wir gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet.
Aber das ist später. Fast vierzig Jahre später, wenn er in einem anderen großen Saal vor einer Reihe blühender gelber Margeriten steht, den Kopf am Ende ein wenig hebt und im Moment des Aufblickens sagt, schauen wir an diesem 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge.
2
Am 1. April 1938 trat Ernst Freiherr von Weizsäcker in die NSDAP ein, Mitgliedsnummer 4.814.617. Zwei Tage später wurde er in Berlin zum Staatssekretär des Auswärtigen Amtes ernannt, rückwirkend zum 19. März. Damit war er unter Außenminister Joachim von Ribbentrop der höchste Diplomat des Reiches. Er blieb es fünf Jahre lang. Am 23. April 1938 unterzeichnete Weizsäcker seinen Aufnahmeantrag in die SS. Kurz darauf wurde er dem persönlichen Stab des Reichsführers SS Heinrich Himmler zugeteilt, am 9. November, dem Jahrestag des Marsches auf die Münchner Feldherrnhalle, als SS-Führer auf Adolf Hitler vereidigt. Den Ehrenrang eines Oberführers erhielt er an Hitlers Geburtstag. Im Januar 1942 beförderte ihn Heinrich Himmler zum SS-Brigadeführer. Er verlieh ihm außerdem den Totenkopf-Ehrenring und den SS-Ehrendegen.
Für manche sprechen diese historischen Tatsachen eine klare Sprache, für andere sind sie nur leere Etiketten, ja Ausdruck von Weizsäckers gewiefter Tarnung, um das Regime aus seiner eigenen Mitte heraus zu hintertreiben. Er selbst beschrieb es später als nötiges Opfer für seine Friedensmission. Wer ist hier unverfroren, wer voreingenommen. Wer würde nicht Robert Kempners Fassungslosigkeit teilen, als Weizsäcker, der als kultivierter Ehrenmann auftrat, vor Gericht seine Rolle in der Judenfrage auf die eines Briefträgers in diesen scheußlichen Angelegenheiten herunterspielte. Andererseits stand er wohl ursprünglich gar nicht auf dem Zettel der Anklage. Per Rundfunk und Presse hatte Kempner alle ehemaligen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes aufgerufen, sich als mögliche freiwillige Zeugen zu melden. Als Weizsäcker im April 1946 an Pater Robert Leiber schrieb, Widerstand durch scheinbare Mitarbeit ist letzten Endes die tragische Aufgabe qualifizierter Menschen in der Diktatur, war er mit der Judikatur schon in Kontakt. Im folgenden Monat sagte er unter Zusicherung freien Geleits in Nürnberg als Entlastungszeuge über Admiral Raeder aus und enthüllte dabei das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt, eine Sensation. Er sprach wie mit gespitztem Mund; konnte oder wollte er sich an etwas nicht erinnern, sagte er: Es ist mir in keiner Weise erinnerlich.
Das mächtige wilhelminische Trumm des Justizpalasts, einst steinerner Ausdruck der Reichsgröße und seiner Herrschaft, erhob sich inmitten der zertrümmerten mittelalterlichen Stadt fast unzerstört, trotz mehrerer Bombenvolltreffer. Weizsäckers Weggefährte Albrecht von Kessel nannte den Bau ein Todesskelett, dabei waren sogar die Wappenkartuschen an der Fassade erhalten geblieben, und die Personenaufzüge funktionierten einwandfrei. Für die Alliierten zählte vor allem, dass der Palast über einen angeschlossenen Gefängnistrakt verfügte und symbolische Kraft hatte: die Stadt der Reichsparteitage, die Stadt der Rassengesetze. Im Keller des Palasts lagerten die Bilder von Hitlers persönlichem Fotografen, auf dem Dachboden die Urteile der Nürnberger Blutrichter.
Dass Weizsäcker in Nürnberg ein gefragter Zeuge war, hat seine Erwartung vermutlich genährt, selbst nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er hackte Holz auf der kleinen Obst- und Hühnerfarm der alten Mutter in Kressbronn am Bodensee, fuhr abends den Heuwagen mit Erde in die Scheune, daran denkt er später im Gefängnis gern, und die Hoffnung stieg noch mehr, als Hauptankläger Telford Taylor auf einer Pressekonferenz im Mai 1947 nicht einmal seinen Namen nannte.
Da standen die weiteren Nachfolgeprozesse bereits unter Druck. Der aufziehende Kalte Krieg hatte zu ersten Frostrissen zwischen den Siegermächten geführt, auch die Westalliierten waren sich uneinig; so übernahm die amerikanische Anklagebehörde Fall 11 allein. Der gesetzliche Status dafür war prekär, kontinentale und anglo-amerikanische Verfahrensregeln vermengten sich, vieles wirkte improvisiert und bot Angriffsfläche für die Verteidigung, vorsichtig betrat man rechtliches Neuland. Zudem waren die Kosten der Verfahren immens, und Washington signalisierte: Wir müssen zum Ende kommen, die Welt dreht sich weiter, der Feind steht bald woanders. Was ursprünglich sechs Prozesse werden sollten, wurde nun in einen gepackt, eine ganze Liste von Angeklagten gestrichen. Um die Palette der Täterschaft und den repräsentativen Charakter des Falles trotzdem zu erhalten, saßen schließlich Männer mit ganz unterschiedlichen Tatkomplexen auf der Anklagebank — wie in einem Omnibus. So nannte ihn die Presse bald spöttisch: den Omnibus-Prozess, der zusammenpferchte, was angeblich nicht zusammenpasste.
Wahrscheinlich wurde Weizsäcker auch deshalb Hauptangeklagter — und nicht etwa Hans Heinrich Lammers, Hitlers Chef der Reichskanzlei —, weil es der Anklage zunächst besonders um den Punkt des Angriffskrieges ging, bei dem sie das Auswärtige Amt im Vordergrund sah. Und weil sie sich nicht nur auf die Vergangenheit richtete, sondern auch auf die Zukunft. Der Historiker Dirk Pöppmann hat beschrieben, wie die Anklage neben der herkömmlichen strafrechtlichen Schuld vor allem die verwaltende Verantwortung im Blick hatte und somit die Rolle jener gehobenen Bürokraten, für deren alte Garde Weizsäcker mit seinem bildungsbürgerlichen Hintergrund und preußischen Habitus mustergültig stand. Robert Kempner bezeichnete ihr moralisches Versagen sogar als größer als das vieler SS-Verbrecher, da sie, meist älter und erfahrener, das Ausmaß des Grauens besser hätten begreifen müssen. Er wollte sie im neuen Deutschland von einer demokratisch orientierten Funktionsspitze abgelöst sehen, wollte Steine aus dem Weg zu einem neuen Staat räumen, und das nicht nur vor Gericht. Er empfahl Bekannte aus dem Exil für politische Posten in Deutschland, durchsiebte das ganze Land per Fragebogen, machte sich für amerikanische Verwaltungsstrukturen stark. Die demokratische Wiedergeburt war ein politisches Ziel, das in Nürnberg unsichtbar mitverhandelt wurde, ohne jedoch die individuelle Schuld zu relativieren.
Dies sind die Männer, die die Pläne und ideologischen Zielsetzungen des Dritten Reichs in die Tat umgesetzt haben. Ohne ihre Verwaltungsarbeit und die Umsetzung in die Realität, ohne ihre vorbereitenden Direktiven und Anordnungen, hätten kein Hitler, kein Göring Angriffskriege planen und durchführen können; und auch kein Himmler hätte sechs Millionen Juden und andere Opfer von nationalsozialistischer Gewalt und Ideologie auslöschen können. Hätte es einige dieser Männer nicht gegeben, hätten die unbedeutenden Todesschützen und Scharfrichter in Konzentrationslagern niemals die Exekutionsbefehle erhalten, für die viele von ihnen kürzlich mit dem Leben bezahlt haben.
Die Anklageschrift erreichte die Verteidigung Mitte November, gut einen Monat vor Eröffnung des Verfahrens. Das Sammelsurium an Angeklagten mit manchmal kaum ersichtlichen Tatbezügen ließ sie stellenweise wie verschlüsselt wirken — und das umso mehr, als sie nach amerikanischem Recht nur verknappte Zusammenfassungen enthielt, nicht das gesamte Anklagematerial. Eines der Bindeglieder war Weizsäcker selbst, als Angeklagter in allen acht Punkten.
Planung, Vorbereitung, Einleitung und Führung von Angriffskriegen
Gemeinsamer Plan und Verschwörung
Kriegsverbrechen: Ermordung und Misshandlung von Kriegsteilnehmern und Kriegsgefangenen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Gräueltaten gegen deutsche Staatsangehörige zwischen 1933 und 1939
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: gegen die Zivilbevölkerung
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Raub und Plünderung
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Zwangsarbeit
Mitgliedschaft in verbrecherischen Organisationen
So schwer die Anklage war, so federleicht mag sie auf Richards Hand gewogen haben. Die achtzig Seiten Papier standen in gnädigem Missverhältnis zu dem, was sie behaupteten, und anfangs merkte er vielleicht beim Lesen, wie er für alles Formale dankbar war, was sie ein wenig von ihrem Inhalt ablöste und weiter schmälerte, die schülerhaften Unterstrichelungen von Überschriften, Rechtschreibfehler, die blass kopierten Stempel, per Hand nachgefahren, verschmierte Lettern. Als wäre es wirklich nur ein Text, eine lange Fallaufgabe, achtzig Seiten, acht Punkte, das schien beherrschbar. Allein die in Großbuchstaben gesetzten Namen der Angeklagten sprangen ihn förmlich an, und bei jedem Umblättern hoffte er, nicht sofort seinen Namen zu erblicken oder wenigstens nicht in engster Umgebung mit anderen wie HITLER oder GOERING. Je häufiger er die Schrift jedoch las, desto besser gelang es ihm, sie auf ihre reine Rechtslage hin zu betrachten, ihre Struktur und Strategie durchscheinen zu sehen, er abstrahierte zusätzlich, was von Taylors Behörde ohnehin schon auffällig nüchtern gehalten war, zwölf finstere Jahre in einem flachen Stapel, unermessliche Zerstörung auf der ganzen Welt, Millionen von Menschen getötet. Wie sollte so etwas auch ausgerechnet in Zeilen und Buchstaben zu fassen sein. Dass die Anklage verhältnismäßig wenige Beispiele anführte und diese eher nannte als detailliert beschrieb, ließ dahinter zwar bloß noch gewaltigere Beweismassen erahnen, aber es machte Richard die Arbeit auch erträglicher, er las: über die Pläne der Nazipartei, ihre Gesetzgebungen, die Kontrolle von Staatsdienst und Justiz, die Sprache der Propaganda, Volksdeutsche, Lebensraum, Herrenrasse — wie ein künstlicher historischer Extrakt kam es ihm manchmal vor, so verdichtet, dass es mit seinem lebendigen Vater doch kaum etwas zu tun haben konnte, und zugleich so konzentriert auf die zwanzig Angeklagten, als sammelte sich die ganze Macht des Dritten Reiches in den wenigen Zeichen ihrer Namen.
Der Anklage zufolge hatte das Auswärtige Amt die Mobilisierung zum Totalen Krieg mit allerlei Manövern flankiert, mit Falschzusicherungen, diplomatischem Druck oder nackten Kampfansagen. In Gegenwart des Angeklagten WEIZSAECKER habe HITLER dem tschechoslowakischen Präsidenten am 14. März 1939 in Berlin mit einem sofortigen militärischen Einfall und der Zerstörung Prags gedroht, bis HACHA der Besetzung seines Landes durch deutsche Truppen zustimmte. Richard erinnerte sich, dass der Vater einmal von dieser Nacht gesprochen hatte; wie der bedauernswerte Präsident einen Schwächeanfall erlitten habe, mitten auf dem geblümten Teppich der Reichskanzlei. Hitlers Leibarzt gab ihm Traubenzucker. Bei der anschließenden Unterzeichnung des Abkommens habe Háchas Hand noch merklich gezittert, hatte der Vater gesagt, eine insgesamt unangenehme Situation, aber gegenüber dritten Mächten sei es doch ein recht wertvoller Ausweis gewesen, Richard las: wie der Vater und sein Amt etliche kriegerische Überfalle durch falsche Darstellungen gerechtfertigt hätten, wie sie Operationszonen für die deutschen Streitkräfte festlegten und Berichte über die Massenmorde der Einsatzgruppen bearbeiteten. Die Formulierungen wiederholten sich von Punkt zu Punkt, waren fernerhin verantwortlich … beteiligten sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit … der Angeklagte als Täter oder Beihelfer, allgemeine Wendungen reinen Vollzugs, deren Formelhaftigkeit die Vorwürfe bald mehr wie eine gleichmäßig an- und abschwellende Litanei zu Richard heran- und wieder forttrug, so dass sie fast nichts hinterließen. Die Exekution gefangener Soldaten sollte der Vater als normale Verluste im Kampf vertuscht haben. Er sollte die Deportation von unerwünschten rassischen Elementen in den besetzten Ländern durch Verhandlungen und Verträge abgestützt haben, die Ausrottung von Bazillen, Parasiten und Untermenschen.
Richard begriff, was dort stand, aber er konnte sich seinen Vater dabei nicht vorstellen oder nur als verstelltes Abbild seiner selbst. Versuchte er es, sah er einen sich windenden, um stille Größe ringenden Mann, der sich verkleidet in eine Rolle zwang. Was bedeuteten Handlungen ohne ihre äußeren Umstände und inneren Zustände. Er horchte darauf, ob sich eine deutliche Empfindung in ihm regte, und erwartete sie gewappnet mit bislang unumstößlichen Losungen, der Vater war tragisch verstrickt, keiner bleibt ohne Schuld, doch sie verhallten bloß in der Leere, die vom Ausmaß der Anklage zurückblieb, einem dumpfen Gefühl alles betäubenden Zweifelns — nicht einmal woran, wusste er genau, und Hellmut sagte, gut so, genau dahin müssen wir die Richter bringen.
Rätsel gab ihnen auch Robert Kempner auf, der für die politischen Angeklagten zuständig war. Er ermittelte nicht als neutraler Staatsanwalt, wie sie es gelernt hatten, sondern kam ihnen wie ein Ringkämpfer vor, der den Stand des Gegners unbedingt zu schwächen und die Oberhand zu gewinnen suchte. Auf der Liste seiner Belastungszeugen entdeckten sie Friedrich Gaus, den ehemaligen Leiter der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt, das konnte zu einem Problem werden, einem großen. Gaus kannte alle Paraphen und ihre Funktionen. Hellmut Becker glaubte an einen Kuhhandel, einmal das Vorzimmer getauscht, vom Kronjuristen zum Kronzeugen, so entgehe er selbst der Anklage, Erpressung! Ernst von Weizsäcker wollte eine solche Absprache abgelehnt haben, bei einem ihrer frühen Gespräche, noch vor seiner Verhaftung, habe Kempner sie ihm angeboten. Es kränkte ihn, dass Kempner nun zunehmend als scharfer Ermittler auftrat, der seine entlastenden Darstellungen als zweifelhaft verwarf. Kempner gab ihm auch nie die Hand, aber das tat er bei keinem. Seine Eltern, die Bakteriologen gewesen waren, hatten angeblich nicht einmal Eheringe getragen, weil sich darunter Keime einnisten konnten.
Die Verhöre vor Prozessbeginn, bis weit in den Sommer hinein, versuchte Weizsäcker noch wie einen gepflegten Austausch zwischen zwei nachdenklichen Männern zu führen, er sinnierte: Ribbentrop und die anderen Oberen seien nicht antimoralisch gewesen, sondern amoralisch, ihre Moral ein schwarzes Loch, ein Vakuum, er raunte: Sie kennen mich noch nicht, und Kempner erwiderte: Man kennt nie einen Menschen, man kennt überhaupt keinen anderen Menschen. Dabei setzte Weizsäcker genau darauf. Immer wieder beschwor er Kempner, statt den Dokumenten seiner Persönlichkeit zu vertrauen, ihn zu verstehen, zu erkennen. Daraus würde sich alles andere ergeben. Und gut möglich, dass Kempner ihm seine besseren Absichten sogar glaubte, doch gerade dass dies an den Vorwürfen nichts änderte, machte es so schwer, sie zu entkräften. Was zählte eine menschliche Gesinnung gegen das Versagen in politischer Verantwortung, was eine Beamtenpflicht gegen das Fehlen einer inneren Stimme, die irgendwann sagte, bis hierhin und nicht weiter.
Mit Sicherheit aber nahm Kempner ihm nicht die Doppelrolle des verdeckten Widerständlers ab, die Weizsäcker aus seinem friedfertigen Amtsverständnis abgeleitet haben wollte. Sie musste Kempner als Taktik erscheinen, schon weil Weizsäcker sie ihm gegenüber zunächst gar nicht vertreten hatte. Vielleicht hatte er sich zu sicher gefühlt, auch zu bedeutsam. Wie sollte Kempner ihm da vertrauen. Weizsäcker hatte lange abgestritten, dass sein Amt mit der Deportation von Juden überhaupt etwas zu tun hatte, er beharrte auch darauf, nichts von den Ermordungen in Auschwitz gewusst zu haben. Er lavierte, gestand jeweils nur ein, was Dokument für Dokument offensichtlich wurde, eine Abfolge sich langsam verengender Aussagen: Die grausamen Sachen sind mir nicht bekannt gewesen, man hat immer nur munkeln hören. Wurde zu: Im Allgemeinen wurden mir die Sachen nicht vorgelegt, nicht im durchschnittlichen Geschäftsgang. Wurde zu: Das von mir unterschriebene Papier enthält nicht die Aktion selbst, sondern nur eine Ankündigung. Wurde zu: Es ist sicher, dass ich die Überführung dieser sechstausend Menschen nicht mitgemacht hätte, wenn ich von den Scheußlichkeiten, die ihnen passieren konnten, gewusst hätte. Wurde zu: Ich ließ die Dinge laufen, weil sie meiner Kompetenz entzogen waren. Wurde zu: Wenn man gewisse Sachen nicht hätte laufen lassen, wäre man aus dem Dienst ausgeschieden und hätte sein Ziel aufgeben müssen, Schlimmeres zu verhindern. Kempner ließ die Angeklagten immer erst einmal reden, weil er glaubte, dass glatte Lügen leichter zu widerlegen waren als schwammige Ausreden.
In einem dieser Vorverhöre sagte er zu Weizsäcker, er sei bereit, alles zu vergessen und nur zwei Tatsachen zu betrachten: »Die Toten und die Gemordeten, das ist eine Tatsache, und die zweite ist: Sie waren als Staatssekretär mit von der Partie. Die Schriftstücke vergesse ich. Aber nicht die Tatsache, dass Sie dabei waren zu der Zeit, als die Leute in Todeskammern gestoßen worden sind, als Soldaten in einem Angriffskrieg standen oder als Juden deportiert wurden. Das ist das, worüber ich nicht hinwegkommen kann. Schön, Sie haben versucht zu verhindern, was Sie konnten. Das Verhindern hat mit Ihrer Hilfe oder ohne Ihre Hilfe dazu geführt, dass die Leute tot sind.«
»Sie meinen, es wäre von meinem Standpunkt richtiger gewesen, wenn ich dieses Geschäft verlassen hätte.«
»Ja, ich möchte bei einem Mord nicht dabei sein. Bei einem Mord, bei dem ich sehe, dass ich ihn nicht verhindern kann.«
»Wäre es richtig gewesen, wenn ich mich, da ich diese Politik Hitler-Ribbentrop durchschaute, wenn ich mich da mit welchen Mitteln auch immer zurückgezogen hätte?«
»Ja.«
»Glauben Sie, es hätte mir ein Vergnügen gemacht, wenn die jungen Leute hätten in den Krieg ziehen müssen und ich in der Lage gewesen wäre, am 1. September im Ruhestand, unter einem Birnbaum zu leben? Dann hätte ich mir sagen müssen: Du hast dich zurückgezogen, du lässt sie ihr Blut zu Markte tragen. Ist das eine bessere moralische Position? Ich stelle Ihnen die Frage, um Ihnen über dieses Dilemma hinwegzuhelfen. Ist das eine anständige Position?«
»Ich sitze lieber unter einem Birnbaum mit mir allein, als dass ich den Todesgang von tausend Leuten nach Auschwitz mitzeichne.«
»Ich wusste nichts von diesem Papier.«
»Wir wollen von Papier absehen. Nur sind Millionen von Menschen umgekommen, und ich weiß von mir, du bist irgendwo mit deinem Namen dabei. Ist das eine anständige Position, ist das vielleicht ein Standpunkt? Ich bin lieber unschuldig an einem Mord.«
»Ich bin lieber vor diesem Gericht, als dass ich mich zurückgezogen hätte.«
»Das ist wichtig zu wissen.«
»Ich dachte, Sie hätten das von selbst verstanden!«
Eine Vorstellung: wie die Hauptverhandlung am 6. Januar 1948 beginnt, einem neblig kalten Morgen. Richard muss hellwach sein, er soll bei den Eröffnungsplädoyers für Hellmut Notizen machen, er muss müde sein, in der Nacht hat er kaum geschlafen. Früh ist er aus einem Traum erwacht, von dem er gleich darauf nur noch wusste, dass sein Vater vor einer verschlossenen Kammer im Bauch der Bismarck gestanden hatte und mit der Hand über die Nieten auf dem Kupferring des Bullauges strich, im Kajütengang um ihn herum ein Gewirr aus Metallverstrebungen und Schläuchen im schaukelnden Licht, Bündel feuchter Leitungen wie Adern entlang der Decke, und irgendwo ratterte ein Zähler.
Richard träumt häufiger vom Vater, seit er all seine vertraulichen Aufzeichnungen nach entlastenden Aussagen durchforstet, Tagebücher, Briefdurchschläge. Erst hatte der Vater protestiert, aber Hellmut war aufgefahren, begreifen Sie denn nicht, die anderen legen schwere Dokumente auf die Waage, da bleibt uns bloß, Sie als Mensch verständlich zu machen! Zugestimmt hatte der Vater schließlich nur unter der Bedingung, dass Richard damit betraut wurde, Familienangelegenheit. Er liest Tagesnotizen, Kalendereinträge: 9. November 1941. Auf einem Spaziergang besann ich mich heute, wie unsre Kriegsziele zu beschreiben wären. Da schwimmt man freilich recht im Ungewissen herum. Auf welcher Grundlage des Erfolgs und mit welchen Regierungen kann man denn abschließen? Aber unabhängig hiervon und unabhängig von unsrer Begeisterung für den russischen Feldzug glaube ich, daß dieses tiefe Eindringen einer europäischen Macht in die Gefilde Rußlands gewisse gegenseitige Befruchtungen zur Folge haben wird, an die wir gar nicht dachten und die wir nicht wollten. Der Krieg ist bereits über uns hinausgewachsen. Wir haben ihn nicht mehr in der Hand. Das »Gesetz des Handelns«, das der Generalstäbler nach guter alter Lehre nicht dem Gegner überlassen darf, scheint mir zwar noch nicht beim Gegner, wohl aber in den geschaffenen Tatsachen zu liegen. Auf Urlaub von Richard im Winter rechnen wir nicht.
9. November 1941