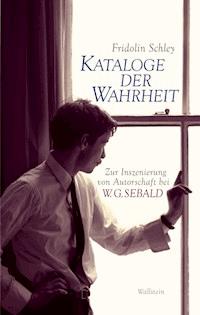3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Autorenedition Sarabande
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Bei diesen sechs Erzählungen stehen mir leicht in die Schräge gedrehte Welten vor Augen, in denen die Figuren um Selbstbehauptung ringen, um Haltung oder auch nur um festen Halt: Da ist eine Familie, die für die Mutter zum Geburtstag den Hamlet aufführt – bis plötzlich die Grenzen zwischen Spiel und Ernst verwehen und lang verdeckte Gräben aufreißen; da ist ein Mann, der vom Leben Abschied nimmt – und die groteske Vision einer Zukunft entwirft, in der die moderne Medizin eine Welt seliger Kranker erschafft; oder die junge Polin, die in tödliche Gefangenschaft gerät – und dort unversehens zur Schönheitskönigin avanciert. Mit unterschiedlichen Stimmen und historischen Bezügen kreisen die Geschichten aus »Die leuchtende Stadt« um das Verlorengehen und seine oft untergründige Verwandtschaft zur Erlösung. Menschen und Dinge geraten hier außer Kontrolle, eskalieren schleichend, verlieren ihren Zusammenhang und stabilen Grund. Doch auch Fallen fühlt sich an wie Fliegen, zumindest für einen kurzen Augenblick.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 71
Ähnliche
Fridolin Schley
Die leuchtende Stadt
Erzählungen
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Y-U-K-I-K-O
Autorenfoto: © Juliane Brückner
ISBN: 978-3-95607-010-5
Die Autorenedition Sarabande im Internet:
www.autorenedition-sarabande.de
Besuchen Sie den Verlag im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Fridolin Schley über »Die leuchtende Stadt«:
Oft wird bedauert – wie jetzt wieder im Kontext des Nobelpreises an Alice Munro – dass die literarische Form der Erzählung stark an Aufmerksamkeit verloren hat, beim Leser, bei Verlagen sowieso, und gerade in Deutschland, wo sie doch eine so besonders stolze Tradition habe. Ach, Hoffmann! Ach, Stifter! Ach, Kafka! Ich bedaure dieses Schattendasein der Erzählung nicht, im Gegenteil. Erst dort kann ihre eigene Qualität ganz gedeihen, jene des Wucherfeldes, des Experiments, des Versuchs. Die Erzählung ist die Möglichkeitsform der Literatur. Sie hat nicht das wuchtige Phlegma eines Romans und nicht das unmittelbare, kristallene Funkeln einer Kurzgeschichte. Sie ist eine Art Bastard mit offener, flüchtiger Form, weniger in dramaturgischer als in ästhetischer Hinsicht. So ist sie ständige Beflügelung und Herausforderung. Denn Autoren sollten sich nie zu sicher sein, was ihre Poetik angeht – und ihre Moral ohnehin. Im Möglichkeitsraum der Erzählung brodelt die Unruhe, jenes vorherrschende Identitätstemperament unserer Zeit. Diese Unruhe ist ein Kreisen in Möglichkeiten, das niemals ankommt, bei keinem Kern, keiner letzten Gewissheit. Ihre Form ist die Offenheit, ihre Laune die Neugier, ihre schöne Zwillingsschwester die Angst.
Bei den vorliegenden sechs Erzählungen stehen mir leicht in die Schräge gedrehte Welten vor Augen, in denen die Figuren um Selbstbehauptung ringen, um Haltung oder auch nur um festen Halt: Da ist eine Familie, die für die Mutter zum Geburtstag den Hamlet aufführt – bis plötzlich die Grenzen zwischen Spiel und Ernst verwehen und lang verdeckte Gräben aufreißen; da ist ein Mann, der vom Leben Abschied nimmt – und die groteske Vision einer Zukunft entwirft, in der die moderne Medizin eine Welt seliger Kranker erschafft; oder die junge Polin, die in tödliche Gefangenschaft gerät – und dort unversehens zur Schönheitskönigin avanciert. Es sind Gehversuche auf unsicherem Grund. In »Niemandsland« habe ich zum ersten Mal probiert, 'historische' Literatur zu schreiben, und zwar ohne jenen Staubgeschmack, der mich bei diesem Genre von jeher in die Flucht geschlagen hat. »Die Königin« war – zunächst nur, weil mir das Sehnsuchtswort KANADA nicht aus dem Kopf ging – der Versuch, über Auschwitz zu schreiben, und in der Titelgeschichte »Die leuchtende Stadt« wollte ich eine Form für etwas zu finden, dessen Inhalt ich buchstäblich nicht fassen konnte; man sagt wohl Trauer dazu.
Mit unterschiedlichen Stimmen und historischen Bezügen kreisen die Geschichten um das Verlorengehen und seine oft untergründige Verwandtschaft zur Erlösung. Menschen und Dinge geraten hier außer Kontrolle, eskalieren schleichend, verlieren ihren stabilen Zusammenhang. Doch auch Fallen fühlt sich an wie Fliegen, zumindest für einen kurzen Augenblick.
Vorwort
Foto mit Weihnachtsmännern
Es war am 25. Dezember 2010 in New York. Vielleicht befand sich mein Körper immer noch in Deutschland, auch wenn ich mittlerweile faktisch seit einem Monat in der Stadt vorhanden war – nachts fand ich kaum Schlaf, tagsüber hatte ich beim ersten Sonnenschein Klaus Kinski vor Augen, bei seiner Sterbeszene in Werner Herzogs Nosferatu. Das schönste und wärmste Morgenlicht, das man sich ausmalen kann, erfüllt nach und nach das Zimmer, in dem sich der Vampirfürst gerade über den bleichen Hals der schlafenden Isabelle Adjani hermachen wollte; der erste Strahl erfasst Kinskis Beine, er erstarrt, greift sich ans Herz, und hält mit einem fürchterlichen Seufzer, von dem man nicht weiß, ob er Entsetzen oder Erlösung bedeutet, die Luft an. An diesem 25.12., an dem es mir seltsam und plötzlich falsch, von Grund auf falsch vorkam, wie ein lebensgefährlicher Irrtum, dass man hier, nur durch ein paar Stunden und einen Ozean von Europa getrennt, Weihnachten morgens und nicht abends beging, an diesem Morgen, der so bitterkalt war, dass man schon bald seine Füße wie etwas Fremdes in Stiefeln spürte, platzte ich in eine Versammlung von Weihnachtsmännern. Als mich in einer Gasse zunächst zwei, drei Männer in rotem Samtanzug, mit Rauschebart und Zipfelmütze überholten, musste ich noch schmunzeln. Vielleicht Miet-Nikoläuse, die gleich die Kids einer reichen Familie überraschen würden, knock, knock, guess who’s there? Aber dann wurden es mehr, immer öfter passierte ich nun diskutierende, lachende, gröhlende Männer in Rot mit geschulterten Säcken, auf einer Parkband hielt einer ein Nickerchen, auf der Hauptstrasse, von der schon von Weitem das Gemurmel eines Menschenauflaufs zu hören war, leuchtete es zwischen den grauen Hochhäusern rot, rot überall, und flatternde weiße Bärte. Hunderte von Weihnachtsmännern standen da seelenruhig und unterhielten sich.
Es war hier, bei der mir und offenbar nur mir rätselhaften Versammlung der Weihnachtsmänner, dass ich für einen Moment zwischen den Kostümierten Fridolin Schley zu entdecken meinte, sehr flüchtig, dann war er auch schon fort, und mir fiel ein, dass er ja genau jetzt in New York wohnte (stimmte das?) und an seiner Doktorarbeit schrieb, so meinte ich mich jedenfalls zu erinnern, über den Schriftsteller W.G. Sebald. In diesem Moment, der nur ein paar Sekunden dauern konnte, musste ich an die seltsamen Koinzidenzen denken, die mich im Lauf der vergangenen zehn, fünfzehn Jahre immer wieder mit Fridolin Schley bis auf einmal immer beinahe, um Haaresbreite zusammengeführt haben, sodass es fast schon einer seltsamen Logik folgte, dass wir uns hier, zwei gleichaltrige Münchner Autoren in Manhattan, zwischen Nikoläusen über den Weg laufen sollten. Als ich 2001 den von der Münchner Universität organisierten Creative-Writing-Kurs »Manuskriptum« besuchte, war Fridolin Schley in aller Munde, weil er der erste »Manuskriptum«-Autor gewesen war, der erfolgreich veröffentlicht hatte, den Debütroman »Verloren mein Vater«. Ein paar Jahre später gab es in einem Seminar über W.G. Sebald nur mehr wenige freie Plätze und ich setzte mich neben einen Kommilitonen – der sich schnell als Fridolin Schley herausstellte; wir entdeckten, dass wir beide über Sebald promovierten und mussten über den Zufall lachen, dass wir uns ausgerechnet hier trafen, und wahrscheinlich wären wir von da an auch ins Gespräch gekommen, wenn nicht einer von uns nicht mehr ins Seminar hätte kommen können. Anschließend arbeitete ich im Lektorat des C.H. Beck Verlags zu einer Zeit, in der Fridolin Schley gerade beim Berlin Verlag im Lektorat arbeitete und ich von den Vorbereitungen für seinen Erzählband »Wildes schönes Tier« hörte. Und so ging es weiter: Mal ein Hinweis in einem Buch, in diesem Fall Ingo Schulzes »Neue Leben«, an dessen Ende auch Fridolin Schley gedankt wurde, dann eine seltsame Gemeinschaftslesung von etwa 50 Autoren, bei der Fridolin die auch im vorliegenden Band enthaltene Geschichte »In die Tiefe« vorlas, ohne dass wir uns im nächtlichen Trubel danach trafen, dann die Erzählung eines Freundes, dass Fridolin Schley zu einem Zeitpunkt in New York sei, zu dem ich mich auch dort aufhielt; dann 2012 die Veröffentlichung seiner wichtigen Arbeit zu Sebald, Kataloge der Wahrheit …
Wäre ich fanatischer Sebaldianer, ich würde von an Schicksal grenzenden Zufällen sprechen, sodass dieses Vorwort eine gewisse, sinnfällige Zwangsläufigkeit besitzt. Was mich an Fridolin Schleys Texten, seinen beiden Romanen und dem Erzählband, fesselten, und ich glaube, das ist hier tatsächlich das richtige Wort: fesselten, war ihre scheinbar mühelose Art zu erzählen, und zwar so spannend und so logisch, dass es einen bannt. Diese innere Logik der Erzählungen, der Drive, den sie entwickeln, ohne dass auf billige äußere Effekte Wert gelegt wird, steht im Kontrast zu den meistens unerhörten Begebenheiten, von denen uns hier berichtet wird, das unerwartete Gespräch mit dem traurigen Türsteher in »Leere Räume erinnern sich an uns«, die zynische Modenschau in einem Straflager in »Die Königin« oder die Visionen von einer »leuchtenden Stadt« in der den Band beschließenden Titelerzählung. Das macht den großen Reiz dieser Texte aus: wie hier dem Unerhörten, Außergewöhnlichen, das ausnahmslos tragischen Charakter hat und von großer Traurigkeit über die Vergänglichkeit der Dinge geprägt ist, durch die erzählerische Form ein bleibender Sinn, eine tiefere Logik gegeben wird. »Kein anderes Ziel als das beruhigende Verpacken der sich ständig einem entziehenden Welt in übersichtliche Geschichten, in verstehbare Einheiten verfolge natürlich auch der Schriftsteller.«, heißt es in »In die Tiefe«.