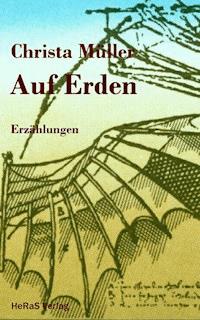Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fast unmerklich haben sich die Rollen vertauscht: Jetzt ist es der Sohn, der den schwereren Ruckack trägt und größer und stärker ist als die Mutter. Unmissverständlich sind die Zeichen, die auf Veränderungen deuten. Eine gemeinsame Wanderung im rumänischen Hochgebirge bestätigt es: Die Loslösung des Sohnes hat begonnen. Und ist es an ihr, der Mutter, ihn freizugeben aus der engen Bindung, die ihr Schutz war gegen Ängste und Einsamkeiten. Sie glaubt, keine Furcht zu haben vor dem Moment, in dem der Sohn beginnen würde, Wege zu gehen, die ihn von ihr wegführen. Aber später dann, im Alltag, erlebt sie die Trennung voller Konflikte und Verletzungen. Und brüchig geworden ist auch ihre frühere Sicherheit, die sie solange trug, wie sie eigene Lebenswünsche verleugnete. Sie wehrt sich, wenn wieder Rücksicht von ihr verlangt wird und Einsicht im Namen der Vernunft und der Verantwortung. Sie übt: sie trainiert den Ungehorsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christa Müller
Die Verwandlung der Liebe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
I
II
Von Christa Müller bei uns erschienen
Impressum neobooks
I
"So war es nicht!"
"So war es nicht?"
Er war gerade achtzehn geworden. Wir brachen im Regen auf. Es war ein gewittriger Juli. Als wir nebeneinander zur Straßenbahn liefen, fiel mir ein, dass sein Lehrmeister damals gesagt hatte: Er wird ein breites Kreuz und ein paar ordentliche Schultern kriegen ... Ich drückte Julian den Schirm in die Faust, deren Bräune wie immer mit Gips gesprenkelt war, und hing mich an seinen Arm. Mein Kopf reichte knapp an seine Schulter. Sein Rucksack war schwerer als meiner. Das hinderte ihn nicht, auszuschreiten.
Julian war groß und kräftig geworden.
Als er noch ein Knabe war, der unter meine Achsel passte, trug ich den schwereren Rucksack. Auf Wanderungen, bei denen man nicht zum Ausgangspunkt zurückkehrt, sondern seine Schlafstatt jede Nacht an anderer Stelle richtet und so Tag für Tag, Schritt für Schritt einem weit gesetzten Ziel sich nähert.
Die Zugfahrt nach Schönefeld überstanden wir im tropischen Klima eines mit durchfeuchteten Menschen überfüllten Wagens. Kein Fenster ging zu öffnen. Durch trübes Glas stach die Julisonne vom aufgerissenen Himmel.
Der Flug nach Bukarest dauerte eine Stunde und achtunddreißig Minuten. Anderthalb Stunden lang sahen wir aus dem Bullfenster strahlend blauen Himmel und eine gleißende Sonne. Unter uns türmten sich Wolkengebirge von weißer bis blauschwarzer Färbung. Die letzten acht Minuten vergingen im Blindflug durch undurchdringliche Schwärze, in der die Maschine geschüttelt wurde wie im Windkanal beim Test, bis sie doch die Landebahn in Otopeni traf und aufsetzte, ohne zu straucheln, begleitet von Blitz und Donner.
Wir wussten, dass wir am Gebirge entlang fuhren. An den Haltepunkten stiegen durchweichte Wanderer in den Zug. Nebel stand zwischen Himmel und Erde, so gleichmäßig, dass er Erde als auch Himmel hätte sein können.
Ich hatte Julian überredet hierher zu fahren. Das war nicht schwer gewesen. Der Fogarash gehört zu den Karpaten, deren westlichen Teil, die Tatra, wir neun Monate lang durchwandert hatten: einen Monat pro Jahr. Es war längst Zeit, ihr östliches Gegenstück zu erkunden.
So sagte ich.
Und hatte doch einen anderen Grund.
Spät am Abend langten wir in Sibiu oder Hermannstadt, wie Georg seine Geburtsstadt nannte, an. Es goss noch immer.
Ich war froh, dass er mir die Adresse des Hauses gegeben hatte, in dem seine Mutter und seine Schwester mit ihrer Familie wohnten.
Sie nahmen uns freundlich auf.
Das Haus seiner Kindheit! Über diese Treppe schlich er hinab vor Morgengrauen, über den knirschenden Kies des Gärtchens, mit bloßen Füßen, die Schuhe in Händen.
Im vergangenen November saß er mit mir in einer Reihe im Zuschauersaal des Leipziger Capitols, drei leere Plätze von mir entfernt. An jenem ersten Vormittag der Dokumentarfilmwoche lief auch dieser Film: In einem rumänischen Bergdorf errichtete ein junger Bursche auf einer grünen Wiese ein hölzernes Tor, reich mit Schnitzerei verziert, versehen mit einem Dach.
Wer hier ein Haus baut, sagte der Kommentar, baut seit Jahrhunderten zuerst das Hoftor. Denn durch das soll man eintreten, zuerst und immer.
Der Mann, drei Plätze entfernt von mir, wischte sich mit der Hand übers Gesicht.
Im "Thüringer Hof' aßen wir zufällig am selben Tisch. Ich fragte, was an jenem Film ihn so berührt hatte.
Schwer, sich abzureißen, sagte er.
Er lebte seit ein paar Jahren in München.
Nun blickte seine Mutter mich mit Augen an, die wie seine waren. Noch ähnlicher sah ihm seine Schwester. Sie hatte seinen Mund, sein Lachen.
Der Regen stürzte über die Stadt und das Haus, hinter dessen Tür wir die Schuhe und Regenumhänge ausgezogen und die Rucksäcke abgestellt hatten.
In solches Wetter jagt man keinen Hund hinaus, sagte Georgs Schwester. Bleibt aber weg vom Fenster, die Nachbarn müssen euch nicht sehen!
Zwei kleine Mädchen blickten verstohlen auf Julian, um dann miteinander zu tuscheln.
Julians schwarze Locken kringelten unter dem weißen Filzhut hervor, den er nicht abgesetzt hatte. Seine Wangen, noch rund wie in der Kinderzeit, zeigten ihre Grübchen, wenn er lächelte. Das Kinn war noch nicht so spitz wie heute, am Hals der Adamsapfel noch nicht ausgebildet. Auf seiner bronzefarbenen Haut krausten sich die allerersten Härchen des noch heute schütteren Bartes, Erbteil seines Vaters, der ein Halbblut und fast bartlos war. Seinen Mund hatte noch niemals Bitterkeit verschlossen, und er lachte die Kinder an. Seine Augen, in grenzenlosem Vertrauen auf das eigene Vermögen, leuchteten golddunkel. Dass wir nicht in den Regen hinausmussten, sondern über Nacht dabehalten wurden, denke ich, war auch und zumeist eine Folge dieses Leuchtens.
Die Mädchen baten ihre Großmutter, die Nacht bei ihr schlafen zu dürfen, damit Julian und ich in ihren Betten liegen konnten, so sehr wir beteuerten, der Fußboden genüge uns.
Anderntags erledigten wir das Notwendige, das zu tun blieb, ehe wir ins Gebirge aufstiegen. Wir kauften Benzin für den Kocher, suchten nach sicher schließenden Plastflaschen, trieben keine auf und füllten es in eine Glasflasche, für die Julian einen Korken passend schnitzte. Ich misstraute dem Provisorium, deshalb nahm er sie selbst in Obhut. In den Buchhandlungen suchten wir nach einer Wanderkarte, und währenddessen hielt der Himmel alle Schleusen offen.
Wir sahen die Störche in ihren Nestern auf den Biberschwanzdächern der mittelalterlichen Häuser. Und hörten auf, sie zu zählen, als wir in den verwinkelten Gassen und Gässchen den Überblick über die Lage der Dächer verloren.
Vor dem Regen retteten wir uns in die Kathedrale gegenüber dem Deutschen Gymnasium. Was in ihr geschrieben stand, war in deutscher Sprache, und die dort beteten, sagten laut und deutlich: Vater unser, der du bist im Himmel!
Das Deutsche Gymnasium bereitete seine 400-Jahr-Feier vor. Die Mädchen, Georgs Nichten, besuchten es im ersten und vierten Schuljahr. Georg hatte dort sein Reifezeugnis bekommen. Es war ein großes, weißes, fast schlossartiges Gebäude mit kolonnadenartigen Fensterbögen. Den Platz zwischen Kirche und Gymnasium füllte Katzenkopfpflaster, in dessen Zwischenräumen Gras und Moos wuchs.
Ganz plötzlich hörte der Regen auf. Gewaltig brach die Sonne durch die Wolken, und die Nässe verdampfte. Einen Augenblick lang spürte ich das Verlangen, mich niederzulegen, meinen Leib gegen dieses Pflaster zu drücken, das Moos zu berühren, das Gras, die Stätte der Kindheit eines Mannes, der sie aufgegeben hatte. Aufgegeben. So sah ich es. Sich abgerissen. So hatte er gesagt. Und: Das ganze Leben ist ein sich abreißen. Abgerissen werden und Festgehalten sein. Festhalten und Abreißen.
Ich sah Julian mit hellen Augen zum Himmel blicken und hörte seine Freude: Wir können heute noch losgehen!
Georgs Schwager brachte uns in ein entlegenes Tal, in dem die asphaltierte Straße in einen schlammigen Holzweg endete. Die Mädchen schwirrten wie zwei Schwalben aufgeregt um Julian, der wie ein exotischer Vogel zwischen ihnen stand, mit rotem T-Shirt, weißem Hut, dunkelblauen Kniehosen, braunen Waden und mit der riesigen und schweren kornblumenblauen Kraxe auf dem Rücken. Sie verlangten, ihn zum Abschied zu küssen, und verlegen beugte er sich hinab und bot ihnen seine Wange. Aber die Kleinere küsste seinen Mund. Seine Augen wurden schwarz und seine Stirn dunkel. Abrupt wandte er sich um und stapfte los. Wir lächelten uns an, der Mann und ich, mit der törichten Abgeklärtheit Erwachsener. Ich streichelte die Kinder, bedankte mich und folgte meinem Kinde.
Der Versicherung, dass von diesem Tal her der Aufstieg zum Kamm sanfter sei als von der Suruhütte oder zu ihr hin, glaubten wir nur die ersten zwanzig Minuten. Der Weg endete vor einem Steilhang.
Es war sechs Uhr abends. Spätestens in vier Stunden mussten wir einen Platz gefunden haben, auf den wir das Zelt stellen konnten.
Julian trat zwischen die jungen Buchenstämme, die nicht stärker als seine Fußknöchel waren und nur zweimal so groß wie er, aber sie standen so dicht, dass er sich zwischen den Stämmen hindurchschlängeln musste, indem er sie wegen der Breite seiner Kraxe mit den Armen auseinanderbog und tief hängende Zweige aufhob. Dabei versank er bis an die Knie im Laub vergangener Jahre, das nach den Regengüssen den Hang in eine glitschige, abschüssige Bahn verwandelte.
Ich folgte ihm. Nach zehn Minuten waren wir schweißgebadet, und Myriaden winziger Fliegen stürzten sich auf uns. Wir atmeten sie mit offenen Mündern ein und fühlten sie in unseren trocken werdenden Rachenhöhlen. Das Gezweig peitschte meine nackten Arme, schrammte die Haut. Ich fluchte. Julian blieb stehen, wartete auf mich, bog mir an besonders filzigen Stellen ritterlich die Stämme oder Zweige zur Seite und zog mich mit seinen Händen ein Steilstück hinauf. Seine gute Laune blieb unverändert. Ungefähr nach einer Stunde, er befand sich ein paar Meter über mir, hörte ich ihn lachen. Er stand auf einem ausgetretenen Pfad, der sich in sanfter Steigung den Hang hinaufzog. Wir hatten ihn unten verfehlt. Hundert Meter weiter rasteten wir. Auf einem gestürzten Stamm, mannsdick und so verwittert, dass wir in ihm den Stammvater dieses jungen Waldes sahen.
Jemand kam. Rasch, trotz der Steigung. Ein weißes Jersey leuchtete vor dem dämmrigen Wald. Zehn Schritte vor uns erkannte ich: Er war in Julians Alter.
Die braunen Wangen und sein Kinn noch gänzlich bartlos. Sein dichtes Haar, kurz geschnitten und glatt, lag den Schläfen an, ließ die Ohren frei und die Stirn zur Hälfte, weil es seitlich gescheitelt war. Er blieb vor uns stehen und lächelte mit zwei Reihen kräftiger Zähne, und seine Augen blieben sofort bei Julian und die Julians bei seinen. Er fragte rumänisch. Julian lachte ihn an und sagte: Wir sind Deutsche. Germans. East-Germans.
You speak English? fragte der Junge.
Little, antwortete Julian.
Ein Dialog begann. Ich verstand, dass Mihai, so hieß er, die gleiche Tour vorhatte wie wir, dass er fast zur selben Zeit wie wir seinen Aufstieg begonnen hatte, dass er sagte, es werde bald dunkel, und man müsse schauen, vor Einbruch der Nacht ein Dach über dem Kopf zu haben. Julian stimmte ihm zu, und Mihai bedeutete ihm, er werde vorausgehen, eine Schäferhütte ausfindig zu machen. Plötzlich besann sich Julian, wies auf mich und sagte: My mother. Montag, sagte ich, und Julian übersetzte: Monday! Unser Name, setzte er englisch hinzu und lachte. Monday? Mihai vergewisserte sich. Montag! sagte ich. Dorothea!
Mihai verbeugte sich artig.
Wir gelangten zur Baumgrenze. Ich fühlte das Blut in meinen Schläfen hämmern und den wohlbekannten, gefürchteten Druck im Schädel, der mich die ersten Tage in solcher Höhe immer heimsucht.
Julian, als er mich hinter sich her schleichen sah, war im Bilde. Er rief mir zu, dass er vorausgehe, um das Zelt aufzustellen und Wasser zu suchen. Das war vernünftig und fürsorglich und nicht zum ersten Male so.
Aber es drängte sich ein Unbehagen in mein Gefühl, als er weit oberhalb von mir in den Wellen der hinaufstrebenden Alm noch einmal sichtbar wurde - als Schattenriss gegen den violett werdenden Himmel - und ohne sich umzublicken, weitereilte. Ich hatte das Empfinden, er renne, dem Fremden zu folgen, und vergäße, auf mich zu achten, die ich kommen würde, wenn der Himmel nachtdunkel war. Es packte mich eine verzweifelte Angst. Ich schrie seinen Namen. Die Luft verschluckte ihn wie das Tageslicht.
Der Pfad verlor sich zwischen Gras und Gestein, und ich dachte, dass es ein Fehler war, die Taschenlampe unten im Rucksack zu haben, sodass ich Julian kein Lichtsignal senden konnte.
Ich bemühte mich, trotz des Dampfhammers in meinem Schädel, voranzukommen. Der Kopfschmerz trieb mir Tränen in die Augen.
In jenem Moment, als ich glaubte, Julian nicht mehr finden zu können, stieg der halbe Mond über den Bergrücken. Und ich sah, nur zwanzig Schritte von mir entfernt, unser Zelt, seine gelbe Seide vom Monde durchleuchtet. Ich hörte Schritte hinter mir. Sie kamen rasch. Julian hatte Wasser geholt. Na? sagte er und nahm mir meine Kraxe vom Rücken, huckte sie sich auf und trabte, den Wasserkanister in der Hand, zum Zelt.
Als mein Rücken frei war von der Last, spürte ich, dass ich mit ihr keinen Schritt mehr hätte tun können. Mein Kopf schien die Dimension des Mondes anzunehmen, um zu zerspringen.
Als ich am Zelt anlangte, hatte Julian schon unsere Matten ausgelegt, die Schlafsäcke ausgerollt.
Mach dich lang! sagte er.
Ich schloss die Augen. Die Geräusche, die hinter meine Stirn drangen, während der Schmerz verebbte, gaben Kunde von Julians Tun.
Die Gasflamme fauchte kräftig. In diesem Geräusch versammelten sich Erinnerungen an die glücklichen Abenteuer mit Julian, einen langen Zeitraum fassend, mit dem genauen Empfinden, geborgen zu sein. Das kleine Ding aus Blech, kaum größer als Julians Faust, das einen rauschenden blauen Flammenkranz um seinen Brenner legte, machte den Ort heimisch.
Ich hörte Julian hantieren. Er riss die Schachtel mit dem Würfelzucker auf. Der Topfdeckel klapperte. Hinter geschlossenen Augenlidern sah ich ihn Zuckerstücken in das perlende Wasser zählen, das sich von den Teebeuteln dunkel färbte.
Der Kocher verstummte.
In der Stille klang etwas. Ich fühlte es im Körper, noch ehe sich die Ohren damit füllten.
Die Erde erzitterte unter einem raschen, leisen, stetig anschwellenden Trommelwirbel, in den sich ferne, helle Glocken mischten, die lauter wurden, je dröhnender die Trommeln kamen. Beunruhigt richtete ich mich auf. Julian stand draußen und blickte gespannt über das Zelt. Wir vernahmen Rufe aus rauen Kehlen und wildes Hundegekläff.
Ich kroch ins Freie.
Über den Berg zog mondbeglänzt eine riesige Herde Schafe. Unser winziges Zelt stand nur wenig entfernt von ihrer gewaltigen Trift. Eine Gestalt kam mit ausgreifenden Schritten und wehendem Mantel zu uns her.
Wir verstanden kein Wort und versuchten, keine Furcht zu haben. Das Mondlicht zeigte mir ein bartloses Jungengesicht mit starken Jochbeinen, die schwarzen Augenbrauen wie ein mächtiger, durchgängiger Balken von Schläfe zu Schläfe gesetzt und unter ihnen helle, genaue Augen, die alles wahrnahmen an uns und die doch pechfarben waren. Seinen Krummstab schwingend, umkreiste er das Zelt, befühlte den Stoff. Wir waren gebannt. Der Teekessel erregte seine Neugier und dessen Hitze sein Erstaunen. Er redete laut auf uns ein, und weil er begriff, dass wir nichts verstanden, gestikulierte er wild, warf die Arme zum Himmel, ließ sie herabfallen, tat Schritte, die waren wie Tanz, deutete mit der Geste seiner unter die Wange gelegten Hände Schlaf an.
Jemand rief ihn, barsch und keinen Widerspruch duldend. Er sprang sofort der Herde nach, die inzwischen vorübergezogen war und deren Trommeln und Läuten nun abschwoll, sich verlor, bis die Nacht hell und still um uns lag.
Wir setzten uns nieder, spürten, dass Tau gefallen war - ein gutes Zeichen für den kommenden Tag, tranken Tee und aßen von dem Schwarzbrot, das wir von zu Hause mitgebracht hatten. Die Kerze brannte, ohne zu flackern.
Mein Kopf war leicht geworden. Ich fühlte mich, als könnte ich, wenn ich es nur wollte, fliegen.
Ich war glücklich und müde und freute mich auf das Atmen Julians neben mir.
Über die Alm kam eine helle Gestalt. Gleichzeitig erkannten wir Mihai.
Er kauerte sich bei uns nieder, überbrachte die Einladung der Hirten, bei ihnen zu schlafen. Unter einem Dach vor dem Regen, mit einem Feuer gegen die Kälte. Und es gäbe Milch und Käse.
Der junge Hirt hatte es uns schon zu sagen versucht.
Wollen wir? fragte Julian mich. Ich hörte, dass er Lust hatte.
Nein! sagte ich.
Okay, sagte Julian und erklärte Mihai, dass unser Zelt gut sei für diese Nacht und dass wir danken und bitten, sie möchten es uns nicht verübeln.
Ich träumte von einem Glockenspiel. Hell, glitzernd und sehr fern. Erwachte, und es war dunkel. Schafe blökten. Dringlich. Zudringlich, Unablässig. Ich lag und wartete auf das Trommeln ihrer Füße - aber es stellte sich nicht ein.
Mit der Taschenlampe leuchtete ich das Zifferblatt an: vier Uhr. Ich wand mich ins Freie.
Der Mond war untergegangen. Groß und nah blinkten die Sterne. Die Aufregung in der Herde nahm zu. Eimer schepperten, Hunde kläfften. Alles in ziemlicher Entfernung. Gott sei Dank, dass wir nicht dort genächtigt hatten. Julian schlief fest.
Als ich zum zweiten Mal erwachte, erblickte ich durch den offenen Zelteingang die im blauen Morgendunst verschwimmenden Seitenkämme des Fogarash, sanft abfallend, bewaldet und dahinter in erstarrten Riesenwellen das Sibingebirge.
Der Tau auf den Gräsern blitzte auf, und wie ein Signal fuhr dieses Licht in meine Glieder.
Im Nu stand ich draußen. Die Sonne blinzelte, weißglühend schon um sechs Uhr morgens, hinter der mit Milliarden Tropfen besetzten Bergweide herauf.
Ich holte meine Sonnenbrille. Julian lugte mit einem Auge aus dem Schlafsack. Der Tag ist da, und was für einer! sagte ich. Julian öffnete sein zweites Auge auch. Lauschte dem Geblök der Schafe, das noch immer dauerte, stieß einen zufriedenen Seufzer aus: 0 Mann! streckte und rekelte sich. Er brauchte dazu die gesamte Länge des Zeltes (ich sah es zum ersten Male) und schlüpfte dann aus seiner Schlafhülle wie ein Falter aus seiner Puppe.
Wir badeten im Licht. Im Tau. In einer Luft, die kühl war und glänzte. Nach einer halben Stunde schon ließ die Sonne, die unablässig höher stieg, keinen Zweifel zu, dass der Tag heiß werden würde. Die Feuchte auf der Zeltseide trocknete vor unseren Augen.
Wir hatten vor, den Kamm nicht zu verlassen und in der kommenden Nacht am Lac Avric, am Frecker See, zu schlafen.
Der Hauptkamm verläuft von Westen nach Osten.
Die Sonne im Gesicht, zogen wir los.
An allen Tagen würde das so sein, dachten wir.
Mihai holte uns ein. Seine buttergelbe Kraxe schien gewichtslos. Sein Jersey war nicht im mindesten verschwitzt.
Good morning, sagte er, bremste sein Tempo und blieb neben Julian.
Die Jungen lachten einander zu.
Wir stiegen noch immer an. Aus dem Gras wuchsen flechtenbewachsene Granitplatten. Ich ging an Julians anderer Seite. Bis auf den ersten Gipfel. Siebzehn Meter fehlten ihm zum Zweitausender. Auf seiner breiten Kuppe war ein Steinmann aufgeschichtet, groß wie ein Mensch und dick wie ein Holzstapel.
Julian und ich setzten unsere Kraxen ab, um zu verschnaufen.
Das Gespräch zwischen den Jungen hörte nicht auf, und ich staunte, wie viel Englisch Julian plötzlich zur Verfügung hatte.
Mihai war Rumäne ungarischer Nationalität und besuchte das Gymnasium in Cluj-Napoca. Er kam zu Fuß von dort. War übers Bihar-Gebirge zum Olt-Tal gewandert, und ebendort, wo der Fluss seine scharfe Biegung von Osten nach Süden vollbringt, war er, wie wir es ursprünglich wollten, zum Kamm des höchsten Gebirges im Karpatenbogen, dem Fogarash, aufgestiegen. Er wollte bis ans Schwarze Meer laufen.
Julians Wangen glühten vor Verlangen, Gleiches zu tun.
In Mihais Augen las ich, dass er sich Julian als Weggefährten wünschte.
Vor uns, im Sattel, tauchte die Hälfte eines riesigen Fußballs auf: die Biwakschachtel, das Refugio, das die Karte verzeichnete, übermannshoch, auf festem Betonsockel aus weißen, blauen, braunen und orangefarbenen Sechsecken zusammengefügt. Tür und Fenster sturmsicher, bot es zur Not einem Dutzend Menschen Schutz.
Die Sonne knallte drauf. Drinnen war es stickig.
Neben dem Eingang überragte eine schwarz-weiße Stange mit dem Staatswappen die Kuppel.
Übermütig trommelten die Jungen mit Fäusten ihre Lebenslust in den überdimensionalen Resonanzkörper, warfen sich Namen und Titel aus der Musikszene zu.
Julian hatte plötzlich seine Piccolo-Mundi zwischen den Lippen, und deren Seufzer und Schreie kommentierten die Rhythmen.
Die Sonne stand über uns. Der Abstand zwischen mir und den Jungen vergrößerte sich. Julian hielt mit Mihai Schritt.
Der zweite Tag einer solchen Wanderung ist der schwerste, und gewöhnlich erklärten wir den dritten zum Ruhetag.
Ich fühlte mich gut. Spürte, wie mich das Gehen lockerte. Wie die Spannung sich löste, unter der ich in den letzten Wochen im Studio stand, konfrontiert mit den Ergebnissen monatelanger Mühe.
Mit jedem Schritt blieben die Bilder zurück, wurden undeutlicher, sanken ins Gras, versanken ...
Worte tauchten auf, die ich nicht abwies.
Grünes Blatt, drei Blumen rot.
Junger Hirt mit weißem Lamm,
wo erwartet dich der Tod?
Hoch auf wildem Bergeskamm
wo der Sturmwind saust
in den Fichten braust.
Welcher Tod erwartet dich?
Als es blitzte, traf es mich.
Wer sang dir die Klagelieder?
Vögelein im Graugefieder.
Und wer wusch dich weiß und rein?
Ach, es regnet dicht und fein.
Wer gab dir das Totenleinen?
Mond mit seinem hellen Scheinen.
Wer hat Kerzen dir gebrannt?
Sonne, die im Mittag stand.
Und wer hat begraben dich?
Fichten stürzten über mich ...
Verse, die ich in Georgs Vaterhaus vorm Einschlafen gelesen hatte, als ich ein Schullesebuch in die Hand nahm.
Die Verse bestimmten mein Schrittmaß, wirkten im Unterbewusstsein, kehrten immer wieder, klingend, drängend, fragend. Manche mit Tönen besetzt.
Ich fühlte mich zu einem Erinnern hingezogen, das heraufdämmerte und fahlen Glanz vorausschickte.
Weit vor mir leuchtete die blaue Kraxe neben der gelben. Wind machte die Himmelsglut erträglich.
… Und wer hat begraben dich?
Unhörbar blieben meine Schritte auf dem kurzen harten Gras. Kein Vogelruf, nur Wind.
Schäferin, ach, wie haben sie dich so süß begraben ... Und ich sah die Gesichter Ulrichs und suchte sie zu verbannen. Sie gehorchten nicht. Ich tat vor mir, als interessiere mich die Behandlung des gleichen Themas (Begräbnis des Hirten, der Hirtin) in der deutschen Romantik und in der rumänischen Volksdichtung - und wusste: Ich wollte mich an den Mann nicht erinnern.
Zuerst war es gegenseitige Hilfeleistung. Ich brauchte einen Babysitter, und Ulrich brauchte Geld, er war ein Dichter ohne Einkommen. Julian war ein Jahr alt.
Ich hatte die Hochschule absolviert und erfuhr als Assistentin eines berühmten und auch berüchtigten Regisseurs, was alles ich an der Hochschule nicht gelernt hatte. Ich war sehr ehrgeizig. Es war ihm leicht, mich auszubeuten. Ich arbeitete zwölf bis sechzehn Stunden. Ich wusste Julian in Ulrichs Obhut.
Julian liebte ihn, und eines Tages liebte auch ich ihn.
Er ging sehr aufrecht und war sehr stolz. Darin glich er Julian Cortez.
Julian hat keine Erinnerungen an seinen Vater als jene, die durch mich auf ihn kamen. Ein Jahr nach der Geburt seines Sohnes ging Julian Cortez zurück nach Lateinamerika. Danach erreichte uns noch ein Brief, in dem er mitteilte, wir würden lange Zeit ohne Nachricht bleiben - und er bäte mich, zu sorgen, dass sein Julian, wenn die Zeit gekommen sei zu lieben, Mut dazu habe.
Julian Cortez' Liebe! Ohne Zögern hatte er sich für die Revolution entschieden und mich mit Julian, seinem Sohn, allein gelassen.
Er war verschollen.
Ob Julian sich an Ulrich erinnern könnte?
Nachdem auch er uns verlassen hatte, sprachen wir nicht mehr von ihm. Der Dreijährige fragte nicht nach jenem Mann, der seinen Schlaf gehütet hatte, der ihn auf seinen Schultern reiten ließ, der ihn laufen und sprechen lehrte.
Es gab Nächte, da schrie er im Schlaf, und ich nahm ihn in meine Arme, wiegte und streichelte ihn.
Und es gab Nächte, in denen ich weinte, und das Einzige, das mich in meiner Verzweiflung tröstete, war Julians Gegenwart, wenn ich ihn an mich drückte und mich ausweinte.
Ich spürte in seinem Körper das stumme Staunen über meine Erschütterung. Er wurde ganz still, drückte sein heißes Gesichtchen in meine Halsgrube, und ich spürte sein Herz hart gegen seine Rippen schlagen.
Seitdem saß er, wenn ein Mann allein mit mir in meinem Zimmer war, das geschah bei gemeinsamer Arbeit nicht selten, auf meinem Schoß. Still und bestimmt jedem bedeutend: Hier ist mein Platz.
Er behütete mich. Ich ließ es zu.
Ich wusste, dass Ulrich verheiratet war. Was ich lange nicht wusste, war, dass seine Frau, gequält von Misstrauen, ein paarmal nächtens gekommen war.
Der Umstand, dass Ulrich mein Bett benutzte, reichte zur Szene.
Und Julian muss es mitbekommen haben. Ulrich sagte, er habe plötzlich in der Tür gestanden und auf die schreiende, für ihn fremde Frau geblickt, die seinen Uli mit einem Gegenstand bedrohte, um den er mit ihr kämpfte.
Das war jene Nacht, nach der ich mein Kind morgens im Erschöpfungsschlaf auf der Treppe fand, vor zugeschlagener Wohnungstür, schmutzig bis zur Unkenntlichkeit.
Mein Zimmer sah aus wie nach einer Orgie, und Ulrich war abwesend.
Als er kam, um nach Julian zu sehen, war er bleich und trug auf der Stirn eine blutige Schramme. Ich war zu erzürnt, um ernsthaft nachzufragen, und machte ihm meinerseits eine Szene. Julian war im Nebenzimmer, dem Kinderzimmer, und bekam bestimmt auch die mit.
Ich sah Flecken auf Ulrichs Wangen, hektische Röte. Ich legte das Geld auf den Tisch, seinen Lohn.
Er steckte es in seine Jacke und sah mich nicht an. Seine Wimpern beschatteten die durchsichtige Haut der unteren Augenpartien, und diese Lider schienen mir in jenem Augenblick von solcher Zartheit, dass mir das Herz wehtat. Aus seinen Lippen war alles Blut gewichen. Er sagte kein Wort und ging.
Er hatte im Wald eine Granate gefunden und hinter seinen Büchern aufbewahrt, ahnungslos, ob ihr Zünder noch funktionierte. Seine Frau hatte sie dort weggenommen, in der Absicht, seinen Treuebruch zu strafen. Um diese Handgranate kämpfte er mit ihr, als Julian ins Zimmer gekommen war. Er musste seine Frau in jener Nacht aus meiner Wohnung bringen und, weil sie außer sich war, bei ihr bleiben.
Da passierte es, dass Julian auf die Treppe lief - und die Tür schlug zu.
Ulrich ging zu dieser Tür hinaus. Ohne sich umzublicken.
Ich könnte jetzt noch einen Scherenschnitt davon anfertigen, so hat sich mir sein Profil in jenem Moment eingeprägt.
Ich versuchte, die Erinnerung an ihn zu verbannen.
Eine Schallplatte, die von ihm geblieben war, Balladen, darunter jene vom Begräbnis der Schäferin, konnte ich nie mehr finden, obwohl ich sie unter meinen Platten wusste.
Ich hatte die Jungen aus den Augen verloren.
Das Terrain neigte sich. Am Nordhang, aus dunkelblauem Wald heraus, über die Alm hinauf zum Sattel, schlängelte sich ein Pfad. Julian und Mihai warteten hier auf mich.
Sieh mal! sagte Julian. Ich folgte seinem Blick. Auf dem Seitenkamm stand auf einer Lichtung weit unter der Waldgrenze ein Haus. Die Suru-Hütte, wären wir zu ihr aufgestiegen, hätten wir Mihai vermutlich nie getroffen. Das dachte ich ein paar Tage später.
Wir gingen auf der Südseite unterhalb des Kammes weiter.
Als Julian den Steig gewahrte, der zur Suru-Spitze ausbog, dem ersten Zweitausender auf dieser Tour, schlug er vor, zu rasten und danach hinaufzusteigen. Es war Mittag.
Mihai förderte ein in weißes Leinen geschlagenes Brot aus seinem Kraxensack, ich eins der schwarzen Kastenbrote, die so schwer in unseren Säcken lagen.
Mihais weiß ummantelte Salami war aus Ungarn. Unsere stammte vom Fleischer in unserer Straße.
Der Wind wehte kräftig. Wir mussten achtgeben, dass er uns nichts davontrug. Wir beschwerten die gefährdeten Dinge mit Steinen - aber er bemächtigte sich unserer Witterung.
Zunächst erschien auf flinken Pfoten ein kleiner, weißer, zottiger Hund, der uns rasch und stumm umrundete. Georg hatte gesagt: Vor den Hunden musst du dich sorgen. Du brauchst dir nur ihre Zähne anzuschauen. Sie müssen es mit Wölfen aufnehmen. Güte ist sinnlos und Angst dein Verderben. Sie folgen nur ihrem Herrn, dem Hirten. Nimm einen Knüppel oder einen Stein in die Hand.
Der Hund ähnelte der Rasse, die man auf dem Schoß oder der Couch hält. Er umkreiste uns geschäftig und warf aus sicherer Entfernung, so kam es mir vor, scharfe Blicke aus zwei schwarzen Kohlestücken.
Georgs Schwester hatte uns von einem Waldarbeiter erzählt, der auf ihrer Station an Tollwut gestorben war.
Ich ließ kein Auge von dem Hund. Julian machte noch Anstalten, ihn zu locken. Mihai saß gelassen und entspannt, den Rücken an einen Stein gelehnt.
Ein zweiter Hund tauchte auf, kam geradenwegs auf uns zu und setzte sich, abwechselnd mich und Julian fixierend, auf seinen Schwanzstumpf. Es stimmte wohl, dass den Hirtenhunden (falls das welche waren) Schwänze und Ohren gestutzt wurden, um den Wölfen keine Möglichkeit zu geben, sich daran festzubeißen. Aber Ohren hatte er! Sie hingen, zwei zerfetzte Lappen, an seinem starken Schädel und gaben ihm, zusammen mit den Augen, den Ausdruck eines Raufboldes. Sein kurzes, glattes Fell zeigte gleichfalls Spuren, die nur von Kämpfen auf Tod oder Leben stammen konnten. Ich war bereit, ihn mit "Herr Hund" und "Sie" anzusprechen.
Vielleicht ist es am besten, wir geben ihm was? Sozusagen Tribut! sagte Julian.
Er brach ein Stück von seinem Brot ab und warf es ihm hin.
Der kleine Hund bog in den Kreis ein, den er um uns zog und kam stracks heran. Er ließ sich in Distanz zu uns und zu seinem Gattungsbruder nieder. Blickte den Brotbrocken an, der unberührt im Gras lag, dann den anderen Hund, und danach legte er seine Schnauze bewegungslos und stumm auf die Pfoten. Sein Kopf war rechteckig. Durch sein Fell blies der Wind und strählte es unablässig. Er wirkte wie gewaschen und gekämmt. Er hatte einen tiefen Riss von der Nase schräg hinab zur Lefze, eine Wunde, die nässte und über die er von Zeit zu Zeit mit seiner Zunge fuhr. Die Zähne, die dabei zur Besichtigung standen, erinnerten in ihrer Nadelspitze und ihrem Besatz an den Rachen eines Haifischs.
Der große Hund nahm sich ohne Hast und ohne Prüfung den ihm zugeworfenen Happen. Er setzte sich ein Stück näher und verfolgte jeden Bissen, den ich hinter meine Zähne brachte. Das Essen blieb mir im Halse stecken. Ich wagte nicht, mich wegzusetzen.
Es kam ein dritter Hund. Gefleckt und kurzhaarig wie der Zweite, vielleicht jünger, denn er bellte und wedelte. Mit ihm kam ein Hirt. Ich atmete auf. Wir hörten auch das Läuten. Aber die Herde graste im toten Winkel zu unserem Blickfeld.
Der dritte Hund besetzte den Raum zwischen den beiden zuerst gekommenen. Der Hirt lagerte sich. Er sagte kein Wort und blickte uns, wie seine Hunde, unverwandt an.
Dicht und dunkel quollen seine Locken unter der Krempe des runden schwarzen Hutes hervor, den ein glänzendes Lackband zierte. Seine Augen lagen im Schatten. Um seine Schultern hing, mit einem Bindfaden am Halse zusammengebunden, eine karierte Schlafdecke. Darunter trug er eine Strickjacke, der die Knöpfe fehlten. Sie war ebenso ausgeblichen wie die Decke und darunter etwas Blauschwarzes, einen Pullover wohl. Die Hose aus derbem Zeug steckte in Schaftstiefeln. Er lag auf der Seite, hielt seinen Krummstab zwischen die Knie geklemmt. Den Kopf stützte eine seiner riesigen Hände. Wir betrachteten einander.
Ich schätzte ihn auf Mitte, höchstens Ende Zwanzig.
Mihai, der ein Gespräch mit ihm eröffnen konnte, machte keine Anstalten dazu.
Ich sah einen Hunger in den Augen des Schäfers, auf Menschennähe gerichtet.
Unverwandt schaute er uns an.
Wir packten zusammen.
Die Hunde wurden immer zutraulicher. Ich wünschte, ihr Herr möge sie rufen. Sie suchten die Wurstpellen und Brotkrumen. Sie schnüffelten an unseren Kraxen, und noch immer wagte ich keine zu rasche Bewegung. Ich nahm wahr, dass auch Julian, der grenzenloses Vertrauen zu jeglicher Kreatur besaß, diesmal keine Hand ausstreckte, um sie zu berühren, und zudem darauf achtete, sie nicht in seinem Rücken zu haben.
Als wir gingen, erhob sich der Hirte, und stumm, wie er gekommen war, wandte er sich um - und die Hunde folgten ihm.
Die Steigung lag im Windschatten. Die Hitze wurde schwer.
Ich blickte auf und sah, dass eine weiße Wolke Julian in den Himmel entführte.
Bleigewichte zerrten an meinen Nackenmuskeln.
Schritt vor Schritt setzten sich meine Füße bergauf.
Laut ging mein Atem. Feine Salzkristalle, Bodensatz verdunsteten Schweißes, bedeckten mein Gesicht. Die Wolke hatte Julian auf dem Gipfel abgesetzt. Neben Mihai.
An den Flanken der Suru-Spitze läuteten Herden.
Kein Hund war zu sehen oder zu hören.
Auf dem Scheitel des Berges aber saßen rechter Hand des Pfades zwei Hirten. Uralte Gesichter unter turmhohen dunklen Fellmützen. In knotigen Händen führten sie scharfe, blitzende Messer. Sie schnitten den Käse; der zwischen ihnen auf einem Tuch lag, und das Brot in mundgerechte Stücke. Die wattegestopften Jacken schlotterten um Leiber, die kein Fett mehr ansetzen würden, vermutlich immer nur Sehnen und Muskeln gewesen waren.
Linker Hand des Pfades lag bäuchlings, und einander wie aus dem Gesicht geschnitten, ein zweites Hirtenpaar: Vater und Sohn. Beide in der Blüte ihrer Kraft. Mir schien, sie ließen mich nicht aus den Augen. Ihre Blicke verfolgten mich aus dem Schatten fingerbreiter, schwarzer Krempen noch, als ich mich zwischen Julian und Mihai setzte.
Wir saßen im Wind auf der Spitze des Berges. Julian reichte mir die Wasserflasche. Mihai bot Kekse an, die staubtrocken waren.
Keiner sprach.
Weiße Zirren, vor denen bauschige Kumuluswolken segelten, streiften das Blau.
Das Gras, von Schafen kurzgehalten, wie versickernd im Geröll.
Der Pfad verließ die Alm und wurde zum Felsensteig.
Unsere Tritte nahmen einen anderen Klang an. Der Kamm wurde zum Grat. Die Stellen mehrten sich, an denen wir unterhalb blieben, uns Kletterei im brüchigen Gestein ersparend. In den Nordseiten lagen Schneereste. Abstiege wechselten mit Anstiegen.
Ich war allein mit mir.
Ich bog um eine Felsenecke und blickte in ein Hochtal. Schwarze Granitwände schlossen es wuchtig ab. Aber unterhalb seiner Schwelle, die aus hellen, im Licht des späten Nachmittags rosa schimmernden Felsblöcken geschichtet schien, leuchtete, breit umgürtet von gelben Blütenfeldern, ein stiller See. Der Lac Avric?
Ein Hirt trieb seine Herde dem Pferch zu.
Die Jungen waren verschollen.
Nach meiner Karte lag der Frecker See, der Lac Avric, auf der anderen Seite des Grates. Auch die Biwakschachtel, die an seinem Ufer stehen sollte, war nicht auszumachen.