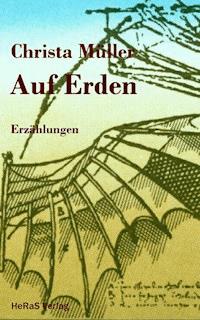Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erzählt wird, ausgehend von Elsas Tod ihr Leben, das vielfältig verknüpft ist mit den Leben und Schicksalen der älteren Generation und, über die Erzählerin, mit dem der Tochter und der Enkel. Der Augenblick des Todes wird für Elsa identisch mit dem Moment der Befreiung und des Glücks. Die harte Arbeit des Erinnerns, die ihre Tochter geleistet hat, geht über das Beschreiben des Gewesenen hinaus. Sie schafft einen geschlossenen Raum, in dem sich innen und außen begegnen. Tango ohne Männer ist ein bemerkenswertes Buch. (Waltraud Lewin in Berliner LeseZeichen, Ausgabe 4/99 (c) Edition Luisenstadt, 1999)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christa Müller
Tango ohne Männer
Roman meiner Mutter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zum Geleit
I 1
2
3
4
5
II 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
III 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
IV 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Impressum neobooks
Zum Geleit
Wir gingen von der Klinik in der Härtelstraße über den Roßplatz zur Petersstraße. Meine Tante Elli wischte sich von Zeit zu Zeit die Tränen ab. Ihr Gang war langsam, schwerfällig, schwankend. Sie blieb stehen um Luft zu schöpfen und mir zu sagen: Maria, am besten wir kaufen jetzt das Hemd.
Es war der Nachmittag des achtzehnten Juli Zweiundsechzig. In meiner Erinnerung ist die Luft dieses Nachmittags stockdunkel. Ich fror. Elisabeth schob mich ins HO-Warenhaus, in dem Elsa Herrenkonfektion verkauft hatte und lenkte mich zu einem Tresen für Damenwäsche, das Totenhemd für Elsa, meine Mutter, zu kaufen. Ich suchte nach einem Nachthemd, das ihrem Brautnachtkleid von neunzehnhundertfünfunddreißig gliche, einem knöchellangen, ärmellosen, weißem Seidenkleid, das sich dem Körper faltenlos anschmiegte.
Ich hatte es aufgetragen.
I 1
Am Ende so ein Unglück, sagte ihre Mutter. Es war das Einzige, was der heute über die Lippen kam, während Elsa an ihrem Bett saß. Elsa, die jüngste ihrer drei Töchter. Das jüngste ihrer Kinder, der Sohn, war lange tot. Ihn wünschte sie sich her. Oder sich zu ihm. Die Mädchen strapazierten ihre Nerven. Sie hatte es ihnen mehr als einmal gesagt.
Die Mutter saß mehr, als sie lag, in den Kissen, schlürfte die Luft durch bläuliche Lippen und hatte das vielleicht zu sich selbst gesagt. War sie denn bei sich? Bei Elsa war sie nicht. So sehr Elsa bei ihr war.
Elsa hatte gewusst, sie würde allein mit der Mutter sein. Elisabeth machte in ihrem Rattenloch, wie Elsa das Labor respektlos bezeichnete, Spätdienst, Elisabeth, die Schwarze, die Elli, der Zigeuner, die ältere Schwester. Die Älteste, Luise, lebte in Dortmund und war nur halb ihre Schwester, was Elsa niemals vergaß.
Wir müssen uns aussprechen, dachte Elsa, fand aber die Mutter so wenig wie sonst geneigt dazu, mehr noch: Die Mutter schien ihre Anwesenheit nicht zu bemerken. Und ließ sie mit dem Satz allein: Am Ende so ein Unglück.
Elsa erwischte an diesem Tag die letzte Straßenbahn vom Krankenhaus Dösen zur Leipziger Innenstadt ehe die Strecke wegen der Ankunft der Friedensfahrer gesperrt wurde. Je näher die Bahn dem Platz kam, der seit fünfzehn Jahren Karl-Marx-Platz hieß, den Elsa noch immer Augustusplatz nannte, um so mehr Menschen säumten die Straßenränder. Der Stadtfunk unterbrach seine Marschmusiken mit Streckenmeldungen, denen sie hätte entnehmen können, dass die ersten Fahrer die Stadtgrenze erreicht hatten, wenn sie es hätte wissen wollen.
Zu Hause heizte sie den Badeofen und bereitete sich ein Kalmusbad. Ihre Schwiegermutter wusste die Wurzel auf Gängen über Land zu finden und schwor auf deren heilende Kraft.
Elsa gönnte sich an diesem Abend ein frisch bezogenes Bett.
Sie sparte mit Wäsche seit das Hantieren im Waschhaus Tortur für sie war. Ein frisch bezogenes Bett gehörte für sie zu den Genüssen des Lebens. So suchte sie sich über den hinter ihr liegenden Tag zu trösten.
Sie öffnete das Schlafzimmerfenster einen Spalt breit. Zum ersten Mal nach dem Winter. Die Birnbäume in Noas Garten, in jahrzehntelangem Streben, die müden Stämme auf den Beeten zur Ruhe zu legen, mühsam von Schuppen und Laube daran gehindert, standen, der Frühling verlachte ihr Alter, wieder in Blüte.
Die Dämmerung wurde dicht. Elsa spürte es glücken, dass der Schlaf sich ihrer erbarmte. Zucken durchlief ihre Glieder, Spannungen lösend.
Sie begann, zu sinken.
Ein Knall zerriss die Stille. Das Haus erbebte wie an jenem vierten Dezember, als Bomben die Stadt zerstörten.
Elsa saß aufrecht im Bett, getroffen vom Luftzug. Die Druckwelle hatte das Fenster aufgestoßen, die Scheiben zitterten. Volltreffer, dachte sie. Beim Viadukt!
Sie wartete, dass die Sirenen aufjaulten! Ihr Körper wartete, während sie sich aus dem Bett tastete, (Kein Licht machen! Die Fenster sind ohne Verdunklung!) auf jenes Heulen, das eine fallende Bombe begleitet, um sich zu Boden zu werfen, damit der Luftdruck bei der Detonation die Lungen nicht zerreiße. Reaktivierte Überlebensreflexe. Als jenes Heulen ausblieb, setzte ihr Denken ein: Der Himmel ist nicht gerötet, die Luft nicht brandig. Ich kann im Dunkeln die Baumblüten sehen.
Aber die Luft füllte sich mit an- und abschwellenden Sirenentönen, in die sich gellende Rufe von Martinshörnern mischten. In den erleuchteten Fenstern der Vorderhäuser lauschten Menschen gleich ihr in die Nacht.
Elsa ging in die Küche und stellte das Radio an, drehte den Sucher auf der Skala vorwärts und rückwärts. Nirgendwo rief der Kuckuck des Luftwarndienstes. Kein Programm wurde unterbrochen von der Meldung: Es ist Krieg.
Sie kroch ins Bett zurück. Später wurde sie von einem Weinkrampf geschüttelt. Sich vorzustellen dass wieder Krieg sein könnte, sie hier, Maria mit Anette aber in P. war, oder Maria getrennt von dem Kind, irgendwo! Alle voneinander gerissen. In Not. Im Tod. Sie wusste, während ihre Kehle schluchzte, dass es Vorstellungen waren, die ihr zusetzten. Aber etwas an diesem Irrwitz war wahr. O Gott, klagte es aus ihr. Schütze mir Kind und Kindeskind. Vergib uns unsere Schuld!
Was für Schuld?
Diese Frage in der Dunkelheit. Wie ein Riesenvogel, der auf sie niederstieß, dessen Fänge sie packten, dessen Schwingen sich gewaltig auffalteten, sie forttrugen aus ihrer schützenden Höhle in eine eisige Nacht, zu Weiten in Russland, in den Wald bei Sawina, wo Herbert mit offenen Augen im Schnee lag.
Marias Gesicht tauchte auf, und es starrte sie feindselig an, fragte: Was hatte er dort zu suchen? Warum hast du ihn gehen lassen? Dorthin!
Elsas Zungenspitze glitt an den Zähnen entlang, die fielen von ihren Wurzeln, glatte Perlen, die schlüpften über ihre Lippen in die Schwärze vor ihrem Munde. Als sie erwachte, wusste sie eine Zeit lang nicht, dass sie mit offen Augen in die Finsternis starrte. Dann erschrak sie. Jemand würde sterben. Immer, wenn sie im Traum die Zähne verlor, kündigte das einen Tod an.
Morgennachrichten: Am gestrigen Abend gegen zwanzig Uhr fünfundzwanzig, stieß kurz vor dem Leipziger Hauptbahnhof der ausfahrende Personenzug nach Halle mit dem einfahrenden Eilzug von Halberstadt zusammen.
Nachmittags meldete der Rundfunk: Neunundfünfzig Tote und hundertfünfzig Schwerverletzte.
Menschen waren tot, die zur Ankunft der Friedensfahrer in die Stadt gekommen waren und vom Jubel im überfüllten Stadion statt nach Hause in Leichenhallen gelangten.
Am Ende so ein Unglück, hatte Ida Teubler gesagt. Elsa hätte die Worte der Mutter nun deuten können.
Karl Teubler, auf seinem Sterbebett, hatte von Elsas Männern gesprochen. Hatte gesagt: Verlassen wirst du sein von deinen Kerlen und von deinem Kinde.
Sie hatte es nicht glauben wollen. Ich, zehnjährig, stand dabei und sah es ihr an und fürchtete mich vor seinen Augen, die mich von weither anblickten, als er zu mir sagte: Dir, Füchsken, wird es genauso gehen. Das ist dein Erbteil. Und sei nicht so stolz, Maria!
Im Mai Neunzehnhundertsechzig, am zehnten Morgen nach dem Eisenbahnunglück, erlöste anhaltendes Klingeln an der Tür Elsa aus dem ohnmächtigen Staunen vor der Leichtigkeit, mit der sich ihre Zähne wiederum aus Ober- und Unterkiefer lösten, als die Zunge am Gaumen entlangglitt.
Die Türklingel schrillte wie besessen.
Elsa fuhr aus dem Bett, stürzte zum Fenster. Niemand stand vor der Haustür. Das Geschrill brach ab. Die Stille, die ihm folgte, war ihr fürchterlich. Als Schritte hörbar wurden, die schweren Schritte Elisabeths, im Durchgang des Vorderhauses dumpf, im Hof hell, hob das die eisige Lähmung in Elsas Brust nicht auf. Sie konnte ihre Schwester erst sehen, als die an die Ecke des Gebäudes gelangte, das quer zum Vorderhaus stand und in dem Elsa wohnte. Elisabeth hob ihr verschwollenes Gesicht und rief: Mach schnell! Das Taxi wartet. Bei dem Wort Taxi spürte Elsa einen Stich zwischen Herz und Magen, danach schien eine Nervenbahn durchschnitten zu sein. Sie sah ihre Hände nach Strümpfen und Schuhen fassen. Ihr Blick mied den Spiegel.
Elsas Pupillen waren weit. Über ihrer Oberlippe stand Schweiß auf aschgrauer Haut.
Elsa schloss die Tür ab. Elisabeth sagte: Vor zwei Stunden war Mutter noch bei Bewusstsein. Sie gingen zwischen Noas Apfelgarten und dem Hinterhaus, dann zwischen Noas Kirschgarten und dem Trockenplatz zum Vorderhaus und ihre Absätze klopften auf die Steine, mit denen der Hof gepflastert war und dröhnten auf dem Zement im Durchgang zur Straße.
Sie waren durch Morgensonne gegangen. Elsa begriff es im Schatten der Häuserzeile. Dort stand das Taxi. Sie zitterte, denn sie fror.
Was tust du mir an? Elsa dachte es nicht eigentlich. Sie dachte gar nichts. Etwas in ihr dachte. Eine Stimme, die sich Gehör zu verschaffen trachtete. Unablässig. Bis sie sie wahrnahm. Ihre eigene Stimme. Fern, hell, kindlich: Was tust du mir an?
Was tue ich dich an? Na was? Das war die spöttische Zunge der Mutter, die nach dreißig sächsischen Jahren zwar das breitste hörder Westfälisch abgelegt, aber nach wie vor so gut wie nie einen Dativ benutzt hatte, die Elsas Klage nachzuäffen schien.
Elisabeth legte den Arm um die kleine Schwester. Die ergab sich diesem Arm nicht. Ihre Schultern waren wie aus Holz.
Ida Teubler lag hinter einem Wandschirm. Ihr Mund stand offen. Sie atmete schwer. Die Augenlider waren zugeschwollen. Die Haut über den Wangenknochen hatte sich lila gefärbt. Auf Stirn und Wangen lag tiefe Röte, reichte hinab in den Ausschnitt des Hemdes, aber das Kinn war weiß. Dort stirbt sie zuerst, dachte Elsa.
Eine Krankenschwester maß der Mutter den Puls. Elsa blickte auf den Sand, der durch die Einschnürung des zierlichen Glases rann, als sähe sie das zum ersten Mal und dachte erstaunt: So ist das?
Ganz genau so! Die gewöhnliche Antwort der Mutter. Elsas Gedächtnis lieferte sie ihr reflexhaft zu. Die Mutter lag in den Kissen und nichts deutete darauf hin, dass sie wahrnahm: zwei ihrer Töchter wachten bei ihr.
Schüttel die Federn auf, sagte Elisabeth. Sie schob ihren Arm unter den Nacken der Mutter und hob deren Oberkörper an und Elsa tat wie ihr geheißen. Kissen und Hemd waren vom Fieberschweiß nass. Elsa drehte das Kissen um.
Elisabeth verlangte ein frisches Hemd für die Mutter, ein im Rücken offenes Hemd, und ging der Krankenschwester zur Hand.
Niemals hatte Elsa die Mutter so nackt gesehen. Sie blickte verzagt auf den Leib, den die Frauen entblößten, dessen großer Nabel Mittelpunkt glänzender, zu Hüften und Schenkeln verlaufender Schwangerschaftsstreifen war. Die riesenhaften, schwärzlich geäderten Brüste, herabgesunken zu diesem Narbenkranz, hoben und senkten sich im unregelmäßigen Rhythmus mühevollen Atmens. Die Brustwarzen glichen in der Färbung den Hämatomen in ihren Ellenbeugen.
Elisabeth und die Krankenschwester legten der Mutter das frische Hemd an und wechselten das Stecklaken unter dem breiten Gesäß.
Die Frauen gingen energisch um mit dem massigen Fleisch. Wälzten es vom Rücken auf die Seite und wieder auf den Rücken, zogen das Leinen straff und schichteten Zellstoff zwischen die gedunsenen Schenkel. Sie schienen so etwas wie Zufriedenheit zu erreichen, als sie die Decke über dem Leib glatt zogen. Die Stationsschwester kam und fragte, ob sie Frühstück wollten.
Ja, sagte Elsa.
Sie verspürte rasenden Hunger, tauchte den Zwieback in Milchkaffee und stopfte ihn sich in den Mund, aß auf, was eine Stationshilfe für sie und Elisabeth gebracht hatte. Für Momente irritierte sie die Weichheit in Elisabeths auf sie gerichteten Blick. Ihre Augen suchten die Augen der Mutter. Die lag unverändert und schlürfte die Luft, als dürste sie nach ihr. Elsa schien es, als blitze zwischen den geschwollenen Lidern über den Tränensäcken ein Spalt, durch den die Seele hinauslugte aus dem gepeinigten Fleisch.
Jetzt brauchte Elisabeth nicht mehr zu bestreiten, dass zu der Mutter Gestalten kamen, die sagten: Komm mit! Sie waren Nacht für Nacht gekommen. Nun war heller Tag, und Ida Teubler sah sie hinter zugeschwollenen Lidern und redete, den Töchtern unhörbar, mit ihnen:
Kommt ran! Meine Mädchen sind bei mich. Zwei von die Drei. Luise hats weit. Die Elli, ehe sie beim Elsken schellte, hat nach sie telegrafiert. Für die Polizei. Von Dortmund nach Leipzig gehts nicht ohne Stempel. Wie nicht von Hörde nach Aplerbeck, als wir den Franzosen hatten. Geduldigt euch!
Willi, dachte sie wie so oft, auf dich brauch ich nicht warten. Du bist schon dort. Nun komm ich zu dich. Aber diesmal vernahm sie seine Stimme, wie sie fragte: Mutter?
Willi!, rief sie. Williken!
Von den Gestalten, die sie umgaben, starrte eine aus seinen Augen sie an. Es waren seine Augen. Er kannte sie nicht mehr. Sie sah es. Sie sah sich hinein in diese Augen, die sie den Rest ihres Lebens auf jenem Foto über dem Küchensofa in ihren Zwiegesprächen, die sie allein bestritt, angeblickt hatte und die beständig an ihr vorbei gesehen hatten.
Williken!
Mutter? Du?
Ja Kind. Sie seufzte. Wie du mich nich anguckst! Erinnerst du dich an die Platane im Hof? Wir konnten sie vom Fenster in die Krone sehn.
Sie hielt seinen Blick fest, um ihm zu sagen, was sie Jahre hindurch beschäftigt hatte: Wo du gefallen bist, träumte mich: Ich lag im Schlafzimmer tot, und in die Platane vorm Fenster hackten zwei Spechte auf sich los. Eins mit den Schnabel in die Brust vom andern. Die Federn ganz blutich. Die Platane war hoch wie das Haus vis-à-vis. Ist in Schutt und Asche gefallen. Vierter Dezember dreiundvierzig. Der Baum steht noch. Willi, was sächst du nix? Auch in dein Urlaub warst du stumm wie ein Fisch.
Im Fieber stattete sie ihn mit Worten aus, tausendmal gedacht, hin und her gewendet in ihren stummen und lauten Gesprächen mit dem Toten.
Was denn, Mutter? Was soll ich sagen?
Der Krieg war alle und du kamst nicht zu mich nach Hause, schalt sie.
Ich habe Gott gedankt, dass ich Schwestern hatte, die mussten nicht Soldaten werden und dass du mir nicht zusehen musstest bei dem, was ich tat.
Lass, Willi, lass! Weißt du noch, wie du Semmeln ausgetragen hast? In weißem Zeug. Hab ich dich genäht. Hose. Hemd. Schürze, die reichte dich bis zu die Knöchel. Und das Käppi auf dein Scheitel. Alles hatte ich dich genäht. Und gestärkt mit Kloßwasser. Westfälische Klöße. Dein Leibgericht.
Ja, sagte er und schien zu grinsen, ich war stolz, als mir der Bäcker den Korb anvertraute, aus dem ich Beutel an den Messingklinken fremder Wohnungen füllen durfte. Wenn ich in Lappland an Leipzig dachte, waren es die nach Bohnerwachs duftenden Treppen, die bunten Glasfenster auf den Etagen, die gewaschenen Fliesen der Hausflure, die schweren Türen der Häuser, die Gänge über die Dachböden von einem ins andere Haus, an was ich dachte.
Und an die Platane, Willi? Erinnerst du dich an die Platane?
An die Platane und den Fliederbusch. Ja.
Er blüht, sagte die Mutter, auch wenn ich nicht mehr bin.
Die Platane! Finnlands Wälder, Mutter, was waren die gegen die Platane im Hof. Ich konnte das nicht aushalten, ohne verrückt zu werden, so habe ich mich gesehnt.
Lass, Willi! Denk nicht mehr dran. Weißt du noch? Du bist ein Lieferwagen gefahren, gerade mal sechzehn.
Ein elendes Dreirad bei einer elenden Lampenschirmfirma, Mutter! Als Junge sah ich einen silbernen Vogel in einem Hangar, der extra für ihn gebaut war, wie das Rollfeld, über das unser Lehrer uns führte. Das ist die Ju! Wie er das sagte! Ein Mann kam übers Rollfeld, ganz in Leder. Mir war klar, dass er sie fliegen konnte. Ich erkannte es daran, wie er ging, wie er uns anlachte. Seitdem wollte ich fliegen. Deshalb kam der Krieg. Für mich! Damit ich Flieger wurde.
Deinetwegen! Du bist meschugge. Denk nicht mehr dran! Fünfzehn Jahre ist der Krieg alle. Willi, du wärst jetzt vierzig. Ein Mann in die besten Jahre. Eine Stütze für deine Schwestern.
Ich bin fünfundzwanzig. Immer fünfundzwanzig. Immer.
Da ist eine Narbe auf deiner Brust!?
Er lachte sein ihre Fürsorge zurückweisendes Lachen. Das war ein Messer, sagte er. Die Finnen wollten nicht, dass wir ihre Mädchen ansahen.
Mädchen?!
Mädchen?!, äffte er sie nach. In Sümpfen, Frösten, Schneewüsten. Mädchen!
Wie haben wir auf dich gewartete, murmelte sie, deine Schwestern und ich.
Du hast gedroht dem Kompaniechef zu schreiben, weil ich dir nicht schrieb. Meine Schwestern! Jede hat mir deine Angst geschildert. Ihre Sorge um dein Herz. Was hätte ich dir denn schreiben sollen? In meinem Leben habe ich keine anderen Frauen gekannt als euch. Mädchen! Vier Jahre war ich nur unter Männern. Viertausend Kilometer von zu Hause. In einem Land, wo es im Sommer nicht dunkel und im Winter nicht hell wird. Wo der Himmel dich erdrückt oder die Fressen deiner Vorgesetzten bei der Befehlsausgabe dich zur Salzsäule machen. Was hätte ich gegeben für eine, die auf mich wartet. Der Messerstich galt einem andern. Man hat uns verwechselt.
Willis Gesicht erinnerte sie quälend an ein anderes.
Als ich dich kriegte, dachte sie, ist mein Willem gestorben. Vom Phönix, von die Kokillen weg ins Hospital. Am Tag vom Putsch. Hörde war voll roter Fahnen. Und es knallte schon wieder. Der Krieg war alle, zu Hause gings weiter. Mir schwante, er sei bei. War aber Spanische Grippe. Als ich ihn gefunden hatte, hat er mich nicht mehr erkannt. Und als ich ihm die Augen zudrückte, war ich in Wehen. Natürlich!, dachte sie. Willem ist er ähnlich. Sein Vatta! Schon tauchte der auf. Hätte sein Bruder sein können, entblößte im Lachen die gesprenkelten Zähne. Aber sie redete zum Sohn: Die haben mich ins Hospital über Nacht behalten. Am Morgen bin ich mit dich nach Hause. Der Nabel war nicht ordentlich abgebunden. Luise ist draufgekommen. Hat deine Windel offen gemacht. Wärst mich gestorben ohne Luise. Was habe ich angestellt mit dich! Wollte dich nicht auch noch hergeben. Warst doch das Letzte, was mich von Willem blieb.
Hinter zugeschwollenen Lidern rief sich die Sterbende Mann und Sohn herbei, Männer in der Kraft ihrer Jugend. Ihnen gesellte sich eine dritte Gestalt hinzu. Sie sah, wie in Willis kindlich werdender Miene Zorn aufglühte, wie seine Augen bettelten, wie sein Körper vor Wut steif wurde und seine Hände sich zu Fäusten ballten. Sie aber lachte. Die Gestalt hinter Willi war Teubler.
Was ist denn, mein Schäfken?, fragte sie. Willi, mach doch kein Drama draus! Du warst alt genugens um in dein eigenes Bett zu schlafen. Allein hätte ich uns nicht durchgebracht. Das Geld verfiel. Der Franzose hielt uns besetzt. Karl Teubler hat mich geheiratet. Mit vier Kindern!
Er hatte mich nicht lieb, klagte Willi.
Du warst eifersüchtig, sagte sie.
Willis Lachen gellte ihr in den Ohren. Eifersüchtig warst du! Keine Ferne hat mich vor deiner Eifersucht geschützt, wenn ich ein Mädchen ansah.
So ist das, sagte sie. Ganz genau so!
Seit du gefallen bist, bin ich nicht mehr froh gewesen. Als dein Vatta tot war hatte ich noch Kraft. Bei dich war ich wie ausgehöhlt von Herzeleid. Ich habe nie geweint. Salzige Tränen, hier sind sie drin. Eine Flut. Das Herz säuft mich ab wie ein Stein. Aber sag mich vorher wie du umkamst!
In der Salzflut bin ich ertrunken. Abgeschossen überm Lyngenfjord.
Du warst doch bei die Flak!
Ist doch egal. Ich stand am Geschütz und im Fadenkreuz tanzte meine Messerschmidt. Ich sah mich in der Kanzel. Deutlich. Gab Feuer. Ein Wölkchen verpuffte am Himmel. Der Rest trudelte ab in die See.
Was für ein Unsinn, Willi! Ihre Seele strengte sich an, ihn aufzuhalten.
Willi! rief sie, was ist mit die Spechte? Habs gesehn! Mit meine Augen, die Vögel! Eins machte das andre tot. Das ist wider die Natur. Ach, wärst du bloß nicht in Krieg gegangen, schrie sie und der Atem wurde ihr knapp. Sie keuchte, als versuche sie den Entschwindenden einzuholen. Dann wandte sie sich dem anderen zu: Willem! Mit dein Tod fing alles an. Kommst aus dem Krieg und stirbst mich weg, klagte sie laut.
Die Influenza, sagte Wilhelm bekümmert. Im Krieg bin ich dem Sensenmann entkommen. Mit der Schnauze im Dreck. Wie ein Käfer, der sich totstellt. Nur nicht den Kopf heben! In den Schlamm wühlen, in Schrapnellsplitter, in Stacheldraht, in Gaspatronen. Der Tod brüllte: Steh auf! Lauf! Sonst verreckst du! Aber ich grub meine Finger tiefer in die Erde, hielt mich fest an ihr mit Klauen und Zähnen. Taub vom Lärm sah ich die Spuren der Geschosse über mir, als ich die Augen hob. In diese Stille hörte ich dich sagen: Willem, bleib du bloß heil! Du trugst das weiße Kleid. Unter deinen aufgetürmten Locken lachtest du mich an.
Der Tod hatte mich nicht vergessen. Schickte mir im Morgengrauen einen Feind. Ich wollte mich nicht rühren. Und musste niesen. Ich nieste wie verrückt. Der oben am Trichterrand legte an. Ich hob die Hände übern Kopf. Frater! schrie ich. Nix schießen! Ich rappelte mich hoch. Ich kroch zu ihm hinauf. Sein Bajonett auf meiner Brust. So kam ich aus dem Krieg. Frau! Ich wollte unsere Töchter heranwachsen sehen und unsere Urenkel noch. Ich habe kein Gewehr mehr angerührt. Auch nicht gegen Freikorps und Reichswehr. Ich bin malochen gegangen. Du weißt es.
Ja. Ich habe Kappus gekocht. Jeden Tag Kappus. Füllte dich den Henkelmann, als du in Phönix gingst. Sagte dich: Willem, mach kein Unsinn! Die Augen glänzten dich. Der geht jetzt zu die Barrikaden, dachte ich. Es war das Fieber. Das Kind stieß mich, als ich zu dich rannte. Wollte raus, sein Vatta sehn, bevor der sich davonmacht.
Kommst aus den Krieg und lässt mich allein mit die Kinder.
Frau! Du hattest so viel Kraft.
Willem, vier Jahre habe ich niemanden angeguckt.
Wilhelms sommersprossiges Gesicht erheiterte sich. Nein doch! So eine Wilde wie du?
Nur mit dir. Glaubs! Kaal Teubler bekam mich erst in der Hochzeitsnacht. Stimmt doch! Kaal? Ihr Erinnern tastete nach seinem Schattenbild.
Der Schatten flüsterte: Quäle dich nicht. Das hatte Karl Teubler nach dem Blutsturz geröchelt, mit dem sein Leben endete.
Nach und nach stellte sich in ihrer Brust ein Gefühl ein, als bahne die Salzflut, die ihr Herz erdrückte, sich einen Weg durch die Augen ins Freie. Die Töchter, die bei ihr saßen, vernahmen nur den stockenden Atem. Die Tränen löste die Hitze des Fiebers in den Zellen des Fleisches für immer auf.
Weine, sagte Karl Teubler. Das macht dich leicht. Leicht musst du werden.
Kaal, sagte sie, die Hochzeit mit dich war mein Pakt mit das Leben. Er gildete nicht mehr, als du dann tot warst.
Als Willi tot war, sagte er sanft.
Wie kannst du mich das sagen!
Du hast ihm gehört.
Ja, dachte sie.
Du lagst bei mir, aber warst nicht bei mir, du lauschtest dem Atem des Jungen. Sogar, als wir eine eigene Kammer hatten, entging dir keine Regung nebenan. In keinem Augenblick.
Ja, dachte sie. So ist das. Genau so. Hast du doch wissen gemusst! Eifersüchtig warst du. Sie fasste ihn fest ins Auge. Sein schwindsüchtiges Aussehen verlor sich. Er wurde zu jener Person, die eines Tages ihre Küche betreten hatte, um ihr eine Versicherung aufzunötigen. Er steckte in einem maßgeschneiderten Anzug, das hatte sie auf den ersten Blick gesehen. Davon verstand sie was. Der Versicherungsvertreter Karl Teubler sagte: Sie haben vier Töchter! Willi trug Kleidchen, das ließ den Rivalen noch unerkannt. Was wird aus denen, wenn ihnen, meine liebe Frau, etwas zustößt?
Sie hatte schallend gelacht, er sie verständnislos angeblickt und plötzlich gestrafft vor der Nähmaschine gestanden, hinter der sie saß, um das Leben für sich und die Kinder zu verdienen. Aus seinem makellos reinen Hemdkragen war Röte vom Halse zu den tadellos rasierten Wangen gestiegen. Er hatte nicht begriffen, weshalb sie lachte und ganz begriff sie es auch nicht. Vielleicht, weil er gesagt hatte: Meine liebe Frau!
In einer Aufwallung mütterlich schwesterlicher Zärtlichkeit wusste sie, dass es um Versicherungsangelegenheiten nicht ging, als er, seinen halt- suchenden Blick auf das Schwungrad der Maschine gerichtet, sie mit Strenge fragte: Haben Sie diese Singer schon abbezahlt?
Sie war versucht gewesen, ihn zu fragen, ob denn sein schöner, grau-wollener Anzug bezahlt sei. Doch sie sah seine glühenden Ohren unter den geschorenen Schläfen und das spiegelglatt aus der Stirn gebürstete Haar mit dem messerscharfen Scheitel und dort die verletzliche Kopfhaut, muschelweiß. So wenigstens an Sonntagen auszusehen, hatte Wilhelm sich vergeblich bemüht. Dieser Teubler aber sah wohl jeden Tag so aus.
Mein Herr, ich tätige niemals Abzahlungsgeschäfte, sagte sie. Alles was sie hier sehen, gehört mich! Er wurde noch dunkler. Sie trug nur eine Wickelschürze und sein Blick irrte über ihre bloßen Arme, zu ihrem Hals, in den Schürzenausschnitt, wo dicht beieinander ihre Brüste lagen, unter die sie die Arme geschlagen hatte. Sein Blick wagte sich hinter den Lidern hervor. Sie wich diesem Blick nicht aus. Ein Zug in seiner Miene erschloss sich ihr nicht. Fast ein Grinsen, halbseitig zwischen Nasenflügel und Schläfe. Nur zu sehen in einem bestimmten Lichteinfall. Unwillkürlich glitt ihr Blick hinab zu seinen glänzenden Schuhen, als verberge sich in einem der Huf. Später tauchte dieser Moment in ihren Zweifeln auf, wenn sie sich fragte, was eigentlich er bei ihr, die sechs Jahre älter war und älter noch aussah, suche.
Kaal, fragte sie jetzt, als wir nach Leipzig gingen, träumte mich, das Elsken ist schwanger und ihr Kind ist von dich. Der Traum hat mich gepeinigt, bis das Kind da war, das Füchsken. Gott sei Dank hatte es Willems Haut und Haar.
Gespenster hast du gesehen, sagte er tonlos.
Sollte ich mich nicht Gedanken machen? Abend für Abend war Elsa für die Versicherung auf die Beine. Zur gleichen Zeit wie du.
Er lachte. Nacht für Nacht kamst du in mein Bett gekrochen. Du hast mich bewacht. Je länger wir zusammen lebten, je größer die Mädchen wurden, um so klarer kam es ans Licht: Du warst eifersüchtig auf deine Töchter. Jede von ihnen hätte für meine Frau gelten können. Wenn ich mit Elsa durch die Stadt ging, stürzten sich die Fotografen auf uns „Hochzeitsreisende". Sie hatten alles, deine Töchter, was du nicht mehr hattest. Und du hattest, was keine noch hatte! Nämlich drei Kinder allein durch den Krieg und dann vier durch die Inflation gebracht. Du warst wie eine Löwin. So stark, so unerschrocken. Du warst, wie ich hätte sein wollen. Du warst die geborene Geschäftsfrau. Und wäre ich zu Gelde gekommen, hätte ich dir einen Modesalon eingerichtet. Du konntest das: Mit Geld umgehen und mit Leuten.
Ja. In meine Küche. Zwischen Ausguss und Nähmaschine. In Hörde. In Halle. In Leipzig. Kaal. Sie werden meinen Sarg auf deinen stellen. Wird nicht viel übrig sein von. Ich habe Willem überlebt und dich und Willi auch. Ich will die Augen zumachen, und es soll ewig dunkel bleiben.
Ihr Körper war in Hitze. Sie hörte ihren eigenen Atem laut und schwer und entfernt die Stimmen ihrer Töchter, die nicht darüber einig werden konnten, ob man das Fenster offen oder geschlossen halten solle.
Hinter ihren geschwollenen Lidern gewann eine lange entschwundene Gestalt Konturen, und sie gönnte es sich, sie in der Pracht all dessen erstehen zu lassen, was sie als Mädchen den Kopf verlieren ließ: ein baumlanger Kerl! Weißblond der Schopf und sein Vollbart. Sonnenverbrannt. Augen, blau wie ein wolkenloser Sommerhimmel, lachten sie unter der Schiffermütze an und hinter den Lippen zwei Reihen kräftige, unverfärbte Zähne, bei deren Anblick sie damals eine Gier auf ihn überfiel.
Geertje, sagte sie, du hast mich gesagt, ich bin deine Frau! Du hast mich ein Kind gemacht und sitzen lassen! Die Luise nämlich. Wegen dem Königin-Luise-Tempel, nach dem du mich gezerrt hast.
Gegenwärtig war ihr der Geschmack seines Mundes, seiner Haut, die nach Salzwasser roch und nach Teer aus den Planken des Lastkahns, mit dem er den Kanal von Emden herauf gekommen war. Gegenwärtig die Weite eines Himmels in seinen Augen, nicht zu finden bei den Männern, die im Schacht arbeiteten. Alle Bitterkeit der Demütigung durch seine, von ihr so erlebte, Unredlichkeit, abgelagert in ihrer Seele, darauf Hass auf sich, auf die Töchter, sogar auf die Enkelin gewachsen war, schien heraufgeschwemmt und sie ganz zu durchtränken. Sie forderte seine Antwort ein: Warum bist du nie mehr gekommen?
Jeden Abend bin ich zum Hafen gegangen, sagte sie. Man sah mich noch nichts an, als der Kahn wieder an Pier lag. Die kannten dich nicht.
Lüttje! Ich konnte nicht kommen. Die See hat mich geholt. Mit einer Springflut. Damit ich ihr nie mehr untreu werde. Denn mir wars ernst mit dir. Er legte seine Hand beteuernd auf die Stelle seiner Brust, wo dem Lebendigen das Herz schlug. Es war die Geste, mit der er Abschied von ihr genommen hatte. Noch der Bodensatz ihrer Kränkung schwand hin, unter dem Anblick der Hand auf seiner Brust, der sie glauben wollte, der süßen Leichtigkeit halber, wenn sie von ihrem Gram lassen konnte. Sie dachte: Noch ist sie nicht bei mich, die Luise. Wenn sie kommt, soll sie alles erfahren, das arme Dingens. Alle sind arme Dinger. Haben geglaubt es besser zu kriegen als ich. Waren Waisen, und der Krieg hat Witwen aus sie gemacht. Sie hatte vergessen, dass Luises Polizeiwachtmeister aus dem Krieg heil herausgekommen war. Der starb Jahre danach in seinem Bett.
Sie hatte auch ihr die Tauerkleider genäht wie zuvor den beiden anderen Mädchen. Der Jüngsten zuerst, dem Elsken. Ein halbes Jahr drauf der Schwarzen. Elisabeth! Die Schwarze. Die Zigeunersche. Die Erste mit Willem. Er hatte sie nicht sitzen lassen. Und als die Elli da war, hat niemand glauben wollen, dass die von ihm sei. Aber Willem hatte nur gelacht. Und das Elliken lieb gehabt. Die Luise auch.
Hinter den geschwollenen Lidern erschien ein freches Gesicht mit blitzenden Augen, nachtdunkel wie die Locken, die über den bunten Fetzen quollen, der um die Stirn geknüpft war. Ich bins! schrie der Zigeuner und riss feixend sein Maul auf. Sie kannte ihn nicht und glaubte ihn doch zu kennen. Er hörte nicht auf zu lachen. Sein drahtiger Leib bebte, er stützte die Fäuste unter seine Rippen, als drohe er zu bersten. Madam! Sie wollten doch immer wissen, wieso die Elisabeth so „zigeunersch" ausschaut. Das kommt von mir! Wir zogen über den Hellweg nach Westen. Ich fand ein Mädchen hinter den Sträuchern am Bach, die wusch ihren Brüdern Hosen und Blusen. Kerle, die nach Kohle scharrten. Ich warf das Mädchen ins Gras. Ließ einen Ring aus schwarzem Silber bei ihr. Ihre Brüder haben mich erschlagen. Aber sie trug den Keim in sich: mein Blut. Meine Kraft. Und in dem Kinde mit dem unpassenden Namen, Elisabeth!, das dir fremder ist, Madam, als deine andern, sind sie auferstanden.
Ja. Es gab diesen Ring! Ida erinnerte sich. Ömmi, die Urahne, verwahrte ihn im Leinensäckchen mit anderen rätselhaften Dingen. Er rostet nicht, hatte die Ahne gesagt und den Ring an ihrer rauen Schürze gerieben, eine schwarze Schlange, die sich in den Schwanz biss. Glanz erschien dann auf der ziselierten Schuppenhaut des Reptils. Ein Zauberring, murmelte zahnlos die Alte. Blut klebt daran. Hab ihn von meiner Urahne. Brachte ihr kein Glück. Ich will ihn mit ins Grab nehmen, Ittlkind, ihn ihr zurückbringen.
Und Ida hatte der Urahne versprochen, wenn es soweit war, ihr den Ring aufs Herz zu legen. Und hatte es getan.
Bist du hier, Ömmi?, fragte Ida hinter ihren geschwollenen Lidern.
Krummgezogen trat die Alte aus Nebeln, die dichter wurden. Sie ging im dunklen Sonntagsstaat. So hatte sie im Sarg gelegen, ihr runzliges Gesicht ganz glatt, und Ida hatte sehen können, wie schön sie war. Der Sarg stand offen in der Kammer auf zwei Stühlen. Das Kind stahl sich hinein und war allein mit ihr. Es blickte in das von der Haube festlich umrahmte Gesicht und streckte die Hand hin, auf der es den Ring vorzeigte. Die Urahne regte sich nicht. Das Kind öffnete ihr einen Blusenknopf. Zum Vorschein kam das Hemd, von Ömmi selbst gewebt, und Ida schob gewissenhaft den Ring darunter auf die verabredete Stelle. Knöpfte die Bluse zu und sagte: Nu komm in Himmel!
Wo bist du, Ittlkind? Du häwst mich doch rufen.
Die Sterbende spürte, als sie der Gestorbenen begegnete, die dunkle Geborgenheit, die zuverlässige Wärme, die sie mit dem Wermutduft aus den Röcken der Alten durchdrang, wenn sie ihr verheultes Gesicht hineingedrückt hatte, ein winziges Kind, das auch sie einst war.
Brauchst dir nich förchten, min Deern, allens wird gaud, murmelte die Alte.
Der Ring? fragte Ida. Haste den Ring noch?
Die Urahne kicherte. Willst ihn woll sehen? Bist gieprig, was? Allens, allens sein da! Ganze Sippschaft. Meine Urahn auch. Die mit dem Zigeuner! Allens warten dein.
Ida beäugte hinter ihren geschwollenen Lidern die fremd vertrauten Gestalten, die sich um sie drängten, Köpfe, die sich über andere schoben. Gesichter, verbrannt von Sonne oder geschwärzt von Kohle, Männer und Frauen jeglichen Alters, nicht anders als die, unter denen sie aufwuchs, mit denen sie lebte. Ein ganz junges Mädchen mit rotblonden Zöpfen drängte sich dicht heran. Ich bins, kreischte sie. Nach mir hast du gefragt. Ich habe mich hingelegt für den Zigeuner. Sie haben ihn umgebracht. Sie waren voller Hass, meine Brüder, gegen Fremde. Mein Kind musste ich verstecken vor ihnen. Betteln musste ich um Brot.
Die Menge drängte sich um die Sterbende, schamlos die Augen auf ihre Not gerichtet, nicht leben zu können und noch nicht tot zu sein. Vergeblich suchte sie ein Gesicht, an das sie sich halten konnte. Gierig schnappten die Münder nach Luft wie der ihre. Dalli! Dalli! machten die Zungen, die Augen, die Hände in ihre Richtung. Sie fühlte den Schrei in sich wachsen ohne die Silben zu kennen, bis er sie gänzlich erfüllte: Muttaa!
Der Spuk war verschwunden.
Schleppenden Schrittes näherte sich die Gerufene. Am Hals ihre Bluse stand offen, den Kropf nicht verbergend. Die Augen blickten gequälter noch als in der Erinnerung Idas. Ihr Haar lag glänzend, mit Schmalz gefestigt, am Kopfe.
Ich bin hier, sagte sie.
Idas Herz schlug sehr langsam. Elisabeths Finger am Puls der Mutter verrieten sich nicht. Elsa blickte ihrer Schwester ins Gesicht und flüsterte: Wie lange dauert es noch?
Elisabeth zuckte die Achseln.
Hinter ihren geschwollenen Lidern versuchte Ida Teubler die Mutter aus ihrem Gesichtskreis zu drängen, das Auge abzuwenden von ihr. Doch wohin sie es auch richtete, es traf auf sie.
Was willst du von mich?, fragte Ida.
Du hast nach mich gerufen, sagte die Frau.
Ich habe nach dich gerufen! Vor fünfzig Jahren. In eine Nacht, als mich zum Sterben war.
Ich bin dich nachgegangen.
Nachgegangen! Rausgeschmissen hast du mich. Flittchen! Hafenhure! hast du geschrien, den Schuppen verrammelt, wo ich mich verkriechen wollte.
Ich bin dich nachgegangen, beharrte die Frau, das Schneegestöber war so dicht. War auch dunkel. Wie weiß ich, dass du von Aplerbeck bis Schüren gehst. In dein Zustand!
Zu Tante Änne, dachte Ida. Meine Tante Änne!
Die hagere, feste Gestalt gesellte sich zu Idas Mutter.
Sie hat mich beigestanden, Mutta! Deine Schwester hat mich nicht von ihre Schwelle gewiesen hinaus in die Februarnacht.
Ittl, wiederholte Tante Änne wie vor langer Zeit am Sarg der Mutter, es drückt dir das Herz ab, ihr nicht verzeihen zu wollen. Sie ist tot. Sie ist mit deinem Hass gestorben. Du brauchst nicht über den eigenen Tod hinaus Recht haben müssen. Verzeih ihr. Dann wird dir leichter sein.
Dämmerung nistete in den Winkeln des Zimmers. Die Töchter rückten die Stühle zur Wand, traten ans Bett und Elsa berührte die Hände der Mutter, die unruhig über die Bettdecke fuhren und rief sie. Über den fleckigen Wangen hoben sich die geschwollenen Lider um ein winziges.
Sag was! flüsterte Elisabeth.
Mutter! Wir sind bei dir! Elsken und Elli!
Die Lider schlossen sich. Nichts deutete darauf hin, dass die Mutter die Worte gehört hatte.
Elisabeth führte Elsa hinaus aus dem Zimmer, dem Haus, durchs Tor, durch den Gesang der Amseln, das Schlagen der Finken, hin durch den Maienabend, der sich auf die Felder neben der Landstraße legte, unter letzte Lerchentriller und verglühende Farben. Sie waren erschöpft. Zu ihrer Rechten zog die Nacht herauf. Hinter ihrer linken Schulter gewahrte Elsa den massigen, schwarz in einen grünlichen Himmel ragenden Wasserturm des Krankenhauses. Auf seiner obersten Zinne lag ein Abglanz der untergegangenen Sonne. Sie sah ihn schwinden. In diesem Augenblick.
Elisabeth sagte: Mutter wird die Nacht überstehen. Sie wartet auf Luise.
Elsa war zu elend, um das Angebot ihrer Schwester auszuschlagen, bei ihr zu übernachten. Deren Schlafzimmer bebte bis nach Mitternacht vom Straßenverkehr. Elisabeth, über zwanzig Jahre an diesen Lärm gewöhnt, schlief.
Elsa machte die Umrisse des gewaltigen Wäscheschranks im Dunkel aus. In ihm hortete die Schwester Bettwäsche und Tischdecken, Frotteetücher und Nachthemden, als sammle sie eine Aussteuer oder als brächen demnächst neue Notzeiten an. Auf dem Schrank stapelten sich bis zur Zimmerdecke Kisten und Kartons.
Elsa dachte, dass sie an Maria schreiben müsse. Sie scheute die Nüchternheit der Tochter in Lebenslagen, die sie, Elsa, trostlos machten. Maria steckte in Prüfungen und würde nicht kommen können.
Am Morgen fuhren sie zum Hauptbahnhof, hoffend, dass Luise eine Einreisegenehmigung erhalten habe.
Der Querbahnsteig war beflaggt. Elsa las mechanisch das Transparent über dem Ausgang zur Westhalle: FEST VERBUNDEN MIT DEN MASSEN - VORWÄRTS ZUM SIEG DES SOZIALISMUS. Der Interzonenzug aus Köln über Dortmund lief ein.
Luise trug schon Trauer. Strümpfe, Kleid, Tasche. Schwarz! Sie kam mit kleinen, hastigen Schritten. Blass, übernächtig, die Frisur zerdrückt, Angst in den Augen. Fehlt nur der Kranz, dachte Elsa. Musst du wie ein Totenvogel aussehen! Mutter lebt noch.
Sie umarmten einander.
Wir fahren gleich raus!, ordnete Elisabeth an.
Ida Teubler hatte die Nacht hindurch mit ihren Gesichten gerungen, sich in die Tiefe der Zeit sinken lassen, zu den Generationen, die ihre Vorfahren waren. Sie wollte zu ihnen.
Sie hörte ihre Töchter ins Zimmer treten. Elisabeth kam an ihr Bett, berührte mit kühler Hand ihre Stirn und rief sie: Mutter! Luise ist gekommen.
Ja, antwortete sie stumm. Sie spürte, wie Hände die ihren fassten, erst die eine, dann die andere. Sie vernahm Luises Stimme, die sagte: Sie ist ganz heiß! Wird sie denn zu Bewusstsein kommen?
Bewusstsein, dachte Ida. So bei Bewusstsein war ich mein Leben nicht. Sie fühlte, dass Elsa neben ihr stand, hörte sie schniefen und redete lautlos: Hör schon auf! Wir sehen uns bald. Dann ist auch kein Herzeleid mehr für dich. So ist das. Genau so. Und du Elisabeth bist eine Braut. Hast dein Meister gefunden in den Kerl, den du heiratest, wenn das Elsken dann gestorben ist.
Luise! Dein Herz ist bitter. Aus das wächst nix als der Panzer, der jeden Tag dicker wird und abtötet, was lebendig in dich war. Ich kann dich nun nicht mehr helfen. Meine Mutta war eine ordentliche Frau. Bin auf den Küchenfußboden in die Welt gekommen, als sie ihn geschrubbt hatte. Danach hat sie noch mal geschrubbt. Acht Kinder hatte sie. Ich war das Letzte. Mein Vatta haben sie nach ein schlagendes Wetter aus den Schacht geholt. Ist nie wieder eingefahren. Saß in die Küche und sagte kein Ton. Mutta wusch für die Schlafburschen. Brachte uns fast alle durch. Als ich mit dich ging, war er tot, und sie schrie: Ein Glück, dass er das nicht mit ansehen muss. Ich sann auf Mord. Aber du kamst davon. War keine Liebe zwischen mich und dich. Mit deine Schwestern ist's nicht besser. Die nehmens sich nicht so zu Herzen.
Der helle Tag lag im Zimmer. Auf dem feucht gewischtem Linoleum. Auf dem Laken. Auf den Gesichtern der Frauen, die um das Bett saßen.
Seit sie eintraten und Elisabeth die Mutter angesprochen hatte, Stunden war das her, war kein Wort gefallen.
Luise hatte eines der großen Fenster geöffnet. Eine Hummel verirrte sich herein. Ihr Brummen ließ die Ruhe heiter erscheinen. Im Krankenhauspark rief ein Kuckuck.
Elsa versuchte die Arme im Nacken zu verschränken und den Kopf hineinzudrücken. Trotz der Stunde genoss sie die Sonne auf ihrem Gesicht, geschlossenen Auges die Rufe des Vogels zählend. Er rief und rief. Er rief schlecht. Selten gelang ihm die reine Terz, meist rutschte er einen viertel Ton hinauf.
Oh meine Schulter!, stöhnte Elsa. Ich habe gestern den Termin verpasst. Sie ist so rabiat, die Frau. Ich muss schreien, wenn sie mich anfasst. Aber ein bisschen krieg ich den Arm schon höher. Sie sprach mehr zu sich selbst als zu den andern. Sie musste eine Stimme hören und sei es die eigene. Wenns kommt, kommt alles auf einmal, setzte sie hinzu.
Auf Luises Gliedern lastete die Müdigkeit der durchfahrenen Nacht. An den Wandschirm gelehnt, schnarchte sie leise.
Elisabeth wachte. Die Sonne hatte das Ende des Bettes erfasst, wanderte hin zu den Händen der Mutter, die das fahrige Suchen mit einem Mal ließen. In breiter Bahn floss das Licht verschwenderisch über die Kissen, über das Antlitz, das nicht mehr gedunsen war. Straff lag die Haut den Jochbeinen an. Nase und Kinn wurden spitz. Wie Seidenpapier deckten die Lider die Augäpfel, die sich zuckend bewegten.
Elisabeth erhob sich, um den Vorhang vor die Sonne zu ziehen. Als sie zurückkam, standen die Augen der Mutter offen und blickten auf ihre um sie versammelten Töchter. Der Blick war von solcher Kraft, dass er die Schläfrigkeit Luises durchdrang und Elsas schweifende Gedanken zügelte.
Die Mutter begann zu singen. Hell und kunstlos: In der Welt ist's dunkel./ Leuchten müssen wir./ Du in deiner Ecke, du in deiner Ecke / ich in meiner hier, ich in meiner hier.
Es dauerte Stunden. Immer wieder sang die Mutter. Schien in Verschnaufpausen Kräfte zu sammeln um vier Verse zu wiederholen, als wären die ihr Vermächtnis.
Als Elisabeth und eine Krankenschwester noch einmal das Laken der Mutter wechselten, drückte sich Elsa aus dem Zimmer, lief durch den nach Karbol riechenden Flur hinaus in den Nachmittag. Durchbrach Gesträuch und fand sich auf dem rasenbewachsenen Grund eines Teiches. Löwenzahn blühte. Ihre Füße taumelten durch die winzigen Sonnen. Im Haus sang die Mutter noch immer. Elsa riss eine Blüte ab. Milchiger Saft floss klebrig über ihre Finger. Die Blütenblätter fühlten sich an wie seidiges Fell. Verzweifelte Sehnsucht nach Zärtlichkeit weckte diese Berührung. Wie in keinem Augenblick zuvor begriff sie, dass sie endgültig verlassen wurde. Dass sie allein zurückblieb. Mehr allein als je zuvor.
Sie ging zurück. Sagte zu ihren Schwestern: Wir wollen uns nie im Stich lassen. Versprecht es!
Elsken, versicherte Luise, das kannst du mir glauben. Hier, vor unserer Mutter, wollen wir es uns geloben. Was auch kommt, wir stehen einander bei! Sie streckte ihre große, weiche Hand übers Bett. Elsa ergriff sie. Ihre Hände waren noch immer kindlich klein, aber fest und im Zupacken geübt.
Elisabeths Augen waren schwarz in diesem Augenblick und ihr Mund war ein Strich. Sie legte ihre, wie eine Leopardenhaut gescheckte, Hand auf die Hände der Schwestern.
Wir schwören es dir, sagte Elsa zur Mutter. Wir schwören es, wiederholte Luise. Elisabeth sagte kein Wort.
2
Fast ein Jahr war vergangen. Ein Kind wollte geboren werden. Ich, Maria, Elsas Tochter, stand vor meiner zweiten Niederkunft. Elsa kam zu Ostern nach P. Mir war es zu anstrengend, mit Anette, die zwei Jahre alt war, die Reise nach Leipzig zu machen.
Elsa schien sich wohlzufühlen. Ich war froh, dass sie sich mit Anette beschäftigte und mich in Ruhe ließ.
Nach Hause zurückgekehrt, fand Elsa eine Postkarte vor, die sie nichts anzugehen schien. Die Lungenfürsorge bestellte sie in die Menckestraße zum Röntgen. Ich war doch erst, schrieb sie mir ärgerlich. Die Schussel! Das muss ein Irrtum sein.
Elsa sah die Reihenröntgenuntersuchungen für sich als überflüssig an, obwohl Karl Teubler vor ihren Augen an Tuberkulose zugrunde gegangen war. Sie glaubte sich gegen diese Krankheit gefeit. Sie hatte es im Kreuz. Und im Schultergelenk. Nicht auf der Lunge. Aber es schien kein Irrtum zu sein. Zu ihrem Erstaunen schloss sich dem neuerlichen Röntgen eine ganze Reihe von Untersuchungen an.
In der Abteilung Herrenkonfektion des HO-Warenhauses musste die Frühjahrskollektion an den Mann gebracht werden. Und sie wurde krankgeschrieben. Das vor allem ärgerte sie.
Sie hoffte, zu Pfingsten gesund geschrieben zu sein, um nach P. kommen zu können. Dann sollte Maria entbunden haben.
Luise kam eine Woche vor Pfingsten zu ihrem jährlichen Besuch nach Leipzig.
Am Abend vor ihrer Ankunft machte sich Elisabeth in strömendem Regen auf, um mit Elsa zu bereden, bei wem die Schwester wohnen sollte.
Hier nicht, sagte Elsa sofort. Ich habe den Kopf voll. Und ich muss zu Maria.
Elisabeth atmete heimlich auf, war froh, dass Elsa nicht von ihrem Röntgenbefund sprach, und ihre eigenen Befürchtungen nicht zu teilen schien. Elisabeth besaß genügend medizinisches Wissen, um sich über das Ausmaß der Untersuchungen, denen sich Elsa unterziehen musste, zu beunruhigen.
Komm aber zum Bahnhof, bat sie.
Elsa verspätete sich. Der Interzonenzug aus Köln über Dortmund war längst eingefahren. Die beiden Frauen standen auf dem Querbahnsteig, unschlüssig, ob sie noch warten sollten. Luises schweren Körper umhüllte ein glänzender, schwarzer Regenmantel. Elisabeth hatte um ihre Fülle einen schwarzblau changierenden Seidenmantel gelegt. Wie aufgeplusterte Krähen sehen sie aus, dachte Elsa.
Die Vögel steckten mit geschwollenen Füßen in Gesundheitsschuhen. Elsa nahm mit Genugtuung wahr, dass sie keinen Vergleich mit ihren Schwestern zu scheuen brauchte. In der Kindheit hatte sie Luise um ihren Zopf beneidet, Elisabeth um ihre ganze Person. Das war vorbei. Meine Beine können sich neben ihren immer noch sehen lassen!, denkt Elsa.
Vor einem Jahr noch war ihre sportliche Taille unverkennbar. Ihr rundes Gesicht ist voller geworden aber sie hat kein Doppelkinn. Ihr Fleisch ist fest. Ihr Haar hat seine schwarzbraune Farbe noch immer. Die grauen Haare reißt sie heraus. Sie pflegt sich, denn sie steht als Verkäuferin in der Öffentlichkeit. Sie zupft sich noch immer die Brauen und pudert ihre kleine, zum Glänzen neigende Nase. Das Rot, das sie sich auf die Lippen gelegt hat, ist nur noch auf der oberen vorhanden, da sie die Angewohnheit hat, die untere Lippe hinter die Zähne zu ziehen und zu belecken, wenn sie einem Gedanken nachhängt. Dieser Gedanke ist jetzt in ihren Augen zu lesen, genaue Spiegel ihrer Regungen, Körper von dunklem, lebhaftem Glanz. Die Schwestern wollten das Funkeln in Elsas Augen für Freude halten. Luise hob ihre Flügel, sie um das Jüngste zu schlagen, aber Elsa zeigte ihnen die kalte Schulter, musterte Luise über die Achsel und anstatt sich in ihre Arme zu begeben oder wenigstens guten Tag zu wünschen, sagte sie: Warst du beim Friseur? Du hattest mal ein Blond wie Asche.
Luise ließ die Arme sinken. Es ist nur dunkler geworden, sagte sie. Nain, ich mach da nix dran! Nur waschen und legen.
Elisabeth sagte: Wir leisten uns jetzt ein Taxi und fahren zu mir. Sie bestand darauf, dass Elsa mitkam. Wenigstens auf einen Kaffee!
Elisabeths Wohnung lag im vierten Stock eines Hauses in der Ernst-Thälmann-Straße. Als sie Frau Pinkert geworden war und mit Max, ihrem Mann, in den Dreißigerjahren dort einzog, hieß sie Eisenbahnstraße. Elsa nannte sie heute noch so.
Die zweiflügelige Wohnungstür ließ Geräumigkeit erwarten. Aber hinter ihr lag ein nur winziger Vorraum. Von ihm führten Türen zu Küche und Schlafzimmer. Sommers wie winters hingen an den Garderobenhaken sämtliche Jacken und Mäntel Elisabeths. Man konnte sich kaum drehen. Die Küchentür ging nach innen auf, gebremst vom Küchenschrank, der, des Sofas wegen, das Elisabeth zwischen Schrank und Fenster gezwängt hatte, der Tür im Wege stand. Die Wand hinterm Sofa bedeckte ein Gobelin mit Elfen. Elsa fand ihn geschmacklos. Dem Sofa gegenüber drückte sich der Tisch an die Wand. Zwischen ihm und dem Sofa und zwischen Tisch und dem Herd klemmten zwei Stühle. Den gemauerten Herd benutzte Elisabeth nie. Er diente einer elektrischen Kochplatte als Fundament und Elisabeth zum Abstellen ihrer Töpfe und Tiegel.
Zieht euch aus und kommt rein!
Letzteres war unmöglich, solange sie sich zwischen Kochplatte und Wasserhahn bewegte. Der Ausguss nämlich, über dem er angebracht war, befand sich an dem Wandstück zwischen Herd und Tür.
Den Kaffee nehmen wir aber von mir, sagte Luise im Vorraum. Dazu habe ich ihn ja mitgebracht. Sie stieß die Tür zum Schlafzimmer auf und setzte ihre Koffer neben das monströse Ehebett, in dem sie zwei Wochen mit Elisabeth um die Wette schnarchen würde. Elsa versuchte, in die Küche zu gelangen, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass es sie interessiere, was Luise in ihren Koffern habe. Und noch ehe Luise die Küche betrat, spürte Elsa die wohlbekannte Wut, die von Kindesbeinen an in ihr aufstieg, wenn die Schwester sie in die Lage brachte, Dankbarkeit zeigen zu sollen. Stumm nahm sie ein Pfund in Folie geschweißtes Bauchfleisch, zwei Eckchen Käse und einen blau-weißen Kleiderstoff, der ihr sofort missfiel, und für Maria ein Seidentuch mit lila Tupfen entgegen. Elsa war überzeugt, dass ihre Tochter diese Tupfen verabscheuen würde.
Na? Freust du dich auch? fragte Luise, und entblößte ihre dritten Zähne.
Danke, murmelte Elsa. Ich wollte nichts.
Na freu dich man! Ich gebs gern, sagte Luise unbeirrt. Ich habe nun mal eine offene Hand.
Fröstelnd eilte Elsa von der Schönefelder Endstelle der Siebzehn die Vollbedingstraße entlang zur Unterführung der Gleise, über die Luises Zug vor drei Stunden in die Stadt gedonnert war. Sie fühlte sich in dieser Gegend unbehaust. In sehr ferner Zeit, im letzten Sommer vor dem Krieg, war sie hier mit Mann und Kind zum Freibad gelaufen. Sie hatten Maria zwischen sich getragen, in einem behenkelten Sitz aus derbem Leinen. Elsa wusste nicht mehr, wie peinlich ihr das lodernde Rot des Kinderschopfes war, das alle Blicke auf sich zog. Andere Leute hatten reizende Kinder mit blonden oder braunen Korkenzieherlöckchen, mit Äuglein wie Engel, die fielen nie hin und machten sich nicht schmutzig. Maria war ein hässliches Entlein. Ihre sommersprossenübersäte Haut fand nicht ihresgleichen, und ihre grünen Katzenaugen unter farblosen Wimpern vertrugen Sonne so schlecht wie diese Haut, sodass das Kind auf schattenlosen Straßen vor Unbehagen brüllte. Knie und Arme waren immer aufgeschlagen, und hatte Elsa ihre „Kröte" schick gemacht, passierte bestimmt ein Malheur, das Gamaschenhose oder Organdykleid zu „Gelumpe" machte. Im Wasser war das Kind in seinem Element. Es wollte niemals heraus, auch nicht, wenn die Lippen längst blau waren und sich seine Sommersprossen in eine Gänsehaut zurückgezogen hatten. Herbert sagte dann: Ganz wie du. Denn im Wasser wurde Elsa zum Fisch und auf dem Sprungbrett zum Vogel, der sich in dessen Tiefe schnellt. Herbert mochte Bodenlosigkeiten nicht und kein Getümmel. Maria im Planschbecken verlor er keinen Moment aus den Augen.
Elsa tauchte aus der feuchtglitschigen Eisenbahnunterführung erleichtert ans Licht. In der Theresienstraße, neben der Mauer des Nordfriedhofs, fühlte sie sich wieder heimisch.
Sie hielt durchs Friedhofstor und über die Straße nach der Schwiegermutter Ausschau. Nicht fünf Minuten brauchte die zum Grab ihres Alten! Elsas Blick ging zu den Fenstern des dritten Stockes des Hauses Nummer neunundfünfzig der dem Friedhof gegenüberliegenden Straße. Sie erkannte die Spitzenstores und daran, dass diese Fenster in der Sonne anders blitzten als die benachbarten: Die Alte hatte Frühjahrsputz gehalten. Wie von allein gingen Elsas Füße vorbei an Häusern mit Zwiebeltürmen, den mayerschen Häusern, hin zu dem Haus, in dem sie durch fünfundzwanzig Jahre mit wechselnden Gefühlen drei Treppen zur Wohnung ihrer Schwiegermutter hinaufgestiegen war.
Der Hausflur war sauber und still, die Holztreppen dufteten nach Wachs. Jede Bohle der geräumigen Treppenabsätze, jede Stufe glänzte von der ihr Jahrzehnte zuteilgewordenen Pflege. Die Treppenfenster gaben den Blick auf den mit roten Backsteinen gepflasterten Hof und ebensolchen Nachbarhöfen frei, an die sich grüne Wäschetrockenplätze legten. Und ehe der Blick die nächsten Häuser erreichte, schweifte er über Bleichen und Kinderspielplätze aus den Dreißigerjahren. Für eine Wohnung dort drüben hätte Elsa viel gegeben.
Sie gelangte auf den dritten Vorsaal und drückte die Klingel über dem in fleckenlos glänzendes Messing geschlagenen Namen: Richard Müller. Erleichtert nahm sie einen Schatten hinter dem grünen Kräuselglas in der Tür wahr. Das dürre Weiblein öffnete, ließ die Schwiegertochter eintreten, während es sich noch seine Hände an der Schürze trocknete.
Luise ist heute gekommen, sagte Elsa. Hab sie mit Elli vom Bahnhof geholt. Die Alte wartete auf eine andere Nachricht.
Mit Maria ist noch nichts.
Die Schwiegermutter seufzte.
Ich habe das Essen fertig, sagte sie. Iß was mit. Ein wehmütiges Gefühl beschlich Elsa in der vertrauten Küche. Es tauchte hin und wieder auf in letzter Zeit. Wie Trauer. Wie Abschied.
Die Kartoffeln sind immer noch gut, sagte die Großmutter, während sie aßen. Das werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen mit meinen Füßen. Sie hatte auch letzten Herbst wieder Kartoffeln mit dem Handwagen vom Lande geholt.
Du wirst uns allen noch was vormachen, sagte Elsa.
Die Alte fand den Kleiderstoff nicht so schlecht und lachte über die Drastik, mit der Elsa ihrem Ärger über Luise Luft machte. Sie riss dabei den Mund auf und Elsa erblickte den einzigen Zahn, der, bräunlich und fremd wie ein Stalagmit, vor der Gaumenhöhle stand.
Elsa blickte in das vertraute Gesicht, dessen Falten den Totenschädel schon durchscheinen ließen. Die tiefen Wangenlöcher, das fleischlose Kinn, die Zeichnung der Kiefer hinter schon fast unsichtbaren Lippen und die sich über den wässrigen Augen abzeichnenden Stirnbögen. Das weiße Haar, glatt hinter die Ohren gestrichen, im Nacken zu einem dünnen Zöpfchen geflochten und aufgesteckt, hatte sie dicht gesehen, zu einem Kauz gezwungen, der stärkste Haarnadeln brauchte.
Sie haben mir gestern die Kur gestrichen, sagte Elsa. Ein Jahr habe ich drum gekämpft. Nun sagen sie in der Menckestraße, erst muss klar sein, was die Schatten auf meiner Lunge bedeuten. Ins Moorbad könnten sie mich damit nicht schicken.
Wenn du's auf der Lunge hast, brauchst du eine andere Kur. Die Alte bewies es an Beispielen aus ihrem Bekanntenkreis von den Friedhofsbänken. Elsa hörte begierig zu.
Willst du mal dein Alpenveilchen sehn? fragte die Alte. Es hat dreiundzwanzig Blüten!
Die Wohnstube duftete nach frisch gewaschenen Gardinen. Der gestrichene Fußboden glänzte. Von diesem Fußboden konnte man essen.
Die Großmutter raffte den Store zur Seite und Elsa sah "ihr" Alpenveilchen: ein rot-weißer Blütenbusch zwischen schlierenlos blanken Doppelfenstern. Wie du das machst! sagte Elsa. Den Topf hatte sie vor Jahren herübergebracht. Mir geht alles ein.
Auf dem Schreibtisch neben dem Fenster standen Fotos von Anette. Die gleichen, wie auf Elsas Nachttisch und Elsa schnürte es die Kehle zu.
Ich bin morgen dort zum Essen, sagte sie und meinte: bei den Schwestern. Wenn eine Nachricht kommt, bringe ich dir Bescheid. Schon in der Tür zerrte sie das eingeschweißte Fleisch aus der Tasche. Nimm du's sagte sie. Die Großmutter wehrte ab.
Nimms nur, drängte Elsa. Es ist geräuchert und wird nicht gleich schlecht. Sie nötigte es ihr in die Hände. Aber lass vor denen nichts verlauten, falls ihr euch seht.
Die Alte schickte sich drein.
Elsa, von der Großmutter kommend, ging, entlang der Mauer des alten Jüdischen Friedhofs, nach Hause. Er grenzte an den Nordfriedhof und war ihr noch vertrauter, denn er lag unter ihren Fenstern. Das Hinterhaus, in dem sie wohnte, stand an der Mauer, die ihn gegen die Höfe der Hamburger Straße abschloss.