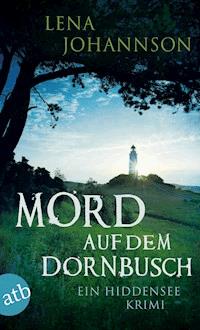Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hamburg-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal einer Schokoladen-Dynastie.
Hamburg, 1919: Das Kontor Hannemann & Tietz handelt nicht nur mit Kakao, sondern betreibt auch eine eigene Schokoladenmanufaktur. Frieda, jüngster Spross der traditionsreichen Kaufmannsfamilie, würde am liebsten ihre Tage in der Speicherstadt oder in der Schokoladenküche verbringen. Als ihr Vater sie mit dem Sohn eines befreundeten Handelspartners verheiraten will, um das Überleben der Firma zu sichern, bricht für Frieda eine Welt zusammen. Nicht nur, weil ihr Herz für einen anderen schlägt. Wird es ihr gelingen, das Erbe der Familie zu retten, ohne ihre Liebe zu verraten?
Authentisch und berührend: Nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über Lena Johannson
Lena Johannson, 1967 in Reinbek bei Hamburg geboren, war Buchhändlerin, bevor sie freie Autorin wurde. Vor einiger Zeit erfüllte sie sich einen Traum und zog an die Ostsee. Bei Rütten & Loening und im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Dünenmond«, »Rügensommer«, »Himmel über der Hallig«, »Der Sommer auf Usedom«, »Die Inselbahn«, »Liebesquartett auf Usedom«, »Strandzauber«, »Sommernächte und Lavendelküsse« sowie die Kriminalromane »Große Fische« und »Mord auf dem Dornbusch« lieferbar. Mehr Information zur Autorin unter www.lena-johannson.de.
Informationen zum Buch
Das Schicksal einer Schokoladen-Dynastie
Hamburg, 1919: Das Kontor Hannemann & Tietz handelt nicht nur mit Kakao, sondern betreibt auch eine eigene Schokoladenmanufaktur. Frieda, jüngster Spross der traditionsreichen Kaufmannsfamilie, würde am liebsten ihre Tage in der Speicherstadt oder in der Schokoladenküche verbringen. Als ihr Vater sie mit dem Sohn eines befreundeten Handelspartners verheiraten will, um das Überleben der Firma zu sichern, bricht für Frieda eine Welt zusammen. Nicht nur, weil ihr Herz für einen anderen schlägt. Wird es ihr gelingen, das Erbe der Familie zu retten, ohne ihre Liebe zu verraten?
Authentisch und berührend: Nach dem Vorbild eines Hamburger Kakao-Kontors
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Lena Johannson
Die Villa an der Elbchaussee
Die Geschichte einer Schokoladendynastie
Roman
Inhaltsübersicht
Über Lena Johannson
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Anmerkung & Nachwort
Danksagung
Impressum
Kapitel 1
Frühjahr 1919
Frieda blinzelte, sie musste ihre Augen mit den Händen abschirmen, so hell waren die Strahlen der Sonne. Nie hätte sie sich vorstellen können, welche Leuchtkraft sie in diesem Teil der Erde hatte. Zu Hause hätte ihre Mutter sie längst ermahnt, die Arme zu bedecken, damit ihre Haut nicht den weißlichen Schimmer verlöre, der an Porzellan erinnern sollte. Doch ihre Mutter war weit weg. Frieda fühlte sich frei. Hier fehlte ihr nichts, höchstens der leichte Wind, der meist über die Alster strich. Immerhin spendete das Blätterdach der Baumriesen, die rund um die Plantage standen, ein wenig Schatten.
Ein großer, türkis und nachtblau schimmernder Schmetterling setzte sich auf Friedas Schuh. Sie lächelte und blickte ihm nach, als er in die flirrende Hitze davonflog, zwischen hohen knorrigen Bäumen hindurch, die gelbe und rötlichbraune Kakaofrüchte trugen. Eine besonders große lag, in zwei Hälften geschlagen, am Boden. Ihre Samen würden schon bald als Kakaobohnen in Säcken nach Hamburg verschifft werden.
»Sehe sich einer diese Schlafmütze an! Anscheinend hat sich hier nichts geändert. Das gnädige Fräulein liegt auf der faulen Haut herum, während da draußen die Welt einfach nicht zu Verstande kommen will.«
Frieda schreckte auf. Das Buch über die Geschichte des Kakao-Anbaus, in dem sie nach dem Mittagessen gelesen hatte, rutschte ihr polternd von den Knien. Das war Ernsts Stimme. Unmöglich. Ernst war doch eingezogen worden, noch auf die letzten Tage. Mit klopfendem Herzen öffnete sie die Augen und blickte geradewegs in sein verschmitzt lächelndes Gesicht.
»Ernst!« Sie sprang auf, schlang die Arme um ihn und drückte ihn an sich. Dünn war er geworden.
»Aua! Willst du mich umbringen?« Er schob sie von sich und lachte ein wenig bemüht. »Glaubst du etwa, ich bin den Gewehrkugeln und Granaten ausgewichen und habe mich in Afrika durchgeschlagen, damit du mich jetzt zur Strecke bringst?« Er schnaufte übertrieben.
Typisch Ernst! Als ob es das Normalste der Welt wäre, dass er plötzlich wieder vor ihr stand. Obwohl … typisch? Da war ein Schatten in seinem Blick, der ihr fremd war.
»Ist das alles, was dir einfällt, wenn du mich nach mehr als zwölf langen Monaten wiedersiehst? Schöne Begrüßung«, sagte sie, aber der flapsige Ton wollte ihr nicht recht gelingen.
Ernst Krüger hob die Hand zur Mütze: »Melde mich gehorsamst zurück, Fräulein Hannemann!« Dann streckte er ihr etwas ungelenk die Hand entgegen, ein Hauch von Röte huschte über seine Wangen. »Schön, wieder hier zu sein.« Er räusperte sich, blickte zu Boden, schwieg.
Unschlüssig standen sie sich in der großen Diele gegenüber.
Endlich. An jedem einzelnen Tag hatte sie diesen Moment herbeigesehnt. Die Pendeluhr tickte, als sei nichts geschehen. Auf dem Tischchen neben dem roten Ledersessel stand ein Strauß prächtiger Amaryllis. Alles war so wie immer. Nur dass Ernst endlich wieder da war.
»Ja«, sagte sie, ihre Stimme war plötzlich brüchig, »es ist wirklich schön, dass du wieder da bist.«
Ernst war anderthalb Jahre jünger als sie und ihr beinahe so vertraut wie ihr Bruder. Seit sie denken konnte, lebte er mit seiner Mutter im Gesindetrakt des Hannemannschen Kontorhauses in der Bergstraße. Frieda hatte ihn praktisch täglich gesehen, solange ihre Familie dort selbst noch gelebt hatte. Seine Mutter band Friedas Mutter das Mieder, schnürte ihr die Schuhe und kochte für die Hannemanns. Friedas Mutter fand, dass Ernst kein Umgang für die Tochter eines hanseatischen Kaufmanns war. Doch die beiden kannten sich nun einmal von Kindesbeinen an und verstanden sich prächtig. Und so ließen ihre Eltern Frieda gewähren. Ihre Mutter hoffte wohl, die Jahre würden diese unpassende Freundschaft von ganz alleine beenden. Auch nach dem Umzug in die Villa in der Deichstraße sahen die beiden sich fast jeden Tag. Ernst war mit zehn der Laufbursche ihres Vaters geworden, also ging er auch in dem neuen Haus ein und aus. Bis er plötzlich in den Krieg musste. Zwar verabscheute er das Gemetzel, glaubte aber, dass er als Soldat so manche Zulage bekäme, die er für seine Mutter sparen konnte. Und jeder Mann wurde gebraucht, selbst wenn er noch gar keiner war. »Kanonenfutter«, hatte ihr Vater damals gesagt und den Kopf geschüttelt. »Es ist ein Jammer!«
Frieda würde nie vergessen, wie erschrocken sie gewesen war, als sie von Ernsts Plänen hörte. Damit hätte sie nie gerechnet. Bei ihrem Bruder war es anders gewesen. Hans hatte sich gleich zu Beginn in das große Abenteuer gestürzt, wie er es genannt hatte. Aus freien Stücken und mit ungestümer Begeisterung.
»Wirst sehen, Schwesterchen, Weihnachten bin ich zurück. Dann bin ich ein Held. Und die jungen Damen werden Schlange stehen, um mit mir auszugehen.« Frieda verstand nicht, warum er dafür erst ein Held sein wollte, die jungen Damen hatten doch auch so schon auf der Straße die Köpfe nach ihm verdreht. Ihr geliebter Bruder Hans. Fünfmal hatten sie nun schon Weihnachten gefeiert. Ohne ihn. Wenn er nur auch endlich nach Hause käme …
Ernst räusperte sich und trat von einem Fuß auf den anderen. Sentimentalitäten waren noch nie seine Sache gewesen.
Frieda dagegen hätte ihn am liebsten schon wieder umarmt.
»Du bist zurück. Du bist wirklich wieder zurück! Wie geht es dir denn?«
»Ich hatte wohl noch Glück. Alles in allem.« Er blickte auf seine ausgetretenen Schuhe. »Bin in französische Gefangenschaft geraten und dann nach Afrika gekommen. Da hab ich den Besitzer einer Kakaoplantage kennengelernt und konnte mich gleich ’n büschen nützlich machen. Dadurch ist es mir nicht schlecht ergangen.« Ein schiefes Lächeln. »Wollte trotzdem nach Hause. Wusste doch, dass ich hier gebraucht werde. Am Ende geht Hamburch noch unter ohne mich.«
»Da hast du recht. Es stand kurz davor«, antwortete Frieda lächelnd. Dann fiel ihr Blick auf den zerschlissenen Koffer, der – nur noch von Riemen und Kordeln zusammengehalten – mitten in der Diele stand. »Du bist wahrhaftig gerade erst angekommen«, stellte sie fest. »Hast du deine Mutter überhaupt schon gesehen?«
Ernst schüttelte den Kopf. »Wie geht’s ihr denn?«
Schöner Mist, hätte sie bloß den Mund gehalten. »Es war nicht leicht für sie.« Frieda zögerte. »Na ja, ohne ihre beiden Männer … Sie hat den Anzug deines Vaters zur Ablieferungsstelle gebracht.« Bloß nicht aufblicken, bloß nicht ihm in die Augen sehen müssen. »Und ihren Ehering auch«, fügte sie leise hinzu. »Das war die Anordnung, sie konnte nicht anders. Das Geld hat sie ein paar Wochen über Wasser gehalten, aber dann musste sie sich im Hafen etwas dazuverdienen. Die Arbeit ist ihr gehörig auf die Knochen geschlagen, fürchte ich. Es tut mir leid, Ernst, ich …«
»Frieda, mein Herz?« Frieda verdrehte die Augen, sie konnte es nicht ausstehen, wenn ihre Mutter sie so nannte.
»Die gnädige Frau«, flüsterte Ernst und griente kurz.
»Entweder soll ich ihr das Haar flechten oder ihr vorlesen, damit ihr das Sticken nicht zu langweilig wird. Wollen wir wetten?«
»Na, mach schon! Geh du zu deiner Mutter, ich schaue mal, wo meine steckt.«
»Sie wird in der Küche sein, um für Vater den Nachmittagskaffee zuzubereiten.«
»Vielleicht habe ich Glück und kann ein Zuckerstück stibitzen.« Ernsts Augen leuchteten.
»Wenn du wirklich Glück hast, bekommst du ein Stückchen von der guten Hannemannschen Schokolade«, erklärte Frieda stolz.
»Was soll das sein?«
»Frieda, Kind, wo steckst du nur wieder?«, der Tonfall ihrer Mutter war jetzt deutlich ungeduldiger.
»Erkläre ich dir später«, sagte sie daher eilig und raffte ihr Kleid. »Morgen früh an unserem alten Geheimplatz?«
Frieda hatte richtiggelegen, sie sollte ihrer Mutter die Haare machen und dabei mit ihr plaudern. Es war nicht so, dass Frieda nicht gern einen Plausch mit ihrer Mutter hielt, sie waren einfach nur selten einer Meinung. Für Rosemarie Hannemann bestand ihr Lebenswerk darin, zwei gesunde Kinder zur Welt gebracht zu haben, dem Haushalt eines angesehenen und stadtbekannten Kaufmanns inklusive einer kleinen Schar Bediensteter vorzustehen, stets nach der neusten Mode gekleidet zu sein und hübsch auszusehen. Damit war sie zufrieden. Für Frieda war das unbegreiflich, das konnte doch nicht alles sein. Die Welt war doch so viel größer und stand jedem offen. Gerade in diesen Zeiten. Wenn die Wirren des Krieges sich erst gelegt hatten, wollte Frieda reisen, sie wollte lernen – studieren vielleicht. Es gab so viele Möglichkeiten, dass sie am meisten Angst davor hatte, sich nicht entscheiden zu können. Und ihre Mutter? Sie begnügte sich damit, stolz auf ihren Hausstand, ihr beherrschtes Naturell und ihre Geduld zu sein. Selbst die Tatsache, dass ihr Mann Albert nur wenig Zeit für seine Ehefrau hatte, was sie zu einsamen Stunden der Langeweile verdammte, nahm sie mit großem Gleichmut hin.
»Nun, Frieda, mit wem hast du gesprochen?«
»Stell dir vor, Mutter, Ernst ist aus dem Krieg zurück. Ist das nicht wunderbar? Gertrud wird ganz außer sich sein vor Freude«, erzählte sie strahlend, während sie das kastanienfarbene Haar ihrer Mutter zu zwei dicken Zöpfen flocht, die sie später zu einer Schnecke auf ihrem Kopf auftürmen würde.
»Der Ernst, wirklich? Das ist eine gute Nachricht«, entgegnete Rosemarie leise. Ihre Stimme klang so dünn, als könnte sie im nächsten Moment brechen. In ihrer Freude hatte Frieda gar nicht daran gedacht, was die Neuigkeit bei ihrer Mutter auslösen würde. Natürlich dachte sie an Hans, daran, wie sehr sie selber hoffte, ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Schuldbewusst schwieg Frieda; am besten, sie brachte ihre Mutter schnell wieder auf andere Gedanken.
»Nicht wahr? Er scheint gesund und munter zu sein, nur noch schmaler ist er geworden. Vielleicht könnten wir ihnen etwas von unserer Trinkschokolade spendieren. Frau Krüger kann es auch gebrauchen. Sie ist ja nur noch Haut und Knochen.« Frieda hatte sich mit einem Knie auf die Chaiselongue gestützt und legte eine Strähne über die andere.
»Niemand zwingt sie, im Hafen zu arbeiten. Sie hat doch bei uns ihr Auskommen, wie schon all die Jahre. Wenn ihr das plötzlich nicht mehr reicht …«
Frieda hielt in der Bewegung inne und blickte fassungslos auf ihre Mutter, die die sorgfältig manikürten Hände in den Schoß legte.
»Es hat noch nie gereicht.« Rosemarie sah überrascht zu ihrer Tochter auf, der eine Strähne aus den Fingern glitt. »Stillhalten, Mama! Was glaubst denn du, kein Mensch kann von dem bisschen eine Familie ernähren. Wusstest du nicht, dass sie nach dem Tod ihres Mannes immer wieder Schwierigkeiten hatte, Ernst und sich durchzubringen? Sie arbeitet gewiss nicht zum Vergnügen im Hafen. Wenn ihr der guten Frau ein paar Pfennige mehr im Monat gebt, würde sie auf der Stelle dort aufhören.«
Rosemarie seufzte. »Du bist zu großzügig, mein Herz. Wir sollen ihr Trinkschokolade spendieren und der Krügerschen auch noch mehr bezahlen. An uns ist der Krieg auch nicht spurlos vorbeigegangen. Ich habe Senator Lattmann für die Witwen und Waisen und für die Verwundeten schon eine nicht unerhebliche Summe gegeben. Wir können nicht alle Welt durchfüttern.« Frieda merkte, wie der Ärger in ihr wuchs. Noch zu gut erinnerte sie sich daran, wie konsterniert ihre Mutter gewesen war, als ihr Vater damals dem Spendenaufruf des Senators gefolgt war, allzu großzügig, wie Rosemarie damals gemeint hatte. Und jetzt soll das ihr Verdienst gewesen sein?
Eine Weile schwiegen sie. »Wenn dein Vater sich nur endlich um die Reparatur unseres Grammophons kümmern würde«, sagte Rosemarie schließlich und seufzte. »Dann hätte ich wenigstens etwas Zerstreuung und Ablenkung.«
»Wir könnten in das Völkerkundemuseum gehen«, schlug Frieda vor.
»Liebe Güte, mein Herz, was soll ich da?«
Frieda hätte sich gern fremdartige Kleider, Boote, wie man sie im Hamburger Hafen nicht sehen konnte, die irdenen Schalen und Krummsäbel angeschaut und ein bisschen von der weiten Welt geträumt.
»Erinnerst du dich an diese schreckliche Schau bei Hagenbeck?«, fragte ihre Mutter plötzlich. »Du warst noch ganz klein, gerade sieben oder vielleicht acht Jahre alt. Und du hattest keine Angst! Mir läuft noch heute ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur daran denke, wie nah du an diese Indianer herangegangen bist.«
Frieda steckte die letzte Haarnadel fest und ließ sich neben ihre Mutter auf die Chaiselongue gleiten. »Sie waren doch freundlich, wovor hätte ich Angst haben sollen?«
»Freundlich?« Rosemarie tastete die frisch gesteckte Frisur ab, zückte einen perlenbesetzten Handspiegel und betrachtete das Werk ihrer Tochter. »Wenn ich nur an die Hautfarbe denke, so dunkel und rot, als hätte die Sonne sie vollkommen verbrannt. Und diese Bemalung …« Nach einem weiteren Blick auf ihren perfekt gepuderten Teint steckte sie mit einem zufriedenen Nicken den Spiegel wieder weg. »Nein, mein Herz, es waren schaurige Gestalten.«
Zum Abendessen servierte Henriette den ersten Spargel aus den Marschlanden, dazu Ewerscholle. Das weiße Tischtuch war perfekt gestärkt, das Porzellan glänzte mit dem Tafelsilber um die Wette. Etwas anderes hätte Mutter selbst dann nicht hingenommen, wenn um sie herum alles in Schutt und Asche gelegen hätte.
»Ein kräftiges Stück Fleisch wär mir lieber«, brummte Großvater Carl, nachdem Mutter das Tischgebet gesprochen und allen einen guten Appetit gewünscht hatte. »Ich weiß nicht, warum alle so verrückt nach diesem Spargel sind.«
»Mit zerlassener Butter ist er ein Gedicht«, schwärmte Vater. »Es ist mir ein Rätsel, dass du dich nicht dafür begeistern kannst, Vater. Wenn du Rosemarie sehr freundlich bittest, kommt morgen womöglich Stubenküken auf den Tisch. Das gab es lange nicht, was, Röschen?«
»Butter und Stubenküken«, murmelte Frieda vor sich hin, »Gertrud Krüger wäre froh, wenn sie Ernst ein solches Willkommensmahl auftischen könnte. Ganz dünn ist er im Krieg geworden«, sagte sie jetzt lauter, um sicherzugehen, dass ihr Großvater auch jedes Wort verstand. Seit einigen Jahren konnte er nicht mehr so gut hören. »Dafür sehe ich ein bisschen schlechter«, pflegte er gern zu scherzen.
»Die brauchen keine Butter. Einen ordentlichen Kakao brauchen die«, verkündete er. Frieda lächelte stillvergnügt. Genau diese Reaktion hatte sie sich erhofft.
»Kakao bringt einen Menschen wieder auf die Beine«, begann Großvater, »sogar den, der durch Krankheit oder durch ungeschickte Arznei der promovierten Quacksalber und graduierten Idioten entkräftet ist.«
»Du hast so recht, Großpapa. Sollten wir den Krügers dann nicht etwas von unserer guten Trinkschokolade bringen? Jetzt, wo doch Ernst wieder aus dem Krieg da ist?«
Sie sah ein fröhliches Blitzen in den Augen ihres Vaters.
»Ja, davon sollten sie etwas haben«, stimmte Carl zu. »Damit kommen sie wieder zu Kräften.«
»Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass du zu spendabel bist, mein Herz«, mahnte Rosemarie.
»Wir kennen Ernst, seit er auf der Welt ist«, entgegnete Vater sanft. »Zwei Dosen unserer guten Schokoladenflocken stürzen uns nicht ins Verderben. Komm mich morgen in meinem Kontor besuchen, Sternchen. Ich denke, Gertrud wird sich freuen, wenn du ihr das Geschenk machst.« Frieda strahlte, ihre Mutter köpfte mit sparsamem Blick eine Stange Spargel, enthielt sich aber eines weiteren Kommentars. Großvater Carl schien vergessen zu haben, dass er dem Gemüse aus den Marschlanden nichts abgewinnen konnte, und ließ sich von Henriette eine weitere Portion auflegen. Auf dem Kaminsims tickte die Uhr aus Nussbaum, und von der langen Wand gegenüber den Fenstern blickte Friedas Urgroßvater Theodor Carl streng aus seinem goldenen Rahmen. Er hatte Hannemann & Tietz Import von Kolonialwaren mit einem Kompagnon gegründet und beim Großen Brand 1842, als halb Hamburg in Flammen aufgegangen war, irgendetwas Bedeutendes vollbracht. Viel mehr wusste Frieda nicht von ihm.
Ihre Mutter seufzte vernehmlich.
»Nun, Röschen, was bedrückt dein Herz?«, fragte Albert.
»Es freut mich ja, dass Ernst wieder zu Hause ist.«
»Ach, der Ernst ist wieder da? Der von der Krügerschen?« Großvater Carl sah seinen Sohn fragend an. Der nickte nur. Großvater wurde allmählich tüdelig.
»Nur muss ich nun noch mehr an unseren Hans denken. Er liegt noch immer in irgendeinem verseuchten Schützengraben und ringt um sein Leben.« Sie legte das Besteck auf dem halb vollen Teller zusammen und tupfte sich mit der Serviette zuerst die Augenwinkel, dann den Mund.
»Aber nein, Röschen, gewiss nicht. Der Krieg ist vorbei.«
»Leider ist er das«, polterte Großvater dazwischen. »Wir waren längst nicht geschlagen. Im Feld waren wir es nicht. Ich werde nie begreifen, dass Wilhelm seinen Thron aufgegeben hat. Alles nehmen die uns weg nach diesem lachhaften Waffenstillstand. Republik!« Er schnaubte verächtlich. »Als ob wir im Krieg nicht schon genug verloren hätten.« Wütend fuchtelte er mit der Gabel in der Luft herum. »Ich bin alt, ich kriege das bisschen Zeit, das mir bleibt, schon rum. Aber ihr? Ihr werdet euch noch wundern, wenn die Arbeiter plötzlich das Sagen haben bei den Sozis.«
»Lass es gut sein, Vater.«
»Ist doch wahr. Jetzt wählen schon die Frauen.« Großvater lachte auf. »Wohin soll das noch führen? Ihr werdet noch an meine Worte denken.«
Ein herzergreifendes Schluchzen von Mutter verhinderte, dass Großvater Carl die Wiedereinsetzung Wilhelms als Kaiser fordern konnte, wie er es allzu gerne tat.
»Wenn ich nur sicher sein könnte, dass unser Junge noch am Leben ist«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme.
Vater strich ihr zärtlich über die Hand und begann – wie jedes Mal, wenn es um Hans ging – beruhigend auf seine Frau einzusprechen. Und wie immer in solchen Momenten fühlte sich Frieda schuldig. Als ob es nicht recht sei, dass sie als Mädchen nicht für ihr Vaterland hatte kämpfen müssen. Als ob es ihren Eltern womöglich lieber gewesen wäre, eine Tochter zu opfern, die irgendwann doch nur eine stattliche Mitgift kosten würde, anstatt den Nachfolger hergeben zu müssen, der einst das stolze Familienunternehmen weiterführen sollte. Sie konnte doch nichts dafür, dass sie ein Mädchen war. Bitte schön, sie legte keinen Wert auf eine Aussteuer, sondern würde liebend gern selbst bei Hannemann & Tietz in die Lehre gehen.
»Magst du deinem alten Herrn Gesellschaft leisten, Sternchen?«
Sie hatten gerade die Mahlzeit beendet, ihr Vater sah sie erwartungsvoll an. »Meine Imperator soll heute die Säulen für sein Hallenbad bekommen.«
»Das lasse ich mir bestimmt nicht entgehen.« Frieda folgte ihm in sein Bastelzimmer, einen dunkel getäfelten Raum, der ursprünglich als Rauchsalon vorgesehen war. Doch weder Vater noch Großvater rauchte, ein ungewöhnlicher Umstand, der in der Hamburger Kaufmannschaft immer wieder für Frotzeleien oder Erstaunen sorgte.
In der Mitte des Raumes stand ein riesiger Tisch, und in einem Wandschrank stapelten sich die verschiedensten Hölzer, Pappen, Klebstoffe und Farben. Wie schon sein Vater und sein Großvater war Albert Hannemann Kaufmann durch und durch, es gab nichts, was er nicht über den Anbau und Import von Roh-Kakao wusste. Seine Leidenschaft aber galt den Schiffen. Da ihm die Zeit fehlte, die Waren, mit denen er handelte, selbst über die Ozeane zu holen, hatte er sich darauf verlegt, Modelle von Schiffen zu bauen. Als vor sieben Jahren im Hamburger Hafen der Imperator vom Stapel gelaufen war, hatte er mit seinem ersten Modell begonnen. Nie würde Frieda den Anblick und die flirrende Atmosphäre vergessen. Sie erinnerte sich, als wäre es erst Tage her, dass Vater ihr beinahe die Hand zerquetscht hatte vor lauter Aufregung und Begeisterung. Von dem Nieselregen, in dem Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich dem gigantischen Dampfer seinen Namen gab, hatte sie nichts gespürt. Erst zu Hause, als ihre Mutter furchtbar über die nassen Kleider geschimpft hatte, war ihr aufgefallen, dass sie komplett durchnässt und wie kühl ihr gewesen war. Hans hatte damals mit Fieber das Bett gehütet und sich noch Wochen später darüber geärgert, dass er das Erlebnis versäumt hatte. So sehr es Frieda für ihren Bruder leidgetan hatte, so sehr hatte sie es doch genossen, diesen Moment mit ihrem Vater allein zu teilen.
»Donnerwetter!«, hatte er wieder und wieder geraunt. »Das ist Ballins Meisterstück. Keine Frage. Diese Imperator wird nicht untergehen wie die Titanic, sondern unserer Hansestadt und dem gesamten Deutschen Reich lange große Ehre machen.« Im Anschluss an den Stapellauf hatte Albert Ballin ihrem Vater eine Besichtigung ermöglicht, und er war es auch, der ihm Fotos besorgt hatte, die nun als Vorlage für sein Modell dienten. Die Imperator wird Hamburg lange Ehre machen. Von wegen. Schon ein Jahr nach dessen erster Reise hatte der Krieg ihn an die Kette gelegt. Nun hatte er Hamburg ganz verlassen – als Kriegsentschädigung an Großbritannien.
»Siehst du, hier bekommen die Säulen ihren Platz«, erklärte Albert ihr jetzt und nahm die feinen Holzstücke zur Hand, die er vorbereitet hatte. Wie viele Stunden mochte er daran geschnitzt und gemalt haben?
»Darf ich?« Sie streckte eine Hand aus, und ihr Vater reichte ihr eines der winzigen Kunstwerke.
»Sie sind wunderschön«, flüsterte sie. »Und sie sehen genau so aus wie die auf dem Bild.« Immer wieder wanderten ihre Augen von der Fotografie zu dem kleinen hölzernen Stäbchen und zurück. Unglaublich, es stimmte einfach alles: Das untere Drittel war glatt und kunstvoll bemalt, der obere Teil, der sich zum schlichten Kapitell hin nur wenig verjüngte, war gekehlt.
»Natürlich. Es soll ja alles so aussehen wie beim echten Schiff«, sagte er stolz. Mit einer Pinzette nahm er ihr die Miniatur-Ausgabe einer Marmorsäule ab und platzierte sie neben einem rechteckigen Becken, in das zwei Treppen mit zierlichen Geländern führten.
»Aber die Imperator ist ja an der Seite offen«, hatte Frieda überrascht festgestellt, als sie das Modell vor Jahren zum ersten Mal begutachtete.
»Aber natürlich, Sternchen, sonst könnte man die Pracht unter Deck doch gar nicht sehen.« Neben dem dreistöckigen Schwimmbad mit Barbier und Dampfbad waren über die Jahre ein Wintergarten mit Palmen, ein Restaurant, dessen Küche vom Ritz-Carlton betrieben wurde, wie Vater damals nach der Besichtigung anerkennend erwähnt hatte, Salons mit seidenen Wandbehängen und Kristallleuchtern und sogar eine Turnhalle hinzugekommen. Das größte Passagierschiff der ganzen Welt war so riesig und so verschwenderisch ausgestattet, dass ihr Vater auch die nächsten sieben Jahre noch daran basteln würde. Einige Minuten sah sie ihm still zu, wie er mit ruhiger Hand eine Säule nach der anderen an ihren Platz setzte und mit einem Tröpfchen Leim befestigte.
Dann kam ihr ein Gedanke, und ehe sie weiter darüber nachdachte, war er auch schon raus: »Das Lyzeum fehlt mir. Ich bin froh, dass ich in den letzten Wochen deine Bibliothek hatte. Ich glaube, ohne deine Bücher wäre ich vor Langeweile gestorben.«
Er lachte. »Eine merkwürdige Aussage für eine junge Dame von sechzehn Jahren. Du solltest tanzen gehen, uns in den Ohren liegen, dass du neue Kleider brauchst.«
»Mutter stöhnt zwar oft, weil es so viel gibt, worum sie sich kümmern muss, aber im Grunde weiß sie doch meist nichts mit sich anzufangen«, fuhr sie fort, ohne auf den warnenden Blick ihres Vaters zu achten. »Ich will nicht so werden, Papsi. Das ist einfach nichts für mich.« Sie sah ihn verzweifelt an. »Den lieben langen Tag nur nach den Bediensteten schauen, sich um die Frisur sorgen oder die neuste Kleidermode, das kann doch nicht alles im Leben sein.« Das war doch nicht so schwer zu verstehen. Vor allem für jemanden, der sein Kontor so liebte wie seinen Bastel-Salon. »Oder denk nur an die gute Gertrud Krüger. Sie ist auf euch angewiesen oder auf andere Herrschaften, die sie in Stellung nehmen. Ich möchte nicht immer auf andere Menschen angewiesen sein«, erklärte sie ernst.
»Aber diese Gefahr besteht ja auch gar nicht, Sternchen«, entgegnete ihr Vater sanft. »Du wirst eine äußerst großzügige Mitgift bekommen, mit der dich ein wohlhabender junger Mann gerne nehmen wird. Vielleicht ist er sogar reich genug, auf ein üppiges Brautgeschenk zu verzichten«, setzte er leiser hinzu. »Damit bist du für alle Zeit unabhängig.«
»Wie bitte?« Das konnte doch nicht sein Ernst sein. Hatte er ihr nicht zugehört? Plötzlich flackerte das Licht. Stromschwankungen, wie so oft. Ihr Vater, der gerade ein überschüssiges Tröpfchen Leim entfernte, blieb mit seiner Pinzette an einer der beiden Leitern hängen, die in das Miniatur-Schwimmbad führten.
»Schöner Mist«, schimpfte er.
»Siehst du, das ist die Strafe dafür, deine liebe Tochter so zu erschrecken.«
Die Nase dicht über dem Bassin, betrachtete er sein Werk. »Glück gehabt, nichts passiert.« Er atmete auf.
»Einen reichen Mann heiraten nennst du Unabhängigkeit? Ich möchte auf niemanden angewiesen sein, auch nicht auf einen Ehemann.« Als sie sein Schmunzeln sah, kniff sie die Augen zusammen. Am liebsten würde sie losschimpfen, aber wie oft hatten ihr ihre Eltern gesagt, dass es sich für eine junge Frau nicht schickte, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Besser, sie konnte ihrem Vater beweisen, dass sie klare Vorstellungen für ihre Zukunft hatte.
»Bitte, lass mich die Ausbildung zur Handlungsgehilfin absolvieren! Ich habe mich erkundigt, man hört nur Gutes über diese Grone Schule. Lass mich hingehen, Vater, bitte!«
Er winkte ab. »Nein, Frieda, daraus wird nichts«, sagte er und wandte sich wieder den Holzarbeiten zu.
Was war denn jetzt los? Wenn sie allein waren, gelang es ihr sonst immer, ihn um den kleinen Finger zu wickeln. Zumindest hätte sie erwartet, dass er sich ihre Pläne in Ruhe anhörte.
»Aber warum hast du mich dann ermuntert, deine Bücher zu lesen? Du hast mir alle Schriften über den Kakao gegeben, über den Anbau, seine Heilkraft und die Verarbeitung. Und du hast mich aufgefordert, auch die Artikel über die doppelte Buchführung zu lesen, obwohl du wusstest, dass ich sie sterbenslangweilig finde. Warum, wenn ich niemals in deinem Kontor arbeiten soll?«
»Du bist eine Frau, Sternchen. Was willst du in meinem Kontor tun?«
»Die Korrespondenz ablegen, die Handelsbücher führen. Was eben zu tun ist.«
»Darum wird sich dein Bruder kümmern.«
»Mein Bruder ist aber nicht hier«, fiel sie ihm ins Wort und erntete einen Blick, der sie sofort zum Schweigen brachte. »Entschuldigung«, murmelte sie, »so habe ich das nicht gemeint.«
»Er wird seine Lehre antreten, sobald er zurück ist.« Ehe sie erneut protestieren konnte, fuhr er fort: »Außerdem habe ich noch lange nicht vor, mich zur Ruhe zu setzen, und es gibt zwei erfahrene Prokuristen im Kontor, die ihm zur Seite stehen werden. Für dich haben deine Mutter und ich andere Pläne.«
Andere Pläne? Das klang, als seien die schon sehr konkret. Wie konnten ihre Eltern hinter ihrem Rücken über ihre Zukunft entscheiden, ohne ihre Meinung anzuhören oder sie zumindest in Kenntnis zu setzen? Verzweiflung stieg in ihr auf, sie fühlte sich hilflos und schrecklich wütend.
»Was sind das für Pläne?«
»Ich habe dir all diese Dinge zu lesen gegeben, weil ich möchte, dass du die Grundzüge des kaufmännischen Betriebs verstehst. Die Zeiten ändern sich. Ich halte es inzwischen für günstig, wenn ein Mann sich mit seiner Ehefrau darüber unterhalten kann.«
Kapitel 2
Es war ein warmer Mai-Tag. Obwohl noch früh am Morgen, hatte die Sonne bereits erstaunlich viel Kraft. Ungewöhnlich für Hamburger Verhältnisse. Eilig ließ Frieda das schlichte Wohn- und Kontorhaus in der Deichstraße hinter sich. Es war nicht nur recht warm für die Jahreszeit, auch hatte es lange nicht geregnet, sodass das Wasser im Nikolaifleet fiel und einen dunklen Rand an den Mauerwerken hinterließ. Nicht mehr lang, und die ersten schweren Holzpfähle, auf denen die meisten der mehrgeschossigen Speicher und Kontorgebäude im schlammigen Grund standen, würden zu sehen sein. Dann hätten es selbst die Schuten schwer, im Niedrigwasser zu manövrieren. Doch so weit würde es kaum kommen. Wenn in Hamburg auf eines Verlass war, dann auf den Regen. Wurde wirklich Zeit, es begann bereits modrig zu riechen. Ehe sie den Hopfenmarkt erreichte, sah sie sich um, ob keiner der Kaufmänner oder Kapitäne, die bei ihrem Vater ein und aus gingen, in der Nähe war. Dann hüpfte sie, wie sie es als kleines Mädchen gern gemacht hatte. Rechter Fuß einen Schritt vor, Hüpfer auf rechts, linker Fuß einen Schritt vor, Hüpfer auf links. Sie hatte ihr langes dunkelbraunes Haar zu einem Zopf geflochten, der ihr nun auf den Rücken klopfte.
Was hatte Ernst gesagt, wo er gewesen war, in Afrika? Er würde einiges zu erzählen haben. Frieda lächelte. Wie sehr hatte sie um den Freund gebangt. Sie konnte das Glück noch gar nicht richtig fassen. Hans würde auch bald nach Hause kommen, dessen war sie jetzt wieder sicher. Mit jedem Tag, der seit dem Waffenstillstand vergangen war, mit jeder Welle heimkehrender Soldaten war ihre Hoffnung gesunken. Doch nun hatte sie neuen Mut gefasst.
Je näher sie dem Hopfenmarkt kam, desto kräftiger schwoll ein Geräuschpegel an, den wohl nur eine Großstadt wie Hamburg hervorzubringen vermochte. Bauern aus den Vierlanden und Marschlanden redeten Platt untereinander, aber auch mit der Kundschaft, den Bediensteten der Kaufleute und Senatoren und den Frauen der Werftarbeiter und Quartiersleute. Frieda liebte den breiten Dialekt. Er klang so gemütlich. Und ehrlich; sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand auf Platt log und betrog.
Um sie herum war geschäftiges Treiben. Männer mit dunklen Westen über den weißen Hemden und Frauen mit langen Schürzen und runden Strohhüten mit gewölbter Krempe boten ihre Waren feil. In den letzten Jahren waren es immer ein bisschen weniger Bauern geworden, die ihr Obst und Gemüse, ihre Wurst, den Schinken und Milchprodukte hier in Körben und auf Decken übereinandergestapelt anpriesen. Lebensmittel waren knapp, sogar von Plünderungen der Feinkostgeschäfte hörte man immer mal wieder. Wer selbst etwas anbaute, kam wohl gar nicht mehr bis in die Stadt, sondern verkaufte es direkt auf seinem Hof. Oder es landete gleich auf dem eigenen Teller.
Am Rand des Marktes stand ein braunes Pferd auf dem Kopfsteinpflaster. Vor den Leiterwagen gespannt, wartete es darauf, dass es wieder rausging aus der großen Stadt. Frieda trat heran und streichelte dem Tier die weiche Haut um die Nüstern.
»Bist ein hübscher Kerl«, sagte sie leise und klopfte ihm den Hals. »Genießt du den Schatten von St. Nikolai?« Der Turm der mächtigen Hauptkirche soll einmal das höchste Bauwerk der ganzen Welt gewesen sein, hatte Großvater Carl ihr erzählt.
»Na, Deern, willst ’n Appel?«
»Liebe Zeit, haben Sie mich erschreckt!« Woher war der Mann so plötzlich gekommen? »Ein Apfel zu dieser Jahreszeit?« Sie versuchte zu erkennen, was er in seiner Hand verbarg. Es war rund und violett. Ein Apfel war das ganz sicher nicht. Als er in meckerndes Gelächter ausbrach, wurde der mickrige Rest eines schiefen Gebisses sichtbar. »Büst klook, Deern. Nee, Äppel gifft dat noch nich. Man blots ’n büschen Rhabarber.« Das Lachen war dahin, sein Blick wurde matt.
»Und Kohlrabi, wenn ich mich nicht täusche«, sagte sie und deutete, als er sie überrascht ansah, auf das Gemüse, das zwischen seinen Fingern hervorlugte.
»Büst klook, Deern«, wiederholte er und schlurfte davon.
Sie ließ den Hopfenmarkt hinter sich, bog in den Großen Burstah ein und erreichte schnell das Rathaus mit der Börse. Welch ein Unterschied zu dem Treiben auf dem Markt. Dort waren Not und Mangel deutlich zu sehen, hier schien die hanseatische Welt noch in Ordnung. Männer in Anzügen und mit Hüten auf den Köpfen eilten hinein und hinaus.
Damen in langen Roben mit gerüschten Sonnenschirmchen flanierten über den Rathausplatz in Richtung Jungfernstieg und Alster. Frieda blickte zu den Türmen des neu erbauten Rathauses hinauf. Ein echtes Märchenschloss! Zwar war der Turm längst nicht so hoch wie der von St. Nikolai, doch mit seinen vielen Spitzen und Schnörkeln, mit den unzähligen Figuren und geschwungenen Simsen sah es aus, als könne dort nur ein König zu Hause sein. Wenige Schritte hinter dem großzügigen Platz bog sie rechts in die Bergstraße ein. Vater hatte schon oft davon gesprochen, das Haus dort aufzugeben. In diesen Zeiten musste auch er klug mit dem Geld umgehen, und die Deichstraße war wahrlich groß genug zum Wohnen und als Kontor. Dennoch konnte er sich nicht von dem schlichten roten Backsteinbau mit abgerundetem Giebel trennen. Es war sein Elternhaus, dort war er aufgewachsen. Nein, so bald würde er sich wohl nicht zum Verkauf entschließen, schon deshalb nicht, weil es Großvater Carl das Herz brechen würde. Außerdem bekäme er in diesen Tagen schwerlich auch nur annähernd das, was das Haus wert war. Lieber wenig dafür bekommen als noch dafür bezahlen, ging ihr durch den Kopf. Erst kürzlich war die Haustür zu Bruch gegangen, als irgendjemand versucht hatte, sich Zugang zu verschaffen. Aber was wusste sie schon? Ihr Vater würde schon das Richtige tun.
Frieda trat ein. Es roch nach Staub und Papier.
»Einen guten Morgen, Fräulein Hannemann«, schallte es ihr entgegen. Sie grüßte die Handlungsgehilfen freundlich zurück, ehe sie die Treppe in den ersten Stock hinauflief, wo ihr Vater sein Kontor hatte. Sie klopfte an, die andere Hand bereits an der Klinke. Kaum dass sie die Stimme ihres Vaters hörte, öffnete sie und stieß beinahe mit Ernst zusammen.
»Hoppla!« Frieda strahlte ihn an.
Er machte einen Satz zurück. »Entschuldigung, wie ungeschickt von mir.«
Was war nur mit ihm los? Früher hätte er sie damit aufgezogen, wie tüffelig sie war. Oder er hätte abgewartet, in welche Richtung sie ausweichen wollte, um ihr erneut in den Weg zu treten und einen Zusammenstoß zu provozieren. Bestimmt war es die Anwesenheit ihres Vaters, die ihn hemmte.
»Soll ich wieder gehen?«
»Nein, Sternchen, bleib nur hier. Vielleicht hört dieser Sturkopf auf dich.« Er deutete auf Ernst, der jetzt stocksteif vor dem Fenster stand und seine schirmlose Mütze knetete. »Stell dir vor, er hat mich tatsächlich gebeten, ihn wieder als Laufburschen in Stellung zu nehmen.«
»Ich brauche nun mal Arbeit. Und zwar sofort.«
»Das verstehe ich doch.« Ihr Vater seufzte. Die beiden tauschten ihre Argumente anscheinend nicht zum ersten Mal aus. »Du willst Geld verdienen, damit deine Mutter nicht länger im Hafen schuften muss. Wer würde das nicht verstehen? Bist ein feiner junger Mann, Ernst, das bist du wirklich.« Ernst starrte auf seine Schuhspitzen. Sie sahen aus, als hätte er sie heute früh noch schnell mit Spucke poliert, um einen guten Eindruck zu machen. »Und ich bleibe dabei: Kräftige junge Männer mit einer schnellen Auffassungsgabe, wie du sie hast, werden überall gebraucht. Du wirst bald sechzehn, ein gutes Alter, um in die Lehre zu gehen. Als Schuhmacher, Drucker oder meinetwegen auch als Buchbinder.«
Frieda sah von einem zum anderen. Warum konnte Ernst nicht bei Vater in die Lehre gehen? Doch sie schwieg besser, sonst würde ihr Vater das nur wieder falsch verstehen und annehmen, dass sie nicht an Hans’ Rückkehr glaubte.
»Als Arbeiter kannst du mehr verdienen. Du willst doch nicht dein ganzes Leben Laufbursche oder ungelernter Helfer sein«, fuhr ihr Vater fort.
»Als Arbeiter kann ich mehr verdienen?« Ernsts Augen funkelten. »Aber nur, wenn ich nicht gerade arbeitslos bin und mich in die Schlange stellen darf, um nach Almosen zu betteln. Oder bei einem Streik oder einem Aufstand totgeprügelt werde. Nee, schönen Dank.« Sein Blick streifte Frieda, die ihn entsetzt anstarrte. So hatte er noch nie geredet.
»’tschuldigung«, stammelte er, »aber ist doch wahr. Meine Mutter hat mir erzählt, was hier los war und noch immer los ist. Das ist bald schlimmer als der Krieg selbst.«
»Na, na«, machte ihr Vater halbherzig.
»Ist ’n starkes Stück«, sagte Ernst leise, »ich hab mitgekriegt, wie einige Kameraden Post von zu Hause bekommen haben. Alles in bester Ordnung, hieß das immer. Uns geht’s prächtig. Von wegen!« Er schüttelte traurig den Kopf.
Albert Hannemann nickte bedächtig. »Hast schon recht, Junge, solche Briefe hat Rosemarie unserem Hans auch geschrieben. Dass die Moral an der Front bloß nicht leidet.« Er seufzte. »Wer weiß, ob ihn überhaupt einer erreicht hat.«
Eine Weile schwiegen die Männer. Von draußen drangen das Klappern der Pferdehufe, das Klingeln der Straßenbahn und hin und wieder auch das Hupen eines Automobils zu ihnen hinauf. Sonst war im Kontor nur das Ticken der drei Uhren zu hören, die über einer langen Nußbaumanrichte hingen. Eine zeigte die Zeit in Hamburg an, eine zweite die in Kamerun, dem Land, aus dem die größte Menge Roh-Kakao importiert wurde. Die dritte Uhr war auf New Yorker Zeit eingestellt, wo ein Bruder von Großvater Carl ein Geschäft gegründet hatte.
»Sei es drum, ich nehme dich gerne, Ernst. Ich weiß, du bist zu gebrauchen, dich kann man schicken. So, und nun muss ich mich auf den Weg in den Brook machen. Ich dachte, diese Kakao-Wirtschaftsstelle wäre eine gute Idee.« Er stöhnte vernehmlich. Als er Ernsts fragenden Blick bemerkte, erklärte er in wenigen Worten, dass erst vor einigen Tagen sowohl Fabrikanten als auch Importeure diese Stelle zusammen mit der Reichsbank und den Ministern in Berlin gegründet hatten. Ein verzweifelter Versuch, für gemeinsame Interessen und gegen die Schwierigkeiten, wie gestiegene Zölle, hohe Preise und die Zuckerknappheit, zu kämpfen. »Ach, das weißt du auch noch nicht.« Er lachte trocken. »Ich bin inzwischen beides, Importeur und Fabrikant. Lass dir das von meiner Tochter erzählen, sie liebt die Manufaktur. Und sie hat ein Händchen für köstliche Rezepturen, muss ich gestehen.«
»Diese Wirtschaftsstelle«, hakte Ernst nach, »Sie sagten, Sie dachten, das wäre eine gute Idee. Ist es denn nicht so? Klingt doch ziemlich vernünftig.«
»Ja, schon, aber vor allem ist es erst einmal eine Menge Arbeit und Zeit. Ich bin Kaufmann, Ernst, ich will handeln. Im Ministerium und in der Reichszuckerstelle wird nur debattiert. Jetzt muss ich aber wirklich.« Damit erhob er sich hinter seinem schweren Schreibtisch. »Willst du dafür sorgen, dass meine Tochter wohlbehalten nach Hause kommt?«
»Selbstverständlich, Herr Hannemann.«
Eine Minute später standen Frieda und er auf der Bergstraße. »An unseren alten Treffpunkt brauchen wir wohl nicht mehr zu gehen«, meinte Ernst, nachdem er die zwei Dosen Schokoladenflocken, die Albert Hannemann ihm geschenkt hatte, in die kleine Krügersche Wohnung im Keller gebracht hatte. »Wohin dann? Zum Jungfernstieg? Oder willst du sofort nach Hause?«
»Auf keinen Fall! Ich will alles über Afrika wissen.«
»Und ich über eure geheimnisvolle Manufaktur.« Endlich blitzten seine Augen wieder.
»Lass uns zur Speicherstadt gehen. Ich war schon so lange nicht mehr da. Mir scheint, sie wächst unaufhörlich. »
»Immerhin in dieser Hinsicht hast du dich nicht verändert. Gott sei Dank«, sagte er. Wie eigenartig er sie dabei ansah.
»In welcher Hinsicht habe ich mich denn verändert?«, fragte sie, während sie den Fischmarkt überquerten. Aber er zuckte nur mit den Schultern.
Was sollte sie damit anfangen? Schweigend gingen sie die Brandstwiete weiter, bis sie schließlich den Zollkanal erreichten. Welch ein Anblick! Jedes Mal, wenn sie hier war, raubte er ihr den Atem. Vor ihr erhob sich auf den Brookinseln eine Festung aus rotem Backstein. Seite an Seite standen die mächtigen Speicher wie eine einzige Wand. Durch die Gesimse und Friese in symmetrische Abschnitte aufgeteilt, hatten sie eine Schönheit und Eleganz, die von den Ornamenten aus grün und gelb glasiertem Stein noch unterstrichen wurden. Frieda legte den Kopf in den Nacken, um ganz nach oben sehen zu können, wo die Giebel, die die Seilwinden schützten, sich von dem blauen Himmel abhoben. Einige der Luken waren geöffnet, an dicken Tauen wurden Säcke und Kisten in die Lagerräume der Geschosse gehievt. Hinter den großen Fenstern der unteren Stockwerke arbeiteten Kaufleute und ihre Handlungsgehilfen, darüber stapelte sich die Ware, die sie aus aller Welt kauften und wiederum in die ganze Welt verkauften. Möwen zogen kreischend ihre Runden und schauten, ob es nicht etwas zu stibitzen gab. Männer schrien Kommandos, Pferde, vor beladene Karren gespannt, wieherten ungeduldig, das Wasser gluckste und plätscherte, wenn ein Kahn vorüberglitt. Frieda musste schlucken.
Auch wenn sie von hier aus nur einige Fähren sehen konnte, die kreuz und quer flitzten, und die Masten der großen Segelschiffe weiter hinten im Hafen, spürte sie doch deutlich, dass vor ihr die Freiheit begann. Nur ein Stückchen die Elbe hinauf, dann war man in Cuxhaven und damit an der Nordsee. Oft hatte sie stundenlang Vaters Atlas studiert und sich vorgestellt, wie es sein mochte, auf einem Schiff unterwegs zu sein. Nach England war es nicht weit, mit ausreichend Proviant könnte man sogar bis nach Grönland fahren. Was für ein Abenteuer, das ewige Eis. Doch ihr würde schon England genügen. Sie dachte an Stonehenge, an James Cook. Hatte er nicht einige der Länder erkundet, aus denen ihr Vater Kakao importierte?
»Bist du hier angewachsen, oder wie?« Ernst stand mit verschränkten Armen vor ihr und schien sie schon eine ganze Weile zu beobachten.
»Was? Ach so, nein, lass uns weitergehen.«
Sie überquerten die Kornhausbrücke. Über allem lag der eigentümliche Geruch des Hafens, eine Mischung aus leicht fauligem Wasser, Kaffee, Gewürzen und Pferdemist.
An einem Mäuerchen am Ende der Brücke blieb Ernst erneut stehen. »Jetzt erzähl schon. Was hat es mit dieser Schokoladenmanufaktur auf sich?«
Frieda legte eine Hand auf die Ziegel. Die Sonne hatte den Stein aufgewärmt. Kurzerhand stützte sie sich auf, holte Schwung und saß mit einem Satz auf der Mauer. »Deine Mutter wird sich freuen«, stellte Ernst mit einem breiten Grinsen fest.
»Sie regt sich doch ständig über irgendetwas auf«, entgegnete sie schulterzuckend und klopfte mit der Hand auf den Platz neben sich. Er zögerte, dann sprang auch er hinauf, wobei er einigen Abstand zu ihr hielt. Was hatte er vorhin gesagt? In einer Hinsicht hätte sie sich nicht verändert. Dabei war er es doch, der sich verändert hatte. Sie schob den Gedanken beiseite.
»Die Manufaktur«, begann sie, »Hannemanns feine Hamburger Schokolade. Mein Vater hatte die Idee schon früher, als Schokolade nicht mehr nur für die reichen Leute war. Warum sollen wir uns von Sprengel, Stollwerck und Hachez die Preise diktieren lassen, meinte er, wenn der Markt gerade mit Roh-Kakao geflutet wird? Ist doch besser, wir verarbeiten einen Teil der Bohnen selbst und verdienen besser daran als durch den reinen Verkauf. So hat er sich das vorgestellt.«
»Nur dass im Krieg nix mehr in Hamburg ankam. Höchstens über Umwege. Von einer Kakaoflut kann im Moment wohl kaum die Rede sein.«
»Stimmt.« Sie blinzelte. »Ich glaube, der Gedanke, eine eigene Schokolade anzubieten, hat ihm einfach zu gut gefallen.« Sie lachte. »Außerdem dachten alle, der Krieg sei vorbei, ehe man Labskaus sagen kann.«
»Schön wär’s gewesen.« Er ließ die Beine baumeln, seine Hacken schlugen abwechselnd gegen die Mauer. »Da hättest du in aller Ruhe Labskaus mit Rote Bete und Matjes sagen können, und der Krieg wär trotzdem noch nicht vorbei gewesen.«
»Vater hatte wohl noch etwas mehr als dreitausend Sack Kakaobohnen. Und Angst, dass man ihm die beschlagnahmt. Da hat er lieber die ersten eigenen Tafeln und die Flocken für Trinkschokolade draus gemacht. Eine Conchiermaschine hatte er ja schon vor Jahren gekauft.«
»Eine was?«
»Conchiermaschine. Die rührt die Kakaomasse und sorgt dafür, dass sie nicht krümelig, sondern herrlich cremig wird.«
»Da läuft einem ja schon beim Gedanken das Wasser unter der Brücke zusammen.«
Frieda lachte wieder und nickte. Dann erzählte sie, dass ihr Vater mit Gero Mendel, Betreiber des Warenhauses am Jungfernstieg, eine Abmachung getroffen hatte. Nur dort konnte man die Hannemannsche Schokolade kaufen. Ganz exklusiv und auch nur auf persönliche Empfehlung. »Unterm Ladentisch«, wisperte sie und sprang von der Mauer.
Sie schlenderten in Richtung Kehrwieder.
»Dein Vater ist plietsch. Klug, meine ich. Im Krieg ging nicht nur nichts rein in den Hafen, es ging auch kaum was raus. Sein Lager war aber noch voll. Also stellte er selber Schokolade her, das nenne ich wirklich plie… klug«, sagte er bewundernd. »Außerdem: Wohlstand ist längst nicht alles.«
Sie sah ihn von der Seite an. »Bist du das, Ernst Krüger? Hast du mir nicht immer erzählt, es ginge im Leben vor allem darum, Wohlstand zu erreichen?«
»Für mich! Na klar. Ich hab ja nichts bis jetzt. Aber dein Vater … das Ansehen eines Kaufmanns hängt nicht bloß von seinem Wohlstand ab.«
»Sondern?«
»Davon, ob er einfallsreich ist, ob er etwas wagt, das noch keiner vor ihm ausprobiert hat. Dein Vater hat Ideen und Visionen. Deshalb hat der Name Hannemann einen so guten Klang in Hamburg.« Er reckte stolz das Kinn. »Darum arbeite ich so gern bei ihm. Da kann ich fix was lernen und selber mal was werden.«
»Nur nicht gerade als Laufbursche«, gab sie leise zu bedenken.
»Ach was, das ist schon in Ordnung. Ich kann morgen gleich bei ihm anfangen, und Mutter braucht nicht mehr im Hafen schuften. Alles andere findet sich.«
Frieda sah etwas aus dem Augenwinkel und hörte auch schon ein fettes Klatschen. Eine Möwe hatte Ernst einen großen grünlichen Klecks auf die Schulter gesetzt.
»So ein Schiet«, gluckste Frieda und konnte sich das Lachen kaum verkneifen.
»Kannst wohl sagen. Na, wenn das kein Glück bringt. Alles Gute kommt doch von oben, oder?«
Sie nestelte ein Taschentuch hervor. »Nee, lass mal!« Er winkte ab. »Das ist doch so ein teures Spitzendings.«
»Willst du etwa lieber mit dem Schietdings herumlaufen?« Sie zog eine Augenbraue hoch, schnaufte ungeduldig und machte sich an seiner Schulter zu schaffen. »Das haben wir gleich.« Ernst sah kurz weg, doch dann drehte er den Kopf, und seine Lippen streiften ihren Handrücken. Frieda erstarrte in der Bewegung. Wie weich sich das angefühlt hatte. Schnell zog sie die Hand weg. Komisch, es war irgendwie schön gewesen. Fremd und ein bisschen aufregend, aber schön.
»Siehst du, ich sach doch, du sollst das nicht«, brummte er.
»Ist doch nicht meine Schuld, wenn du mir unbedingt auf die Finger gucken musst«, verteidigte sie sich.
»Ich reibe den Rest zu Hause aus«, sagte er und trat einen Schritt zur Seite. »Danke.« Sie gingen weiter. Warum war er denn plötzlich so ruppig?
»Dein Vater sagt, du hast ein Händchen für Rezepte«, begann Ernst nach einer Weile.
»Für köstliche Rezepte«, betonte sie.
»Aha.«
»Ich habe zum Beispiel Rosenwasser in die Conchiermaschine zu der Kakaomasse gegeben. Die Damen sind verrückt nach dem Aroma.« Sein anerkennender Blick ließ ihr Herz hüpfen. »Na ja, so viele haben noch nicht davon gekostet«, räumte sie ein. »Es macht mir einfach Spaß, mir neue Geschmacksrichtungen zu überlegen … das könnte ich den ganzen Tag machen.«
Gedankenversunken ging sie weiter. Sie mussten aufpassen, wohin sie ihre Füße setzten, das Kopfsteinpflaster war alles andere als eben, und überall lagen die Hinterlassenschaften der Pferde herum.
»Ich könnte Schokoladenfabrikantin werden«, rief sie plötzlich.
»Du?«
»Ja, ich. Warum denn nicht?«
»Du bist ein Mädchen.« Er stockte. »Eine Frau.« Seine Augen wussten nicht, wohin. »Noch dazu die Tochter eines Kaufmanns, der nicht nur in Hamburg einen guten Ruf hat.«
»Na und!«
»Was geht bloß in deinem hübschen Schädel vor?« Er schüttelte belustigt den Kopf, wurde ernst.
»Schau dir deine Mutter an. Sie hat Kinder bekommen, steht dem Haushalt vor. Das ist es, wofür ihr gemacht seid.«
»O bitte, Ernst, die Zeiten ändern sich«, fuhr sie ihn an. »Mein Vater hat mich all seine Bücher über Kakaobohnen und über Buchführung lesen lassen, damit sich mein Ehemann, den ich irgendwann haben werde, mit mir über sein Geschäft unterhalten kann. Mein Vater kann das mit meiner Mutter nicht. Er nennt sie seinen Papagei, weil sie wunderschön aussieht und sich farbenprächtig kleidet.«
Er griente breit. »Ist doch drollig.«
»Drollig! Pah. Schön, aber dumm, meinst du wohl.« Ehe er etwas einwenden konnte, sprach sie weiter: »Papageien denken nicht, sie plappern nur nach, was man ihnen lange genug vorsagt.« Sie blieb stehen und trat nach einem Stein, der auf dem Weg lag. Er flog im hohen Bogen und landete mit hohlem Klicken an dem Reifen eines Fuhrwerks.
»Guter Schuss!« Ernst nickte ihr zu.
»Ich bin doch nicht auf das Lyzeum gegangen, nur um mich gut mit einem Ehemann unterhalten zu können, der noch nicht einmal in Sicht ist.«
»Warum denn sonst?«
Frieda war sprachlos. Er war ihr Freund, und er glaubte daran, dass alles möglich war, alles, was man von ganzem Herzen wollte. Warum unterstützte er sie nicht?
»Hast ja recht, immer mehr Frauen üben einen Beruf aus. Aber doch nicht freiwillig. Während des Krieges waren die meisten Männer im Feld, da ging es nun mal nicht anders. Da mussten Fruenslüüd als Schaffnerin oder Verkäuferin einspringen. Aber nun ist bald alles wieder normal, Frieda.« Er baute sich vor ihr auf und sah ihr in die Augen. »Du bist aus gutem Haus. Und kann doch sein, dass da doch schon wer in Sicht ist. Vielleicht nicht morgen oder übermorgen. Aber du wirst auf jeden Fall einmal einen Mann heiraten, der für dich sorgt, einen, der dich auf Händen trägt. Du musst nicht arbeiten.«
»Also wirklich, du redest schon genau so wie mein Vater.« Sie pustete sich eine Strähne aus der Stirn und ließ ihn einfach stehen. »Ich muss nicht, aber ich möchte«, sagte sie trotzig.
»Warum?« Schon war Ernst wieder neben ihr. »Komm mit!«
Er zog sie hinter sich her zu einer Frau, die einen riesigen Korb bei sich trug. Sie selber war so klein, dass man auf den ersten Blick meinen konnte, es handle sich um ein Kind.
»Na, was hast du da in deinem Korb?«, fragte Ernst.
Das kleine Weib strahlte ihn an und ließ eine stattliche Zahnlücke im Unterkiefer sehen. »Zitronen. Willst ’n poor? Blots fünf Penningen.«
»Nee, nee. Ich wollte nur wissen, ob du gern Zitronen verkaufst.«
Ihre Augen wurden groß. Sie starrte erst Ernst an, dann Frieda. »Is er ’n Tüderbüdel?«
»Bitte?«
»Sie denkt, ich bin nicht ganz richtig im Kopf«, erklärte Ernst, »weil ich annehme, dass sie nur aus Jux und Dollerei den ganzen Tag diesen schweren Korb mit sich rumschleppt. »
Frieda holte tief Luft, wie ungerecht, sie so vorzuführen, doch die kleine Frau kam ihr zuvor: »Ich bin die Zitronenjette. Wat soll ich wohl sonst machen?«
Ernst verschränkte die Arme vor der Brust. »Tüünkraam, die Zitronenjette is doch längst tot!«
Das stimmte. Sogar Frieda hatte von der Frau gehört, die jeden Tag angefaulte Früchte aus den Hafenschuppen geholt und weiterverkauft hatte. Jedermann in Hamburg hatte sie gekannt, sogar ein Theaterstück über ihr Leben war vor etlichen Jahren in St. Pauli aufgeführt worden. Frieda erinnerte sich, dass ihr Vater in der Zeitung von Jettes Tod gelesen hatte.
»Ich hatte gehofft, dass sie irgendwo weit weg von Hamburg ein neues Leben begonnen hat«, hatte er damals gesagt. »Haben ihr übel mitgespielt, die Burschen auf St. Pauli.«
»Du kannst dich doch nicht einfach für eine Tote ausgeben – das macht man nicht!«
Ernst war empört.
»Alle konnten sie bannig gut leiden. Geht doch nich, dass sie einfach wech is. Darum spring ich nu für sie ein«, krächzte sie hinter den beiden her.
Frieda musste lächeln. Vielleicht war die Alte doch nicht so verdreht. Im Grunde eine schöne Vorstellung, dass jemand anders einfach einspringen und den Platz eines verlorenen Menschen einnehmen konnte.
Tief in Gedanken sah sie hinüber zum Hafen, wo ein behäbiges graues Dampfschiff am Kai lag.
»Ernst Krüger?« Die Stimme kam von oben. Erstaunt blickte Frieda an Block H hoch, wo vor allem Kaffee gelagert war, wenn sie nicht irrte. Die gesamte Speicherstadt war der Übersichtlichkeit halber in Blöcke aufgeteilt, die, wenn irgendwann alles fertig war, von A bis Z gekennzeichnet sein sollten. Wenigstens eine kleine Orientierungshilfe, wenn man ein spezielles Lagerhaus suchte. Trotzdem war es immer noch schwer genug, sich in der kleinen Handelsstadt, die sogar über ein eigenes Rathaus verfügte, zurechtzufinden, fand Frieda.
»Spreckel!«, rief Ernst.
An der offenen Luke des vierten Stocks stand ein Mann und winkte mit beiden Armen. »Nee, dat glaub ich doch nich, du bist dat wirklich«, rief er und strahlte. Jetzt lehnte er sich so weit vor, dass Frieda schon Angst hatte, er würde jeden Moment vornüberkippen und in die Tiefe stürzen.
»Kann man wohl sagen!« Ernst riss den Arm hoch und schwenkte lachend seine Mütze.
»Wo hast du dich bloß so lange rumgetrieben? Alle dachten, dich hat ’ne Granate erwischt oder ’ne Kugel. Warte, ich komm runter!«
Ein paar Sekunden später erschien Spreckel in der Tür. Er trug eine dunkelblaue Schirmmütze auf dem Kopf, eine blaue Hose und eine schwarze Jacke mit zwei Reihen großer runder Knöpfe. Vier, fünf Schritte mit rudernden Armen, dann war er bei ihnen, packte Ernst an den Schultern und schüttelte ihn, als müsse er sich von dessen Echtheit überzeugen.
»Mönsch, wir dachten, du bist tot.«
»Ach was, Unkraut vergeht nicht.«
»Wie geht’s dir denn, Jung?«
»Schlechten Menschen geht’s immer gut, weißt du doch.« Schon lachten sie wieder, umarmten sich und klopften einander auf die Schultern.
Frieda räusperte sich. Die beiden sahen sie an, als sei sie eben erst aufgetaucht, als hätte jemand sie klammheimlich auf dem Kopfsteinpflaster abgestellt.
»Darf ich vorstellen?« Ernst deutete mit leichtem Kopfnicken auf Frieda. »Friederike Hannemann.«
»Vom Kakao-Hannemann?« Der Bursche musterte sie neugierig, dann schnitt er eine Grimasse, die wohl Bewunderung ausdrücken sollte. »Ach ja, für den hast ja gearbeitet vorm Krieg«, meinte er. »Denn is das die Tochter vom Alten?«
Frieda zog die Augenbrauen hoch. »Nein, der Alte ist mein Großvater. Nehme ich wenigstens an.«
»Oh, äh, padong, ich wollte nicht respektarm sein.«
»Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
Ernst schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Mensch, Hein, du kannst einen aber auch rammdösig machen.« Er schüttelte den Kopf. »Entschuldigung, Frieda, das ist Quartiermann Hein Spreckelsen.«
Der verneigte sich etwas steif.
»Sehr erfreut«, sagte sie.
»Ong Schontee!« Er verbeugte sich tief. »Aber sagen Sie man lieber Spreckel zu mir, das sagen alle, das kenn ich.«
»Sag mal, Spreckel«, begann Ernst, und seine Augen blitzten auf diese ganz besondere Weise. Frieda kannte den Blick nur zu gut, Ernst führte etwas im Schilde. »Oben bei dir auf’m Verleseboden arbeiten doch auch Fruenslüüd, oder?«
»Wieso, suchst du ’ne Braut?« Spreckel griente über das ganze Gesicht.
»Ach wat, dumm Tüüch«, entgegnete Ernst und errötete. Frieda musste schmunzeln. Das geschah ihm recht. Schließlich hatte er ihr vorhin erst gerade einen Bräutigam aufschwatzen wollen. Nein, für die Ehe waren sie ja wohl beide noch ein bisschen zu jung.
»Klar! De Mannslüüd sind ja alle weg. Na, nicht alle«, sagte Spreckel, und wieder klopfte er Ernst fröhlich auf die Schulter. »Gott sei Dank nicht alle. Nee, das Verlesen ist schon lange Frauensache. Das machen seit jeher unsere Kaffeemietjes«, meinte er fröhlich.
»Das ist gut. Ich frag wegen Fräulein Hannemann. Die will unbedingt arbeiten.« Ernst setzte eine Unschuldsmiene auf.
Spreckel dagegen klappte die Kinnlade herunter, und ein Speicheltropfen kullerte über die Unterlippe. »Die Mademoiselle will bei Spreckelsen und Consorten anheuern?« Frieda wusste nicht, was sie dazu sagen sollte.
Glücklicherweise sprang Ernst in die Bresche: »Na, zumindest mal gucken würde sie schon gerne. Ich mach nur Spaß, Spreckel. Es geht um die Schwester eines Hausmädchens. Schlimme Sache, ihr Mann ist im Feld geblieben, ihre drei Brüder auch. Jetzt muss sie sich allein versorgen, sie braucht wirklich dringend Arbeit.« Frieda war verblüfft, fast hatte sie vergessen, wie leicht Ernst flunkern konnte.
»Deshalb würde sich die Dame gern ’n büschen umsehen. Stimmt’s, Fräulein Hannemann?«
»Das ist wahr, das würde ich sehr gerne«, gab sie spitz zurück und streckte das Kreuz durch. Sollte Ernst sich nur freuen, sie in eine peinliche Lage gebracht zu haben. Sie hatte schon oft davon geträumt, mal einen der Speicher von innen zu sehen. Bisher hatte ihr Vater ihr meist verboten, die Lagerräume zu besuchen, in denen er seine Kakaobohnen und Kolonialwaren aufbewahren ließ. Es gefiel ihm schon nicht, wenn sie sich überhaupt auf den Brookinseln herumtrieb. Deswegen war sie bisher nur selten in einem Speicher gewesen, und dann auch nur im untersten Stockwerk, wo die Kontore auch nicht viel anders aussahen als die in der Berg- und in der Deichstraße.
Spreckel verneigte sich formvollendet. »Na dann, biengvenü in meiner bescheidenen Hütte. Ist aber ’n büschen anstrengend bis ganz oben auf den Verleseboden«, warnte er sie. Er sah an ihr herunter. »Und ganz sauber isses auch nicht.«
»Schon gut, wir haben eine ausgezeichnete Wäscherin.« Ehe Frieda sich’s versah, betrat sie mit den beiden Männern das Gebäude. »Denk bloß nicht, du kannst mich ärgern, Ernst Krüger«, zischte sie. »Ich habe dich durchschaut, ich weiß genau, was du vorhast.«
»Ich weiß gar nicht, was du meinst.«
Er ließ ihr den Vortritt. Frieda hatte das Gefühl, als würde sie eine Kathedrale betreten. Nur dass es nicht nach Wachs duftete, sondern eher ein wenig nach Stroh und nach Kaffee. Sie folgte Spreckel in die erste Etage, dann in die zweite. Dann hielt sie es nicht länger aus.
»Und in diesen Stockwerken wird überall Kaffee gelagert?«
»So isses. Wollen Sie mal sehen?«
»Wenn das möglich ist.«
»Kloor!« Leiser sagte er: »Gediegen, Sie sind ’ne verdrehte Person, Frollein, kann das sein?«
»Spreckel!«, wies Ernst ihn zurecht.
»Ich mein ja man nur. Ich kenn keine Dame, die sich für’n Lagerboden interessiert.« Vor ihnen tat sich ein Raum auf, dessen Anblick Frieda den Atem stocken ließ. Große Säcke, so weit das Auge reichte, ordentlich gestapelt, als seien sie an einem unsichtbaren Rahmen ausgerichtet worden. Selbst in den hintersten Ecken türmten sie sich auf. »So ’n Sack wiegt sechzig Kilo«, begann Spreckel zögernd. »Den kannst nicht einfach so an seinen vier Zipfeln packen. Der rutscht dir weg.« Frieda hatte ihren Rock leicht angehoben und ging von einer Reihe zur nächsten. Staunend betrachtete sie die ungeheuren Mengen. »Und die Hände machst dir auch kaputt an dem störrischen Sisalzeug«, fuhr er fort. »Wir ham spezielles Werkzeug zum Anpacken. Griepen nennen wir die Dinger.« Offenbar hatte Spreckel begriffen, dass sie sich wirklich für all das hier interessierte, denn er war nun ganz in seinem Element. »An der Wand fängst mit dem Achtersacker an.« Sie sah ihn fragend an. »So heißt die Technik, mit der wir die Säcke an der Wand hoch stapeln.« Mit einem kurzen Wink forderte er Ernst auf, ihm zu helfen. Gemeinsam schnappten sie sich einen der dunkelbraunen Ungetüme und legten es gegen eine leere Wand. Ein weiterer Sack landete direkt davor, den nächsten platzierten sie so, dass er schräg auf dem ersten und zweiten zu liegen kam. »Nu käme wieder einer vorne drauf und immer so weiter«, erläuterte er. »Hält bombenfest und verrutscht nie nicht, so ’n Achtersacker.«
»Ja, Spreckel, nun ist mal wieder gut.« Ernst seufzte vernehmlich und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Ich finde das faszinierend.« Sie schenkte Ernst einen frechen Seitenblick und dann Spreckel ihr schönstes Lächeln. »Der Stapel da drüben sieht ganz anders aus.« Schon machte sie sich auf den Weg, Ernsts Stöhnen im Ohr.
»Das ist ’n Bock. Immer ein Sack so rum.« Spreckel malte mit beiden Händen eine breite Linie von links nach rechts in die Luft. »Und denn zwei so rum drauf.« Nun deutete er zwei Linien von vorne nach hinten nebeneinander an.
»Ich verstehe.«
»Ich hab mich spezialisiert auf Kaffee«, erklärte er ihr stolz. »Is ja nicht nur, dass die Säcke gelagert werden müssen, also, richtig gelagert, dass da nix schimmeln kann und so. Nee, das Gewicht muss überhaupt erst mal stimmen und die Qualität. Ich muss die Ware prüfen, Kaffeeproben verschicken. Da gibt das ’n extra Briefkasten für, wissen Sie?«
»Komm schon, Spreckel«, brummte Ernst wieder.