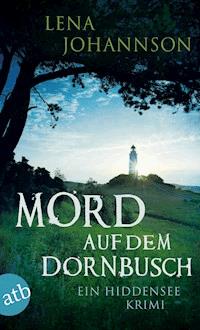
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Conny Lorenz ermittelt
- Sprache: Deutsch
Tod auf Hiddensee.
Der Möchtegern-Autor Ronald Udnik organisiert die Literaturtage auf Hiddensee. Star der Veranstaltung ist Dorinda Schwarz, eine ebenso schillernde wie geheimnisvolle Diva der Literaturszene. Doch nach ihrem Vortrag wird sie tot am Dornbusch gefunden. Die Art, wie die Leiche zur Schau gestellt ist, gleicht exakt der Darstellung in einem ihrer Romane. Kommissarin Conny Lorenz, die aus Stralsund auf die Insel kommt, stellt bei ihren Ermittlungen fest, dass die Tote viele Feinde hatte: Autoren, Verleger, ehemalige Freunde …
Hiddensee – so spannend und mörderisch, wie man es noch nicht gesehen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Informationen zum Buch
Viel Feind – viel Meer
Eine Schriftstellerin wird auf Hiddensee ermordet – Kommissarin Conny Lorenz übernimmt
Möchtegern-Schriftsteller Ronald Udnik veranstaltet Literaturtage auf Hiddensee, um endlich mehr Anerkennung zu gewinnen. Als Rednerin und echten Publikumsmagnet lädt er Dorinda Schwarz ein, eine ebenso schillernde wie geheimnisvolle Königin der Literatur-Szene. Doch die Autorin wird am Morgen nach ihrer Lesung tot auf dem Dornbusch gefunden. Sowohl der Fundort in direkter Nachbarschaft eines Leuchtturms als auch die Art, wie die Leiche zur Schau gestellt ist, gleichen exakt der Darstellung aus ihrem größtem Erfolg, einem Kriminalroman. Kommissarin Conny Lorenz aus Stralsund macht sich an die Arbeit – und stellt rasch fest, dass die Tote viele Feinde hatte: Autoren, Buchhändler, Verleger …
Lena Johannson
Mord auf dem Dornbusch
Ein Hiddensee-Krimi
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel 1: Teer und Federn
Donnerstag, 04.Dezember
Kapitel 2: Connys zweiter Fall
Freitag, 05.Dezember
Kapitel 3: Geist der Vergangenheit
Freitag, Abend des 05.Dezember
Am Abend vor Dorindas Tod
Samstag, 06.Dezember, neun Uhr
Zwei Wochen vor Dorindas Tod
Kapitel 4: Von Inselschreibern und Heimatdichtern
Sonntag, 07.Dezember
Montag, 8.Dezember
Kapitel 5: Die Aussprache
Dienstag, 09.Dezember
Sechs Monate vor Dorindas Tod
Kapitel 6: Nachtwanderung
Mittwoch, 10.Dezember
Kapitel 7: Böse Überraschung
Donnerstag, 11.Dezember
Freitag, 12.Dezember
Kapitel 8: Ein unmoralisches Angebot
Freitag, 12.Dezember
Am Abend des Todes von Dorinda Schwarz
Zwei Wochen vor Dorindas Tod
Kapitel 9: Zum guten Schluss
Freitag, 12.Dezember
Samstag, 13.Dezember
Sonntag, 14.Dezember
Über Lena Johannson
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Kapitel 1Teer und Federn
Donnerstag, 04.Dezember
Königin des Universums
Du lenkst die Welt nach deinem Willen,
bist Mutter, Schwester, Regentin mir.
Mein ewig Dorn im Auge,
bist die Maria im weißen Kleid.
Du Heilerin, dass all deine Mühe sich lohne,
bring ich dir ein Geschenk dar, eine Dornenkrone.
»Nun lernen wir uns also doch noch persönlich kennen, Herr Schweiger.« Sie nahm einen tiefen Zug aus ihrem Zigarillo.
»Ich bin der Hiddenseer Kollegin zuliebe eingesprungen. Weil sie sich das Bein gebrochen hat und die Veranstaltung von Herrn Udnik unmöglich begleiten kann. Nicht Ihretwegen.«
Der Rügener Buchhändler würdigte sie keines Blickes, sondern sortierte konzentriert die Stapel verschiedener Titel auf dem kleinen Verkaufstisch. Dann schob er Preisschilder zwischen die Seiten der nicht eingeschweißten Exemplare.
»Nun seien Sie mal nicht nachtragend, mein Bester. Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, meine Lesung bei Ihnen nachzuholen.«
Seinem Vorsatz zum Trotz, sie zu ignorieren, baute er sich nun vor ihr auf. Seine Unterlippe zitterte vor Aufregung. Die Art, wie sie ihn ansah, durch nur halb geöffnete Augen mit einem mitleidigen Lächeln um den schmalen Mund, machte es nicht besser.
»Treiben Sie es nicht auf die Spitze, sonst werden Sie es irgendwann bereuen. Wissen Sie eigentlich, in welch peinliche Situation Sie mich mit Ihrer Absage in allerletzter Minute gebracht haben?« Er war laut geworden. Sein Gesicht hatte sich dunkelrot verfärbt.
»Nicht ich habe Ihnen abgesagt«, erklärte sie ruhig. »Meine Schwester hat das getan.«
Er schnaubte. »Ja, weil Sie die Drecksarbeit nicht selbst machen. Sie haben mich hängenlassen und Ihre arme Schwester vorgeschickt, um mir die schlechte Nachricht zu überbringen. Und zwar erst, als das Publikum bereits eingetroffen war. Pfui, Teufel!« Schweiger holte tief Luft. Sein Asthmaspray. Hatte er es eingesteckt? Genau diese Situation hatte er vermeiden wollen, aber nun hatte sie ihn doch so weit gebracht, die Fassung zu verlieren.
»Wenn Sie das sagen«, entgegnete sie ungerührt.
Da klopfte es. Die Tür zum Nebenraum des Arbeitszimmers von Gerhart Hauptmann öffnete sich. Eine Frau steckte zunächst den Kopf herein und trat dann ein.
»Dorinda«, rief sie aus, stürmte auf die Schriftstellerin zu und schüttelte kräftig deren Hand. »Herr Udnik hat mir verraten, dass Sie schon hier sind.« Sie stieß einen Freudenkiekser aus. »Er meinte, Sie haben bestimmt nichts dagegen, wenn ich kurz Guten Abend sage.«
»Dann sagen Sie das doch«, knurrte Schweiger leise.
Die Frau reagierte nicht darauf. Vermutlich hatte sie ihn überhaupt nicht wahrgenommen. Für sie existierte nur Dorinda Schwarz. »Ja, also, er hat mir gesagt, wo ich Sie finden kann.«
»Hat er das?« Das war mehr eine Feststellung als eine Frage. Dorinda befreite ihre Hand aus dem schmerzhaften Griff.
»Natürlich, schließlich bin ich Ihr größter Fan.« Das Stimmengewirr im nebenan liegenden Arbeitszimmer wurde allmählich lauter. Das Publikum füllte offenbar den Raum. »Das sieht man ja wohl.« Sie sah Dorinda auffordernd an.
Die brauchte eine Sekunde. »Aber ja«, sagte sie dann gedehnt. »Sie sehen aus wie Tessa. Der Schal, der Anzug. Sie könnten sie überzeugend verkörpern.« Dorinda schenkte der Frau ein schmales Lächeln.
»Ich mache alles genau wie sie. Meine Wohnung sieht aus wie die von Tessa, ich lese die gleichen Bücher«, erklärte sie eifrig und unterstrich ihre Ausführungen mit unaufhörlichem Kopfnicken.
»Nun, ich hoffe, Sie machen nicht wirklich alles wie sie. Tessa ist eine Serienkillerin.«
»Sie ist so toll«, schwärmte die Tessa-Kopie. »In Gefährliche Gier hätte der Bulle sie fast überführt. Da haben Sie mir ganz schön Angst eingejagt.« Sie wackelte mit dem Zeigefinger vor Dorindas Nase herum, als würde sie sie tadeln wie ein kleines Kind. Auch ihr Ton bekam etwas von einer Mutter, die eine Strafpredigt hielt: »Ich muss sowieso mit Ihnen schimpfen.«
»Ich denke, Sie müssen jetzt gehen«, gab Dorinda kühl zurück. Sie zog ihre Taschenuhr hervor. »In zehn Minuten beginnt mein Vortrag. Ich muss mich gedanklich noch ein wenig darauf vorbereiten. Dafür haben Sie sicher Verständnis.« Gewohnt, dass die Menschen, mit denen sie zu tun hatte, ihren Bitten auf der Stelle nachkamen, wollte sie sich bereits abwenden.
»Nicht so schnell!« Die Stimme der Tessa-Kopie klang plötzlich schneidend, wurde im nächsten Augenblick jedoch gleich wieder jammernd-vorwurfsvoll. »Genau darum geht es ja. Warum halten Sie denn einen Vortrag? Das interessiert doch keinen. Mit Ihren Gedichten kann ich auch nichts anfangen, aber es ist in Ordnung, dass Sie ab und zu welche schreiben. Aber warum lesen Sie denn heute nichts aus den Tessa-Büchern?«
Wieder ein Klopfen. Ronald Udnik steckte den Oberkörper herein.
»Sie sind immer noch hier?« Er trat ein und schloss die Tür hinter sich. Schweiß stand auf seiner Stirn, seine Haut war gerötet. »Ick hatte doch jesacht: janz kurz.«
»Ich bin ja schon weg.« Die Tessa-Kopie kicherte wie ein kleines Mädchen. »Wir sehen uns nachher noch«, sagte sie vertraulich zu Dorinda. Dann wandte sie sich zum Gehen. »Ich werde mir das mal anhören. Wann habe ich sonst schon die Möglichkeit, Sie live zu erleben? Könnten Sie nicht wenigstens ein paar Stellen vorlesen?«
»So, nu ma raus hier«, drängte Udnik und schob sie durch die Tür. »Is gerammelt voll«, verkündete er und sah Dorinda mit seinen runden leuchtenden Äuglein an. »Wir ham noch Stühle zusätzlich reinjestellt.«
»Können Sie garantieren, dass die Luft trotzdem gut ist? Falls es stickig wird, muss ich abbrechen«, ließ sie ihn wissen.
»Und wehe, ein Floh hustet«, setzte Schweiger leise hinzu. In diesem Augenblick trat Sandra Schwarz ein. Sie warf einen prüfenden Blick auf den Büchertisch und dann auf ihre Schwester.
»Bodo Heinze ist auch da«, sprach Udnik weiter.
»Oh, der Dichterfürst höchstpersönlich«, meinte Dorinda herablassend.
»Du solltest nicht so über ihn sprechen«, hielt Sandra ihr vor. »Er ist der wichtigste deutschsprachige Lyrik-Verleger. Du kannst dich glücklich schätzen, dass er deine Gedichte herausbringt.«
»Er kann sich glücklich schätzen, dass ich bei ihm veröffentliche«, stellte sie richtig. »Meine Gedichte bringen gutes Geld. Im Gegensatz zu den hölzernen Reimen dieser schrecklichen Betroffenheitslyriker. Er lebt von Autoren wie mir. Davon gibt es nicht viele. Ich bin sicher, Herr Heinze weiß das ganz genau.«
»Bitte, tu mir den Gefallen, nachher nett zu ihm zu sein, ja? Herr Heinze wird beim Essen auch Gast an unserem Tisch sein.«
»Aber Schwesterchen, ich bin doch immer nett. Wenn ich will.« Sie warf Sandra eine Kusshand zu und zwinkerte verschmitzt.
Anderthalb Stunden später brandete tosender Applaus im Arbeitszimmer des Gerhart-Hauptmann-Hauses auf Hiddensee auf. Fiete Jessen, den Kragen des blauen zerschlissenen Wollmantels hochgeklappt, hörte es mit gemischten Gefühlen. Er sah die hell erleuchteten Fenster. Gern wäre er jetzt da drin. Wie schön musste es sich anfühlen, da vorn zu stehen, derjenige zu sein, dem die Begeisterungsbekundungen galten.
Es gab Bravorufe. Zwei Frauen erhoben sich, noch immer klatschend, von ihren Stühlen. Sie steckten damit die Zuhörer in der Reihe hinter ihnen an. Man hätte nicht sagen können, ob die ebenfalls von so viel Euphorie ergriffen waren, dass sie es nicht länger auf ihren Plätzen aushielten, oder ob es sie einfach störte, dass jemand genau vor ihrer Nase stand. Dorinda Schwarz nahm die enthusiastischen Bekundungen in kerzengerader Haltung und mit einem sparsamen Lächeln entgegen. Sie verbeugte sich nicht, sondern harrte aus, bis der Veranstalter Ronald Udnik vor das Publikum trat. Der Industrielle, der seine Brötchen mit Brot und Kuchen verdient hatte, bevor er mit aller Macht unter die Literaten gehen wollte, hatte einen riesigen Strauß Rosen in verschiedenen Rot- und Lachstönen in der Hand. Die edlen Blumen waren mit Kamille und einem Süßgras kombiniert.
»Sehr verehrte Frau Kollegin«, begann er. Dorindas Augenbraue zuckte. Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu, enthielt sich jedoch eines Kommentars. »Mit Ihrem Vortrag über die Herabwürdigung von Frauen in der Literatur haben Sie – ich sach’s mal etwas unkonventionell – eenen dollen Startschuss für die Literaturtage Hiddensee hingelegt.« Trotz seiner spürbaren Bemühungen, seinen Dialekt zu unterdrücken, war die Berliner Herkunft nicht zu leugnen. »Ick wusste jar nicht, dass es den Frauen in der Literatur so schlecht geht.« Er sah die Zuhörer Zustimmung heischend an. Die Damen und Herren wichen betreten seinem Blick aus. Hier und da war ein Hüsteln zu hören. Einer nach dem anderen setzte sich wieder. »Ist doch ein starkes Stück, dass sogar Heinrich Mann in seinem Professor Unrat die Frau – wie ham Sie das so schön jesagt? – zu einem Objekt degradiert hat. Heinrich Mann«, rief er aus. »Der ach so anerkannte große Schriftsteller!« Das peinliche Schweigen legte sich über den Raum wie ein Spinnennetz, klebrig und lästig, aber nicht sichtbar oder zu greifen.
Sandra Schwarz, die der Veranstaltung auf dem äußersten Platz in der ersten Reihe beigewohnt hatte, stand auf und ging mit freundlichem Lächeln auf Udnik zu.
»Vielen Dank, Herr Udnik, für Ihre abschließenden Worte und vor allem dafür, dass Sie die Literaturtage auf der Insel Hiddensee ins Leben gerufen haben. Jeder hier weiß, wie sehr Sie das geschriebene Wort verehren.« Unterdrücktes Lachen aus einer der hinteren Reihen. »Und ich bin sicher, dass auch jedem bewusst ist, welche Mühen Sie auf sich genommen haben, um auf einer Insel ein so hochkarätig besetztes kulturelles Event auf die Beine zu stellen.« Sie sah ihm in die Augen und applaudierte. Die Anwesenden stimmten zögerlich ein. »Dorinda Schwarz ist sicher das Juwel der Veranstaltung, und wir sind alle sehr gespannt, ob sie die erste Inselschreiberin von Hiddensee wird.« Sie nickte der Schriftstellerin kurz zu. »Leider müssen wir uns noch drei Tage gedulden, bis die Entscheidung verkündet wird.«
Udnik stand noch immer mit dem Blumenstrauß da. Es war offensichtlich, dass es ihm nicht gefiel, wie sie ihm das Ruder aus der Hand genommen hatte. Andererseits hatte sie die Stimmung gerettet und, was viel wichtiger war, sie rückte seine Leistung in ein angemessenes Licht.
»Geduld ist das Stichwort«, fuhr sie an das Publikum gewandt fort. »Wir möchten die Ihre nun nicht länger beanspruchen. Die Künstlerin geht jetzt in den Nebenraum.« Sie deutete auf eine Tür, die Buchhändler Schweiger in dieser Sekunde auf sein Stichwort öffnete. »Dort signiert sie gerne die Bücher, die Sie an einem extra vorbereiteten Tisch reichlich erwerben können. Und gewiss beantwortet sie auch Ihre Fragen.« Applaus, Stuhlbeine kratzten auf den quadratischen Fliesen. Jeder wollte der Erste sein, der mit der berühmten Schriftstellerin Dorinda Schwarz ein paar Worte wechselte. Die drehte auf dem Absatz um und verließ mit hoch erhobenem Haupt den Saal. Udnik sagte noch etwas, doch das ging im anschwellenden Geräuschpegel unter. Also lief er mit den Rosen hinter ihr her.
Fiete Jessen stand noch immer draußen in der Kälte und trat von einem Fuß auf den anderen. Sollte er auf sie warten? Würde sie sich überhaupt dazu herablassen, ein Wort mit ihm zu sprechen?
Der Verkauf von Dorindas Büchern lief so exzellent, dass sogar Schweiger unerwartet gute Laune bekam.
»Eine Tüte für Sie? Nehmen Sie gern auch ein Lesezeichen oder eine Autogrammkarte mit«, forderte er die Kunden fröhlich auf, die brav in einer Reihe standen. »Ach, am besten beides.« Er lachte, kassierte, riss den Büchern die Folie vom Leib. Da hatte sich die Anreise von Rügen doch jetzt schon gelohnt. Und viele der Literaturinteressierten würden gewiss auch an den anderen Tagen zu den Lesungen kommen und kaufen. Vermutlich nicht so viel wie bei Dorinda, dem Star der Szene, aber doch so viel, dass er ein hübsches Sümmchen mit nach Hause nehmen konnte.
Dorinda signierte ein Exemplar nach dem anderen. Sie beantwortete Fragen über ihr Privatleben knapp, die nach der Unterdrückung und Demütigung von Frauen in Romanen und natürlich auch im richtigen Leben dagegen mit leidenschaftlichem Zorn. Stets blieb ihre Miene höflich-distanziert. Nur hin und wieder huschte ein Runzeln über ihre Stirn, wenn undefinierbare Geräusche von draußen anschwollen. Waren das Stimmen? Sie machte ihrer Schwester ein dezentes Zeichen. Die war in der nächsten Sekunde an ihrer Seite.
»Was ist da draußen los?«, wollte sie wissen. »Hört sich beinahe nach Sprechchören an. Sind das Fans, die keine Karten bekommen haben? Dann sollte ich mich ihnen zeigen, denkst du nicht?«
»Unbedingt«, entgegnete Sandra. »Ich kläre das.« Sie verließ eilig den Raum. Kurz darauf war sie zurück und wechselte leise ein paar Worte mit Ronald Udnik. Dann trat sie zu Schweiger.
»Wir sollten nun allmählich zum Ende kommen.«
Der Buchhändler verstand nicht. »Sie sehen doch, was hier noch los ist. Die Herrschaften haben geduldig gewartet, bis sie an der Reihe sind, Bücher zu erwerben und sich signieren zu lassen. Wir wollen doch niemanden enttäuschen.« Er hatte laut gesprochen, um Druck auf die Autorin und deren Schwester auszuüben.
»Wir wollen aber doch die Künstlerin auch nicht überstrapazieren, nicht wahr?«, gab Sandra freundlich zurück. »Sicher hat jeder hier Verständnis dafür, dass sie nach ihrem Auftritt und den zahlreichen Gesprächen, die sie geführt hat, erschöpft ist. Zehn Minuten noch«, ordnete sie an und wandte sich wieder an Udnik, der den Raum nach ihrem letzten kurzen Wortwechsel verlassen hatte, und nun wieder zur Stelle war. Er wirkte äußerst angespannt, noch mehr als vor Beginn des Vortrags. Von irgendwoher war jetzt Klaviermusik zu hören.
»Gehen Sie ruhig vor«, bot die Tessa-Kopie einer kleinen Frau an, die hinter ihr nervös auf und nieder wippte und zwischendurch immer wieder zu dem vorderen Ende der Warteschlange blickte. »Ich kenne Dorinda quasi persönlich«, erklärte sie und beugte sich vertraulich zu ihr herunter. »Wir sind sowieso verabredet. Nutzen Sie also mal lieber die Gelegenheit, bevor sie sich ausruhen muss.«
»Das ist aber sehr nett!« Die kleine Frau huschte augenblicklich vor die Tessa-Kopie, das Portemonnaie schon in der Hand.
Schweiger beeilte sich, die Kundschaft im Eiltempo abzufertigen. Keine zehn Minuten später war tatsächlich alles erledigt. Die letzten Zuhörer verließen den Saal.
»Ich hätte ihr gern noch ein paar Fragen gestellt«, sagte ein Herr in Knickerbocker, Weste und mit einer Baskenmütze auf dem Kopf. »Zum Beispiel, ob es nicht auch demütigende Darstellungen des männlichen Geschlechts in der Literatur gibt, wovon ich zutiefst überzeugt bin.«
»Sehr interessanter Aspekt«, stimmte eine Dame ihm zu. »Tja, schade, aber man kann ja verstehen, dass Dorinda nicht mit jedem ausführlich reden kann. Wir können froh sein, dass sie uns noch unsere Exemplare signiert hat.«
Endlich waren Udnik, Schweiger, Dorinda und Sandra Schwarz allein. Von der Tessa-Kopie einmal abgesehen.
»Wenn ich Sie jetzt auch bitten dürfte …«, sagte Sandra.
»Momentchen, ich habe mich Dorinda noch nicht einmal vorstellen können.« Sie schoss mit ausgestreckter Hand auf die Künstlerin zu. »Mein Name ist nämlich gar nicht Tessa.« Sie lachte schrill. »Ich bin Eva«, erklärte sie und schüttelte Dorindas Hand, »Eva Schuster.«
»Freut mich, Eva«, entgegnete Dorinda müde.
»So, nu isses aber jut. Nu machen Sie mal schleunigst, dass Sie wegkommen!«
»Na, na, lieber Kollege.« Dorindas Ton strotzte geradezu vor Ironie. »Wir wollen doch schön höflich bleiben. Immerhin leben wir alle von unseren treuen Lesern.« Sie bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick.
Sandra trat zu ihr. »Er hat recht, sie muss weg. Wir haben ein kleines Problem«, flüsterte sie eindringlich. Wieder wurden draußen Stimmen laut, die die Klavierklänge von Schumann mit Leichtigkeit übertönten. Dieses Mal klang es nach einer Auseinandersetzung.
»Was gibt es denn?« Dorinda war irritiert. Auch Eva, die die Szene beobachtete, wusste offenbar nicht, was sie damit anfangen sollte.
Udnik packte Eva am Arm. »Sehr nett, dass Sie gekommen sind. Jetzt ist mal Feierabend. Für die Künstlerin is een Tisch reserviert. Sie wird im kleinen Kreis essen. Det verstehen Sie bestimmt.« Damit versuchte er, sie zum Ausgang zu befördern.
»Es ist nett, dass ich gekommen bin?« Sie war sehr laut geworden, ihre Augen wanderten beinahe panisch von ihm zu Dorinda und wieder zurück. »Es ist ein großes Opfer, ein unfassbar großzügiges Zeichen meiner Verehrung«, ereiferte sie sich. »Ich arbeite auf Vierhundertfünfzig-Euro-Basis in einem Hofladen. Da stehe ich jeden Tag an einem heißen Kessel und koche Bonbons und Lollis. Für die paar Kröten! Wissen Sie überhaupt, wie schwer es für mich war, das Geld für die Überfahrt auf die Insel und die Unterkunft zusammenzukratzen?« Sie blickte böse in die Runde. »Nee, das wissen Sie natürlich nicht. Sie verdienen bestimmt alle ein Schweinegeld.«
»Da täuschen Sie sich mal nicht«, murmelte Schweiger. Dann sagte er: »Ich bin mal weg. Bis morgen!« Er rollte die Kiste mit den wenigen Restexemplaren an Eva vorbei hinaus.
»Es ist wirklich anerkennenswert, dass Sie trotz Ihrer schwierigen finanziellen Lage hergekommen sind«, warf Sandra ein. Sie klang angespannt. »Bedauerlicherweise müssen wir uns etwas beeilen. Wie Herr Udnik ganz richtig sagte, ist ein Tisch für die Schriftstellerin reserviert.«
»Da wird doch wohl noch ein Plätzchen frei sein«, giftete Eva. »Immerhin bin ich Dorindas größter Fan. Und ich bin extra hergekommen. Dorinda, sagen Sie doch auch mal was! Sie wollen mich doch nicht wegschicken, oder?«
»Es tut mir sehr leid, aber es ist alles für mich organisiert. Ich selbst habe gar keinen Einfluss …« Weiter kam Dorinda nicht, denn die Tür zum Arbeitszimmer flog auf, Schritte krachten über die Fliesen. Dann stand eine Frau mit streichholzkurzem Haar, in das eine rote Strähne gefärbt war, einer lila Hose und einem schwarzen Mantel mit Stehkragen im Raum.
»Hier verkriechen Sie sich also. Die große Dorinda Schwarz hat Angst. Oder sollte ich Sie lieber H. Mann nennen?«
»Was hat das denn zu bedeuten?«, wollte Eva wissen. »Soll ich sie an die frische Luft befördern? Ich meine, Tessa wüsste, wie sie mit so einer unverschämten …«
Alle setzten sich gleichzeitig in Bewegung. Sandra ging auf die Dame im Mantel zu, Udnik führte die laut protestierende Eva nach draußen, und Dorinda hatte zunächst einen Schritt auf die Unbekannte zu gemacht, zog sich aber auf einen kaum erkennbaren Wink ihrer Schwester hinter den Tisch zurück, an dem sie soeben noch signiert hatte.
»Hören Sie, es ist nicht unüblich, dass Autoren unter verschiedenen Pseudonymen unterschiedliche Genres bedienen. Es ist aber auch nicht nötig, diese Tatsache an die große Glocke zu hängen«, erklärte Sandra fest.
Die Frau lachte auf. »Ich glaube gern, dass sie die große Glocke meidet. Das Wort ›bedienen‹ passt in diesem Zusammenhang übrigens ausgezeichnet. H. Mann schreibt pornografische Texte der derbsten Art. Aber das brauche ich Ihnen wohl kaum zu sagen. Wer sind Sie überhaupt?« Sie sah Sandra kurz stirnrunzelnd an, sprach aber weiter, bevor die Schwester der Autorin antworten konnte. »Dorinda Schwarz versteckt sich hinter einem geheimnisvollen ausgesprochen männlichen Pseudonym. Es ist wirklich unfassbar jämmerlich. Hier hält sie scheinheilig einen Vortrag über die Erniedrigung von Frauen in der Literatur, als Kerl namens H. Mann ist sie selbst ganz weit vorne, was die verbale Demütigung des weiblichen Geschlechts angeht«, fauchte sie.
»Was erwarten Sie jetzt von ihr?«
»Sie soll mit nach draußen kommen. Einige ihrer ahnungslosen Fans glauben uns nämlich nicht. Sie soll sich öffentlich zu ihrer Doppelzüngigkeit bekennen.«
»Hören Sie, vielleicht können wir eine andere Lösung …«
»Aber ja, natürlich komme ich mit Ihnen nach draußen«, unterbrach Dorinda das Gespräch. »Geben Sie mir bitte eine Minute, damit ich mich eben kurz frisch machen kann.« Sie deutete auf ihre schweißglänzende Stirn. »Nur ein wenig abtupfen und das Gesicht mit Wasser benetzen.« Sie rang sich ein Lächeln ab, das sie beinahe mädchenhaft aussehen ließ. »Dann bin ich bei Ihnen.«
Die Frau war erstaunt. Sie nickte langsam. »Sehr gut. Wir sehen uns dann draußen.« Damit rauschte sie davon, vermutlich auf direktem Wege zu ihren Mitstreiterinnen, um das große Ereignis anzukündigen.
»Ich will doch stark hoffen, dass es hier einen Hinterausgang gibt«, wandte Dorinda sich an Sandra. Die Schwestern waren allein.
»Nein, den gibt es nicht. Doch, ja, es gibt einen zweiten Ausgang, nur müssen wir trotzdem vorne vorbei, um das Grundstück zu verlassen. Es sei denn, du bist bereit, über einen ziemlich hohen Zaun zu klettern.«
»Kann dieser unsägliche Udnik nicht eine Leiter auftreiben, oder wenigstens einen Stuhl anstellen?«
Kaum, dass sie es ausgesprochen hatte, war Udnik zurück. »Ick habe die Polizei verständigt. Das ist eene nicht angemeldete Kundgebung, wa? Die kriegen gleich jede Menge Ärger. Wir haben zwar nur einen Dorfsheriff mit Gehilfin, aber die machen det schon.«
»Dann werde ich mich mal frisch machen und dann hinausgehen. Das Spektakel möchte ich doch nicht verpassen.« Sie lächelte schmal.
»Wir warten, bis die da draußen verschwunden sind«, bemerkte Sandra.
Dorinda blieb stehen und wirbelte herum, als hätte sie jemand am Arm gepackt. »Ich entscheide, was getan wird«, zischte sie. »Und ich sage: Ich gehe raus zu meinen Fans und zeige ihnen, dass ich nichts zu verbergen habe.«
Es war zwar ein überschaubares Grüppchen von sieben Frauen, das sich zusammengefunden hatte, doch die brachten ihren Protest vehement zum Ausdruck.
»Der Kampf für Frauen eine Farce, Dorinda Schwarz, schäm dich was!«, skandierten sie, sobald diese aus dem Gerhart-Hauptmann-Haus trat. Um die Frauen herum, die ihre Schilder hochhielten, standen einige der Zuhörer des Vortrags, die anscheinend wissen wollten, was von den ungeheuerlichen Anschuldigungen zu halten war. Fiete stand ein wenig abseits im Schatten hoher Kiefern. Diese Dorinda war doch ein Star. Wie konnten die sich nur trauen, eine Berühmtheit vor allen Leuten so anzugreifen? Dorinda las die Aufschriften auf den in die Höhe gereckten Tafeln: Dorinda Schwarz war auf einem durchgestrichen. Daneben stand in fetten Buchstaben H. Mann. An anderer Stelle war »Dorinda, pfui, schäme dich!« zu lesen. Auf einem weiteren war gar von Verrat an ihren Geschlechtsgenossinnen die Rede.
»Wo bleibt denn die Polizei?«, raunte Sandra, die dicht an der Seite ihrer Schwester blieb, Udnik zu.
»Müssen gleich da sein«, gab der zurück. Trotz der winterlichen Temperaturen stand ihm der Schweiß auf der Stirn. Sandra setzte ihr professionelles Lächeln auf, mit dem sie Dorinda schon so manches Mal die Haut gerettet hatte. Mit einem Handzeichen forderte sie die Anwesenden auf, ruhig zu sein. Als die Sprechchöre endeten und das Stimmengewirr abebbte, setzte Sandra an, ein paar Worte zu sagen.
Dorinda kam ihr zuvor: »Meine lieben Schwestern im Geiste!« Widerspruch war zu hören. »Es ist allgemein bekannt, dass ich mich niemals in eine Schublade stecken lasse. Neben meinen Pamphleten verfasse ich Kriminalromane und auch Gedichte. Sie würden staunen, was noch alles unter diversen Namen aus meiner Feder stammt.« Sie lachte kehlig. »Meine Kreativität lässt sich nicht einsperren oder in eine bestimmte Richtung zwingen, nur weil diese eine Richtung kommerziellen Erfolg verspricht.« Sie sah herausfordernd in die Runde. Es war einer ihrer großen Auftritte. »Ich bin längst an Kritik gewöhnt. Damit kann ich umgehen«, ließ sie ihr staunendes Publikum wissen. Inzwischen waren die sieben Protestlerinnen verstummt. »Womit ich nur schwer umgehen kann, sind Dummheit und Unverständnis. Obwohl ich mich auch daran längst gewöhnt haben sollte«, setzte sie erschöpft hinzu. »Die Texte, die ich als H. Mann veröffentliche, triefen vor Sarkasmus. Sie sind ein einziger grandioser Vorwurf an die Männerwelt, eine Entlarvung. Schon der Name H. Mann ist der pure Hohn. Haben Sie das wirklich nicht verstanden?« Für einen Moment war es so still, dass nur der eisige Winterwind zu hören war, wie er durch die letzten einsamen Blätter der Bäume rauschte, und von Ferne die Wellen, die kraftvoll an den Strand schlugen. Dann ging alles sehr schnell: Ein Polizeiwagen kam den Sandweg hinauf.
Eine mollige Dame mit ungestümen blonden Locken, die unter einem Lodenhut hervorquollen, rief: »Widerliche Pornografie ist das! Von wegen Entlarvung. Und dann unterstellt sie uns auch noch, wir seien zu dumm, das richtig zu verstehen. Eine Sauerei ist das!« Zustimmendes Nicken, Gemurmel setzte wieder ein. »Der Kampf für Frauen eine Farce, Dorinda Schwarz, schäm dich was!«, wiederholte die Blondgelockte. Als sie den Slogan erneut rhythmisch anstimmte, setzten die anderen ein. Die Grauhaarige, die Dorinda aufgefordert hatte, herauszukommen, griff blitzschnell nach einem Eimer, trat rasch auf Dorinda zu und schüttete ihr eine schwarze Flüssigkeit entgegen. Gleichzeitig war eine schmächtige Rothaarige mit einem weiteren Eimer hinzugetreten, den sie ebenfalls in Dorindas Richtung leerte. Federn wirbelten durch die Dezemberluft. Dorinda stieß einen kurzen Schrei aus, hatte sich jedoch sofort wieder unter Kontrolle.
»Nu machen Sie doch wat!«, rief Udnik Inselpolizist Michael Wolter und dessen Kollegin Marlene Jessen zu, die soeben aus ihrem Fahrzeug geklettert waren. Um Udniks Mund lag die Andeutung eines schadenfrohen Lächelns.
»Alles in Ordnung?« Sandra zupfte eine Feder von Dorindas Schulter.
»Nichts passiert«, antwortete die Autorin leise. »Sie hätten näher herankommen müssen, um mich richtig zu treffen. Aber dazu fehlte ihnen wohl der Mut.«
»Was ist denn hier los?«, brüllte Michael gegen die nicht enden wollenden Sprechchöre und das Getuschel der aufgebrachten Fans an. »Diese Versammlung ist nicht angemeldet. Und wir haben es außerdem mit einem tätlichen Angriff zu tun, wenn ich das richtig sehe. Meine Kollegin und ich werden jetzt mal Ihre Personalien aufnehmen, meine Damen.« An Dorinda und Sandra gewandt, sagte er: »Sie warten am besten drinnen. Womöglich holen Sie sich hier draußen noch den Tod. Wir sind dann gleich bei Ihnen.«
»Wir haben einen Tisch bestellt. Hier gleich gegenüber im Kirchblick oder wie immer das heißt«, wandte Sandra ein. »Können wir nicht bitte endlich dort hingehen und in Ruhe etwas essen? Wenn es sein muss, können wir morgen in Ihr Büro kommen und eine Aussage machen.«
»Es ist doch gar nichts passiert«, pflichtete Dorinda ihr bei.
»Seh ick auch so, Wolter. Ick komm morgen vorbei und erzähle Ihnen, wat hier gelofen is.«
Michael sah von einem zum anderen. Sein Blick blieb an Dorinda hängen. »Ich nehme an, Sie wollen sich ’n büschen trockenlegen. Etwas von der Pampe haben Sie ja doch abgekriegt. So wollen Sie bestimmt nicht ins Restaurant gehen.« Er lächelte ihr freundlich zu. »Is in Ordnung, wenn Sie morgen in die Polizeistation kommen.« Er nickte noch einmal, dann schenkte er seine volle Aufmerksamkeit den Demonstrantinnen.
»Das war nur gefärbtes Wasser«, sagte eine kleinlaut. »Als Symbol für das Teeren und Federn. Damit hat man schon früher Kriminelle dauerhaft bloßgestellt«, erklärte sie. »Und das ist doch nun wirklich kriminell, wenn jemand etwas hintenherum macht, was er offiziell verurteilt.«
»Unmoralisch«, stellte Michael richtig, »aber nicht gleich kriminell. So, denn legen Sie mal los: Name, Adresse, Unterkunft auf Hiddensee.«
»Moin, Fiete, was machst du denn hier?« Marlene wandte sich an Fiete, mit dem sie um diverse Ecken verwandt war. Der hatte sich ein wenig näher herangewagt, den Kragen seines Mantels bis an den Rand der ebenfalls dunkelblauen Strickmütze geklappt.
»Moin, Marlene. Wieso soll ik woll nich hier sein? Is doch ’ne Literaturveranstaltung. Und ik heff auch schon mal een Book schreven.«
»Du, Fiete?« Marlene konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Das wusste ich ja gar nicht.«
»Nee, dat interessiert ja auch keen een nich. Nur weil ich nich berühmt bin wie die da.«
»Das war die Frau Schwarz auch nich von Geburt an.« Marlene lächelte ihm freundlich zu. »Is ein langer Weg, kann ich mir vorstellen.«
»Siehst, deshalb bin ik hier. Wollte die mal sehen, die beim Hauptmann in der guten Stube lesen darf. Un fragen wollt ik, wie man das anstellt, was man machen muss, dass man das darf.«
Sandra hatte ihre Schwester wieder in das Haus geführt. Sie half ihr, die Flecken auszureiben und das Kleid am Händetrockner wenigstens so weit hinzubekommen, dass Dorinda sich nicht gleich erkälten würde, weil sie den Rest des Abends in nassen Sachen verbrachte. Ronald Udnik hatte sich bereits verabschiedet. Er wollte im Restaurant Bescheid geben, dass es etwas später würde. Außerdem wollte er sicherstellen, dass man den besten Tisch reserviert hatte, damit es nicht noch eine weitere Katastrophe gäbe.
Als Dorindas Sachen so weit wieder hergerichtet waren, dass sie gehen konnten, sagte Sandra: »Ach, wie dumm, ich habe meine Handschuhe irgendwo liegen gelassen. Ich sehe rasch nach, wo sie sind. Warte hier auf mich!«
»Ich verbitte mir diesen Befehlston«, gab Dorinda schneidend zurück. »Den hast du in letzter Zeit öfter am Leib.« Sie funkelte ihre Schwester böse an. »Ich bin hungrig. Warum soll ich auf dich warten? Der Abend war lang und anstrengend genug. Du wirst doch wohl alleine einmal die Straße überqueren können.«
Sandra sah sie lange nachdenklich an. Dann sagte sie leise: »Wie du willst. Wir sehen uns dann drüben.« Sie ging mit gesenktem Kopf.
Endlich allein. Dorinda betrachtete kritisch ihr Spiegelbild. Das bläulich-schwarze Haar glänzte, der Schnitt saß erstklassig, links sehr kurz, rechts bis über das Ohr reichend mit schrägem Pony, ihr Make-up war perfekt. Sie wäre zufrieden gewesen, hätte es da nicht die Falten an ihrem Mund gegeben, die ihr überhaupt nicht gefielen. Sie musste sich dieses spöttische Lächeln abgewöhnen. Ganz von allein verzogen ihre Lippen sich zu eben der Miene, die sie so häufig aufsetzte. »Steht mir gut«, dachte Dorinda. Dumm nur, dass dieser Gesichtsausdruck unschöne Spuren hinterließ. So war es auch mit den Pseudonymen. Hatte sie sich wirklich eingebildet, es würde nie herauskommen, wer hinter all diesen Fantasienamen steckte? Gemeinsam mit ihrer Schwester hatte sie damals darüber nachgedacht, ob man nicht offen damit umgehen sollte. Es gab genügend Kollegen, die das taten. Einige schrieben es sogar auf die Umschläge: »Anna Korritky schreibt als Ellen Mansfield«. Offensiver ging es nicht. Nur handelte es sich bei denen auch um zwei verschiedene Krimi-Reihen mit unterschiedlichen Ermittler-Helden oder um historische Romane auf der einen und aktuelle Liebesgeschichten auf der anderen Seite. Da konnte man ruhig darauf hinweisen, dass alles aus einer Feder stammte. Aber eine Frauenrechtlerin, die Pornos schrieb? Eine Dichterin, die blutrünstige Szenen zu Papier brachte? Sie hatten sich gemeinsam dagegen entschieden. Natürlich. Aber früher oder später hatten sie ja auffliegen müssen. Dorinda atmete tief durch. Na schön, Skandale kurbelten das Geschäft an. Vielleicht sollte H. Mann für eine Weile von der Bildfläche verschwinden. Sex sells, sie hatten mit dieser erotischen Reihe einen Haufen Geld verdient. Und es bereitete ihr ein gewisses Vergnügen, diese Texte zu verfassen. Dennoch war es womöglich klüger, in dieser Sparte eine Zeit nichts Neues auf den Markt zu bringen. Umso mehr Aufsehen würde es erregen, wenn H. Mann sich eines Tages zurückmeldete. Man könnte Gerüchte streuen, dass jetzt ein anderer das Pseudonym übernommen habe. Was auch immer. Sie wollte sich keine Gedanken mehr darüber machen. Sandra würde am besten wissen, was zu tun war. Dorinda fühlte sich mit einem Mal schrecklich müde. Wie sollte sie den Abend in Gesellschaft dieses furchtbaren selbstgebackenen Literaten und ihres anstrengenden Lyrik-Verlegers nur überstehen? Sie wühlte in ihrer Handtasche, schob Autogrammkarten und Füllhalter beiseite, kramte ungeduldig zwischen Pfefferminzpastillen, Taschentüchern und mehreren Lippenpflegestiften ein Silberdöschen hervor. Sie nahm eine Pille heraus. Nein, das würde nicht reichen. Besser, sie schluckte zwei von den Dingern, die beiden letzten. Wurde Zeit, dass sie sich wieder etwas besorgte. Dorinda trank direkt aus dem Wasserhahn und schluckte ihre Wachmacher. »Was wäre ich nur ohne sie?«, flüsterte sie, straffte den Körper und verließ das Haus des großen Gerhart Hauptmann.
Eisige Kälte und Dunkelheit schlugen ihr entgegen. Vorsichtig blickte sie den Kirchweg hinauf. Es war ein gutes Stück bis zu dem Restaurant. Warum hatte sie nicht einfach getan, was ihre Schwester gesagt hatte, und auf sie gewartet? Dorinda war fast sicher, dass die Frau mit der roten Strähne oder die Blondgelockte im nächsten Augenblick auf den offenbar recht frisch gepflasterten Weg springen würde. Ach was, sie stellte sich ja an wie eine Närrin. Entschlossen brach sie auf. Was war das? Sie blieb stehen, spitzte die Ohren. So, wie es die Frauen in ihren Romanen taten, wenn sie ein beängstigendes fremdes Geräusch hörten, ein unerklärliches Knistern. Nein, da war nichts. Der Wind spielte mit den Bäumen, das war alles. Dorinda lachte laut auf. Zum ersten Mal fragte sie sich, warum sie die Figuren in ihren Büchern in einer solchen Situation stehenbleiben ließ, anstatt dass sie davonrannten. Sie setzte sich wieder in Bewegung. Es war geradezu absurd, zur Salzsäule zu erstarren, wenn man einen Verfolger hinter sich glaubte. Das musste sie in ihrem nächsten Krimi berücksichtigen. Knacken. Ziemlich laut und gar nicht weit von ihr. Sie kniff die Augen zu, die von dem kalten Wind zu tränen begannen. Da war ein schmaler Pfad, kaum erkennbar. Hatte sich da nicht etwas bewegt? Sie glaubte, eine Männergestalt ausmachen zu können. Dorinda drehte sich um, blickte zurück. Niemand zu sehen. Ob Sandra bereits im Restaurant saß und es sich gut gehen ließ? Schon möglich, denn Dorinda hatte doch eine ganze Weile in der Toilette des Hauptmann-Hauses zugebracht. Andererseits konnte es dauern, wenn Sandra etwas suchte. Dorinda war schon öfter aufgefallen, dass ihre Schwester manchmal abtauchte. Sie entschuldigte sich, weil sie ein Telefonat führen oder etwas holen wollte. Dann verging eine erstaunlich lange Zeit. Dorinda hatte den Verdacht, dass ihr die Menschen einfach manchmal zu viel waren. Schließlich stand sie an Dorindas Seite auch ein wenig in der Öffentlichkeit und hatte nicht viele Gelegenheiten, für sich zu sein.
»Hallo?«, rief sie, einer plötzlichen Laune folgend, und blickte gespannt in den kleinen finsteren Weg. »Ist jemand da?« Keine Antwort. »Trauen Sie sich ruhig heraus«, sagte sie betont fröhlich. »Ich beiße nicht.« War das nicht ein leises Rascheln? »Ich gebe Ihnen ein Autogramm, wenn Sie möchten.« Wieder Rascheln. Aber niemand gab sich zu erkennen, kein Mensch, der aus der Deckung kam. Kälte. Dorinda lief weiter, beschleunigte ihren Schritt. Jetzt konnte sie die Kirche sehen, oder besser: erahnen. Die Umrisse des kleinen Gotteshauses zeichneten sich kaum von dem grauen Nachthimmel ab. Irgendwie unheimlich der Gedanke, dass dort auf dem kleinen Friedhof, nur wenige Meter von ihr entfernt, die Überreste von Gerhart Hauptmann lagen, in dessen Haus sie gerade gewesen war, ohne dass er sie eingeladen hatte. Ihr Atem bildete einen feinen Nebel vor ihrem Mund. Keine Menschenseele weit und breit, als sei diese lächerlich kleine Insel ausgestorben. Dorinda wollte nur noch die Gaststätte erreichen, wieder unter Leute kommen, die sie bewunderten. Selbst die Gesellschaft des schreibenden Bäckers erschien ihr in diesem Augenblick erstrebenswert. Trotzdem hielt sie noch einmal kurz inne. Sie musste sich diesen Ort und diese Atmosphäre einprägen. Alles war perfekt für einen Mord. Ihr nächster Krimi war bald fertig, aber es gab sowieso noch zu wenige Opfer. Sie würde Tessa noch einmal losschlagen lassen. Vor einer Kirche in einem verlassenen Dorf. Sie saugte alles in sich auf, das Gefühl der feuchtkalten Luft auf ihrer Haut, den Sandweg unter ihren Füßen – hier hatte man die Hauptstraße nicht gepflastert – und das Zwiegespräch der finsteren Gebäude mit ihrem Nackenhaar. Eine Szene für ein weiteres Buch zu skizzieren, hatte eine zuverlässig beruhigende Wirkung auf sie. Dumm nur, dass sich jetzt die bereits geschriebenen Szenen in ihr Gedächtnis schlichen. Ihr fielen all die grausamen Überfälle ein, Frauen in Todesangst, machtvolle Täter ohne Gnade. Ihr Beruf schenkte ihr das große Privileg, ihre schlimmsten Fantasien durchspielen zu dürfen, ohne dafür Konsequenzen tragen zu müssen. Von ein paar überdrehten Emanzen, die sie mit einer schwarzen Brühe und Federn traktierten, einmal abgesehen. Wie oft schon hatte sie in ihren erotischen Texten junge Mädchen oder vornehme Damen allein durch die Dunkelheit gehen lassen? Natürlich wurden sie immer überfallen und missbraucht. Natürlich hatten sie immer schreckliche Angst, spürten aber auch jedes Mal heftige Erregung, was sie selbstverständlich nicht einmal sich selbst eingestehen konnten. Der Gedanke, ganz in ihrer Nähe könnte ein Kerl auf sie lauern, der in der nächsten Sekunde über sie herfallen und ihr die Kleider vom Leib reißen könnte, verschaffte ihr kein angenehmes Kribbeln, sondern einfach nur unbeschreibliche Abscheu. Sie sah den warmen Lichtschein, der vom Kirchblick nach draußen fiel. Ein beruhigender Anblick. Sie atmete tief durch. Nur noch wenige Schritte. Plötzlich eine Gestalt neben ihr. Lautlos aus der Finsternis aufgetaucht. Woher war sie so plötzlich gekommen? Dorinda kniff die Augen zusammen. Das war doch … das konnte doch unmöglich sein!
»Tessa?«
Das Subjekt zog etwas unter seinem Umhang hervor. Der Umhang. Tessa trug ihn immer, wenn sie mordete! Ein Stich, dann drückender Schmerz am Hals. Dorinda riss die Augen auf.
Kapitel 2Connys zweiter Fall
Freitag, 05.Dezember
»Ich würde die Finger davon lassen.« Hansen warf dem Praktikanten einen kurzen Blick zu. Sein Ton und die Art, wie er den blässlichen jungen Mann mit dem akkurat gezogenen Mittelscheitel ansah, hatten die Wirkung einer Ohrfeige. Psychologiestudent Matthias Wennemann, der in der Kriminalpolizeiinspektion Stralsund auf erhellende praktische Erfahrungen hoffte, zog die Hand augenblicklich zurück und ließ den Becher mit dem Hiddensee-Motiv und der Aufschrift Rügens schöne Schwester im Regal stehen. »Der Pott gehört der Lorenz«, erklärte Hansen.
Seit der Sekunde, als er sein Praktikum angetreten hatte, war Matthias auf Ablehnung gestoßen. Kein Wunder, mit seiner stets adretten, immer einen Hauch zu auffälligen Kleidung, deren i-Tüpfelchen cremefarbene Wildlederschuhe mit roten Applikationen waren, passte er eben nicht hierher. Dass er ein wenig langsam im Denken war und in einer Art Parallelwelt zu leben schien, machte es nicht besser.
»Sollte das nicht unsere Besuchertasse sein?« Kriminalkommissarin Conny Lorenz betrat die kleine Teeküche. Kein Mensch trank hier Tee, trotzdem käme niemand auf die Idee, den mit einer Küchenzeile und einem Tisch mit zwei Stühlen ausgestatteten Raum Kaffeeküche zu nennen. »Auf meiner Tasse steht immerhin mein Name.« Sie zwinkerte Hansen fröhlich zu.
»Und den Namen sollten Sie sich merken, junger Mann. Sie hat die Fachhochschule als Beste ihres Jahrgangs abgeschlossen«, verkündete der mit stolzgeschwellter Brust. Man hätte meinen können, er wäre ihr Vater.
»Ich bin sicher, er hat sich meinen Namen gemerkt.«
»Als Beste ihres Jahrgangs«, wiederholte Hansen.
»Interessant«, gab Matthias zurück und sah Conny forschend an, als sei sie ein seltenes Insekt. Von dem durchdringenden Wissenschaftler-Blick verunsichert, füllte sie ihm Kaffee in den Hiddensee-Becher.
»Ohne Milch und Zucker, stimmt’s?«
»Das ist richtig. Haben Sie vielen Dank!«
Hansen rollte mit den Augen. »Schönen Dank«, brummte er, als Conny auch seine Tasse füllte. Dann folgte er den beiden in das große Büro, das sie sich zu fünft teilten, Praktikant Matthias eingeschlossen. »So eine Jahrgangsbeste sollte man nie unterschätzen«, nahm Hansen den Faden wieder auf. »Seit Frau Lorenz hier ist, hagelt’s nämlich Leichen.«
»Nun übertreiben Sie mal nicht, lieber Kollege.« Conny schmunzelte.
»Ein Fall war gerade abgeschlossen, da hatten wir die nächste Tote auf’m Tisch.« Der Praktikant riss entsetzt die Augen auf. »Nich personaliter, sondern als Fall. Nich ma ein freies Wochenende war drin für die Frau Lorenz. Hab ich also übertrieben?« Er sah Matthias erwartungsvoll an. Der wirkte ein wenig angestrengt und brachte kein Wort heraus. »Nu sagen Sie doch mal was, Sie Studentenschnösel!«, forderte Hansen ihn auf.
»Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.«
Conny schaltete ihren Computer ein. Vielleicht konnte sie eine Aufgabe für Matthias finden und ihn aus Hansens Fängen retten. Sie erinnerte sich noch zu gut an ihren Start, der nicht einmal drei Monate zurücklag. Hansen war ihr gegenüber mindestens genauso abweisend und ruppig gewesen.
»Was gibt’s da wohl nich zu verstehen?«, fragte der gerade. »Ein toter Steuerfahnder auf Hiddensee, Mörder gefasst, und bumms, is der nächste dootbleven.«
»Bitte?« Matthias starrte ihn an.
»Bums, ist der nächste tot geblieben«, sagten Fedder und Brix wie aus einem Mund, ohne von ihren Schreibtischen aufzublicken.
»Wieso geblieben?«
»Das sagt man hier so«, erklärte Conny ihm. »Fragen Sie mich nicht, warum. Soll jedenfalls heißen: Und bums, der nächste Tote. Alles klar?«
»Ach so, ja.« Nach einer kleinen Pause setzte er hinzu: »Das ist ja schlimmer hier als in der Großstadt. Ich dachte …«
»Dat de Lüüd auf’m Land harmloser sind oder netter?«, fiel Hansen ihm ins Wort.
Matthias sah Hansen in die Augen. »Nein, das denke ich allerdings nicht.«
»Was machen Sie noch mal genau hier?«, wollte Hansen wissen. »Ich kapier das immer noch nich so ganz.«
»Ich versuche meine theoretischen Studien an der Universität durch praktische Studien an lebenden Objekten zu bereichern«, erklärte Matthias ihnen hochtrabend zum wiederholten Mal.
»An lebenden Objekten«, murmelte Fedder und schmunzelte vor sich hin.
»Tja, die Objekte bei uns sind aber meist doot.« Hansen musterte ihn herausfordernd. »Sie wollen doch nicht mal Polizist werden, stimmt’s?«, polterte er. »Sie stellen sich bestimmt eher so’ne schicke Praxis vor, wo sie als Psycho-Onkel hocken und die Leute wuschig machen können.«
»Ich studiere Psychologie, Herr Hansen. Ob ich mich jemals selbständig mache, kann ich noch nicht sagen. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten.«
»Mannigfaltig«, sagte Fedder leise und grinste breit.
»Eine dieser zahlreichen Möglichkeiten ist die, als psychic detective zu arbeiten«, führte Matthias unbeirrt aus.
»Als wat?« Hansen und Fedder starrten ihn an, selbst Brix hatte von seiner Arbeit aufgesehen.
Matthias lächelte spöttisch. »Kleiner Scherz.« Er schien zu überlegen, ob er eine weitere Erklärung abgeben sollte, ließ es aber bleiben. »Ich könnte als psychologischer Berater tätig werden, der sich in Verdächtige hineinversetzen kann. Profiler, wenn Ihnen das etwas sagt.«
»Tüünkroom«, schimpfte Hansen. »Die ham schon in der Weimarer Republik versucht, mit sogenannten Telepathen Polizeiarbeit zu machen.« Conny hob erstaunt die Augenbrauen. Hätte sie ihm gar nicht zugetraut, dass er sich mit solchen Dingen auskannte. Aber sie hätte ja auch nicht gedacht, dass Kriminaloberkommissar Hansen Square Dance machte, und doch tat er genau das. »Das ging so weit, dass das Preußische Innenministerium Ende der zwanziger Jahre verboten hat, Hellseher und solche Pappnasen hinzuzuziehen.« Matthias runzelte nachdenklich die Stirn. »Ende der neunzehnhundertzwanziger Jahre«, erklärte Hansen ihm, als sei er schwer von Begriff.
»Ich weiß durchaus, welchen Zeitraum man gemeinhin als Weimarer Republik bezeichnet. Ich dachte nur gerade darüber nach …«
»… wie alt Sie sein müssen, lieber Hansen, um Anekdoten aus der Weimarer Republik zum Besten zu geben«, beendete Conny den Satz. »Vergessen Sie’s, Matthias«, sagte sie an den Kollegen auf Zeit gewandt, »wenn Hansen niemanden ärgern oder verunsichern kann, fehlt ihm etwas. Sie sind momentan das dankbarste Opfer. Ich bin inzwischen langweilig geworden.« Hansen wollte protestieren. »Stimmt’s, lieber Kollege?«, fragte sie und schenkte Hansen ein zuckersüßes Lächeln.
»Och, klei mi doch an de Fööt«, murrte der, verzog sich an seinen Schreibtisch und ließ Matthias einfach stehen. Der runzelte erneut die Stirn.
»Kannst mich an die Füße fassen«, übersetzte Fedder automatisch.
»Kriminalpolizeiinspektion Stralsund, Brix am Apparat.« Conny fragte sich, warum immer Brix an das Telefon ging, wenn es klingelte. Ausgerechnet er, der die Zähne so schwer auseinanderbekam. Im Vergleich zu ihm waren selbst seine einsilbigen Kollegen sabbelig.
»Moin, Wolter«, hörte sie ihn sagen. »Mmh … aha … so. Alns kloor!« Damit war das Gespräch beendet. Die Kollegen sahen ihn erwartungsvoll an. »’n Mord auf Hiddensee. Der Oberstaatsanwalt weiß schon Bescheid. Einer von uns muss hin.«
»Was sach ich?«, rief Hansen und warf Matthias einen triumphierenden Blick zu. Der stand nur da und schaute ungläubig von einem zum anderen. »Is der jetzt stumm, oder wat?« Hansen schüttelte den Kopf.
Conny atmete tief durch. Schon wieder ein Mord. Seit dem letzten Tötungsdelikt befasste sie sich mit einem Mordfall, der vor über zwanzig Jahren im Drogenmilieu der Hansestadt Stralsund stattgefunden hatte. Ein kleiner Kreis hatte damals, wie es aussah, die Süchtigen mit den zu der Zeit üblichen Stoffen versorgt. Als ein Dealer aus Rostock meinte, seinen Kundenkreis gehörig ausdehnen zu müssen, gab es Stress. Nur einer der beiden Konkurrenten hatte den Streit überlebt und galt als Hauptverdächtiger. Nur hatte man ihm nichts nachweisen können. Mit den modernen DNA-Untersuchungsmethoden konnte das ganz anders aussehen. Conny würde die Vergangenheit für eine Weile ruhen lassen müssen. Ein aktueller Mord ging eben vor.
»Hat Wolter etwas Genaueres gesagt?«, wollte sie wissen.
»Opfer weiblich, liegt oben am Dornbusch.«
»Tja, dann mal los.« Sie fuhr ihren Computer herunter. »Tut mir leid, Herr Wennemann. Sie hätten mir gerne bei der Arbeit zugucken können. Nur muss ich mich leider schnellstens auf die Insel bewegen. Ich nehme doch an, es gibt keinen Freiwilligen, der fährt?« Sie sah erwartungsvoll in die Runde. Keine Antwort. »Dachte ich mir doch.« Dann wandte sie sich wieder an Matthias: »Aber ich bin ganz sicher, dass Hansen, Fedder und Brix Sie gern an ihrer Arbeit teilhaben lassen und all Ihre Fragen beantworten.«
»Seit wann ist das überhaupt erlaubt, dass ein Student hier ein Praktikum macht?«, fragte Fedder. »Hieß es bisher nicht immer, das ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich?«
»Frau Lorenz?« Matthias machte einen Schritt auf Conny zu, die gerade bei der Wasserschutzpolizei anrief.
»Ja? Ja, Moin, Lorenz hier«, sagte sie in den Apparat. »Ich bräuchte mal wieder einen exklusiven Taxiservice. Es gibt schon wieder einen gewaltsamen Tod auf Hiddensee.« Während sie der Antwort lauschte, sah sie Matthias fragend an.
»Es ist wohl nicht möglich, dass ich Sie begleite?«
»Nein, das ist völlig unmöglich«, entgegnete sie. »Nein, ich meinte nicht Sie, sondern den Kollegen hier.«
»Kollege!« Hansen schnaubte verächtlich.
»Wunderbar, ich danke Ihnen.« Conny hatte sich einen Transport auf die Insel organisiert. Sie rauschte, ihr Mobiltelefon in der Hand, an Matthias vorbei. Während sie auf dem Weg zu dem Büro von Kriminalhauptkommissar Paul Paulsen war, rief sie Michael an. »Moin, Michael, Conny hier. Was ist denn da los bei euch?« Sie lauschte kurz. »Nee, Brix war mal wieder gesprächig wie eine Nacktschnecke.« Michael lachte, dann klärte er sie auf. »Aha, ist ja interessant. Alles klar, ich bin spätestens um zwölf Uhr auf der Insel.«
Die Tür zu Paulsens Vorzimmer stand offen. »Moin, Renate«, begrüßte Conny die Vorzimmerdame und gute Seele der Dienststelle. »Wir haben schon wieder einen Mord auf Hiddensee.«
»Was? Das gibt’s ja nicht!« Renate schüttelte den Kopf, dass ihr kinnlanger grauer Bob in Schwingung geriet.
»Doch, sieht ganz so aus. Ist Paulsen da?«
»Jo.« Renate erhob sich und marschierte zur von beiden Seiten gepolsterten Tür. »Chef, Frau Lorenz ist hier.« Sie trat einen Schritt zurück und nickte Conny zu.
»Danke, Renate.« Conny schloss die Tür hinter sich.
»Was gibt’s?« Paul hatte Sorgenfalten auf der Stirn, was bei ihm im Grunde nicht der Erwähnung wert war, denn er sah immer ein wenig aus, als plagten ihn mächtige Probleme.
»Hallo, Chef.« Sie lächelte ihn an. Die beiden waren seit langem ein Paar, was die Kollegen allerdings noch nicht wussten. Conny drückte sich davor, ihnen reinen Wein einzuschenken. Würde es nicht aussehen, als hätte sie die Stelle nur bekommen, weil sie mit dem Dienststellenleiter unter eine Decke schlüpfte? »Wolltest du nicht zu diesem Literaturspektakel, das der Udnik auf Hiddensee veranstaltet?«
»Ich dachte, du hast etwas Dienstliches auf dem Herzen«, meinte er und schien zu erwägen, ob er sie auf später vertrösten sollte. Auf seinem Schreibtisch stapelten sich Akten. Dann überlegte er es sich anders. »Ich fürchte, ich habe mich nicht rechtzeitig um Karten gekümmert.«
»Du brauchst keine. Wir haben eine Leiche. Damit kommen wir umsonst rein.«
»Auf Hiddensee? Schon wieder?« Er lehnte sich auf seinem hohen Stuhl zurück.
»Sieh mich nicht so an! Hansen denkt auch schon, dass es etwas mit mir zu tun hat. Seit ich hier bin, hagelt es Leichen, meint er.« Sie verzog das Gesicht.
»Da hat er nicht ganz unrecht.« Sie wollte protestieren, doch Paul war ungeduldig und wollte sofort in Kenntnis gesetzt werden.
»Viel weiß ich noch nicht. Das Opfer wurde heute oben am Dornbusch entdeckt. Soll laut Wolter die Königin der Literaturszene sein.«
»Doch nicht etwa diese Weiß oder Braun oder wie sie heißt?«
»Schwarz, Dorinda Schwarz. Genau die.«
»Ach, du liebe Güte.« Er rieb sich über die Augen. »Unfall ausgeschlossen?«
»Ja. Selbstmord auch. Gestern gab es wohl einen Zwischenfall nach ihrem Vortrag. Mehr kann ich dir morgen sagen, wenn ich mich vor Ort umgesehen und mit Wolter gesprochen habe.«
»Du bleibst über Nacht dort?«
»Hatte ich nicht vor, nein.«
»Warum kannst du mir dann heute Abend nichts erzählen?«, fragte Paul.
»Weil ich spät zurück sein werde und dann nicht mehr ins Büro komme.«
»Du könntest deinen Kater und mich besuchen«, schlug er vor.
Connys Kater Häppchen, der ihr den Umzug aus dem beschaulichen Reinbek nach Stralsund und ihre häufigen Auswärtstermine noch immer übel nahm, lebte seit ein paar Wochen in Pauls Wohnung. Zwar ging Paul ab und zu essen oder in ein Konzert, aber ansonsten war er ein eher häuslicher Typ. Außerdem gab es da noch seine Nachbarin Frau Schmidt. Sie war eine Seele von Mensch, die erst aufblühte, wenn sie jeden in ihrer Umgebung bekochen, mit Kuchen versorgen oder sonst wie verwöhnen konnte, Vierbeiner aller Art eingeschlossen. Deshalb hatten sie gemeinsam beschlossen, dass der Kater bei Paul besser aufgehoben war als in Connys kleiner Wohnung.
»Sehr gerne!« Sie schenkte ihm ein breites Lächeln und erreichte damit immerhin, dass auch seine Mundwinkel zuckten. »Nur darf ich dir dann trotzdem nichts erzählen, denn heute Abend bin ich deine Lebensgefährtin«, flüsterte sie. »Nur falls du es vergessen hast, du trennst Dienst und Privatleben ausgesprochen streng.«
Jetzt schmunzelte er. »Mach, dass du auf die Insel kommst. Vielleicht lasse ich dich heute Abend Überstunden bei mir zu Hause machen. Oder ich genehmige dir mal eine Ausnahme von meinen strengen Prinzipien.«
»Warum kommst du nicht mit?«, schlug Conny vor. »Da finden heute auch ein paar Lesungen statt. Dann kannst du dich vor Ort informieren und kommst doch noch in den Genuss des Festivals.«
»Geht leider nicht.« Er seufzte und deutete auf die Akten auf seinem Schreibtisch. »Ich werde selber lesen müssen.«
»In Ordnung.« Ein kurzer Blick zur Tür. Sie konnte es riskieren. Conny stützte sich auf seinen Schreibtisch, lehnte sich weit vor und gab ihm einen schnellen Kuss. »Bis nachher.« Als sie schon an der Tür war, fiel ihr etwas ein. »Übrigens – könntest du bitte mit Brix sprechen? Dass er für einen Klönschnack nichts übrig hat, ist ja in Ordnung, aber er sollte wenigstens alle Informationen weitergeben, die er bekommt. Er ist immer als Erster am Telefon und verhält sich dann, als hätte er ein Schweigegelübde abgelegt. Egal, mit wem er gesprochen hat, wenn man es denn so nennen will, man muss denjenigen jedes Mal selbst anrufen, um alles zu erfahren, was Brix längst weiß.« Sie seufzte.
»Ich kümmere mich darum.«
»Danke. Ach, noch etwas. Du musst Matthias Wennemann unbedingt beschäftigen. Der steht drüben wie Piksieben. Hansen, Fedder und Brix lassen den eiskalt abblitzen.«
»Ich lasse mir etwas einfallen.«
»Danke.« Sie deutete einen Abschiedskuss an und ging. Conny war eine äußerst ehrgeizige Person, aber in diesem Moment versprach sie sich, niemals Kriminalhauptkommissarin zu werden. Lieber an der Front ermitteln, als hinter Aktenbergen zu verstauben.
Keine zwei Stunden später ging sie in Kloster an Land. Schon auf dem Festland hatte ein kräftiger Wind geblasen. Auf der Insel konnte man das Getöse beinahe einen Sturm nennen. Sie zog ihren Schal über das Kinn und die Mütze so weit über ihre Ohren, wie sie konnte. Michael Wolter, der die Dienststelle auf Hiddensee leitete, wartete bereits auf sie.
»Moin, Michael!« Sie schüttelte seine Hand.
»Moin, Conny! Hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen.«
»Nee! Zumindest nicht hier. Du wolltest mit Marlene doch eigentlich nach Stralsund rüberkommen, damit wir über den Weihnachtsmarkt bummeln können.«
»Wenn da man was draus wird. Jetzt, wo wir hier schon wieder eine Leiche haben …« Es war nicht viel los an dem kleinen Hafen. Kein Wunder, die Sommergäste waren zu Hause oder irgendwo im Süden, für die Gäste, die die Feiertage oder den Jahreswechsel hier verbringen wollten, war es noch zu früh. Conny war sehr froh, als sie in seinen Dienstwagen steigen durfte. Autos waren auf Hiddensee verboten, nur Elektrobusse, Einsatz- und Baufahrzeuge bildeten eine Ausnahme.





























