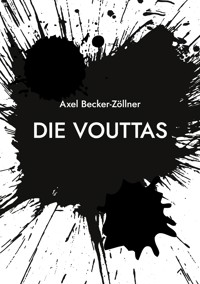
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer lange genug lebt, wird ein Flüchtling sein. Dieses Buch beschreibt die Flucht der Calvinisten aus Frankreich. Sie flohen, weil sie ihre Religion nicht ausüben konnten. Für manche schwer zu verstehen. Dies ist der Versuch sichtbar zu machen, was einzelne erlebt haben können. Die Hugenottenfamilie Voutta lebte dereinst in Frankreich und floh in mehreren Etappen nach Ostpreußen. Roman
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Das Edikt von Nantes
Aufbruch
Vorbereitungen
Frühjahr 1686
Im Kloster
Der Tod des Färbers
Lisette
Genf
Genf ist keine Heimat
Louis
Sturm
Simone
Hochzeit
Schicksale
Die Ankunft in Salzburg
Elisabeth
Johann
Dunkle Wolken
Gumbinnen
Gottes Dilemma
Als sie die Männer fragten, was sie an den Frauen fürchten: dass sie uns auslachen. Als sie die Frauen fragten, was sie an den Männern fürchten: dass sie uns töten.
* 5. September 1638 in Schloss Saint-Germain-en-Laye
† 1. September 1715 in Schloss Versailles
Ludwig XIV. ist uns allen als der Sonnenkönig und ein Vertreter des Gottesgnadentums bekannt.
Er gilt als der Erfinder des zentralisierten Staatswesens und hat aus seinem Leben ein öffentliches Spektakel gemacht. Gegen Eintritt konnte man ihn beim Frühstücken sehen.
Er war ein kluger Machtpolitiker und verstand es, die katholische Kirche als Instrument zu nutzen, an der Macht zu bleiben und sie sogar zu festigen.
Schätzungen gehen davon aus, dass sich bis zu 30 % der Franzosen von der römisch-katholischen Kirche abgewandt hatten. Der Übertritt eines bedeutenden Teils des Hochadels zu den Reformierten ließ rasch die konfessionelle Auseinandersetzung in eine machtpolitische umschlagen, die den Zusammenhalt des französischen Staates gefährdete.
Im Jahr 1685 machte der König der katholischen Kirche ein Angebot, indem er alle Andersgläubigen, deren religiöse Riten verbot.
Trotz wiederholten Verbots kam es zur größten Massenauswanderung im Europa der Frühen Neuzeit. Insbesondere die Reformierten, vorzugsweise Calvinisten vertrieb er. Sechs hunderttausend sollen es gewesen sein. Auch wenn er es verstand, den Staat zusammenzuhalten, war er ein verschwenderischer Diktator, ein Narzisst. L‘ État c’est moi – der Staat bin ich.
VORWORT
Der Mensch nimmt die Gegenwart typischerweise als einen kurzen Augenblick von etwa drei Sekunden wahr. Danach wird sie zur Vergangenheit, verschwindet unwiederbringlich und lässt sich höchstens bruchstückhaft rekonstruieren. Wenn mehrere Personen die Gegenwart teilen, ist es selten möglich, ein einheitliches Bild ihrer Erfahrungen zu schaffen. Was bleibt, sind nur Fragmente dessen, was tatsächlich geschehen ist. Wenn Historiker diese Fragmente dokumentieren, sprechen sie von "Quellen". Diese Quellen sollen ein solides Gesamtbild liefern, was Fachleute als "gesicherte Erkenntnisse" bezeichnen.
Geschichte ist somit immer eine Konstruktion des Menschen, der sich erinnert, erzählt oder schreibt. Diese Konstruktion bleibt unvollständig, weil sie nur auf den unvollständigen Überresten der Vergangenheit und den individuellen Wahrnehmungen der Zeitzeugen basiert.
Zusätzlich wird die Geschichte immer durch die Linse des Erzählers in seiner Sprache und durchmischt mit seinen eigenen Gefühlen und aktuellen Emotionen überliefert. Damit die Texte auch für die Leser der heutigen Zeit verständlich und ansprechend sind, muss der Autor die Vergangenheit in einer Art kontrolliertem Anachronismus aufarbeiten. Er muss es schaffen, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen oder den aktuellen Leser in die Vergangenheit zu versetzen, um ein Verständnis des Geschehenen zu ermöglichen.
Vergangenheit hat also nicht nur einen bewahrenden, musealen Wert, sondern auch einen erklärenden und beschreibenden. Der Historiker erzählt eine Geschichte. Man sagt oft, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Doch wo es Sieger gibt, gibt es auch Besiegte, und genau diese Perspektive aufzudecken, die Geschichte der Sieger zu analysieren, könnte eine lohnende Aufgabe für diejenigen sein, die sich für Geschichte interessieren. Andererseits müssen Historiker sich stets an den vorhandenen Quellen messen. Auch wenn es niemals eine endgültige und immer gültige Version der Geschichte geben kann, weisen die Ergebnisse historischer Forschung doch eine hohe Ähnlichkeit zur Wahrheit auf. In Romanen und Erzählungen schätzen wir manchmal gerade die Abweichungen davon.
Es ist faszinierend zu sehen, wie unsere Erinnerungen die Vergangenheit formen und wie jeder von uns seine eigene, einzigartige Sichtweise mitbringt. Der Weg, den Historiker gehen, ist zwar von Unvollkommenheiten geprägt, aber er ist ebenso voller Entdeckungen und Einsichten, die uns helfen, die Welt ein wenig besser zu verstehen. Geschichtsschreibung ist eine lebendige, atmende Kunst der Interpretation – voller Überraschungen, voller Menschlichkeit.
DAS EDIKT VON NANTES
Heinrich IV. hatte den Untertanen seines Reiches im Jahr 1598 Glaubensfreiheit gewährt. Er hatte sie gewährt, jedoch keinesfalls ein für alle Male geregelt. Was ein König gewährt, kann er ebenso wegnehmen. So geschah es dann im Jahr 1685. Sein direkter Nachfolger Ludwig der Gerechte begann damit. Frankreich beteiligte sich dreißig Jahre lang am Glaubenskrieg. Im Anschluss daran sorgte Ludwig der Sonnenkönig für deren Abschaffung. Wenn es auch befremdlich klingt, dass man den Bewohnern eines Landes vorschreiben kann, woran sie zu glauben haben, so geschieht es dennoch. Besonders betroffen waren die Hugenotten, Menschen calvinistischen Glaubens.
Nach Luther konnte der sündige Mensch auf eine Vergebung seiner Sünden hoffen, wenn er an Gott, seine verzeihende Gnade und die in der Bibel niedergelegten göttlichen Lehren glaubte, um danach sein Leben auszurichten. Nach Calvin konnte es keine Sündenvergebung geben, sondern es war schon vor der Geburt eines Menschen, eigentlich beim Anbeginn der Zeiten festgelegt, ob er in den Himmel oder die Hölle kam. An äußeren Zeichen konnte man bereits erkennen, ob jemand Erfolg oder Misserfolg im Leben hatte. Erfolg bedeutete den Himmel, Misserfolg die Hölle, wie im diesseitigen, so auch im jenseitigen Leben. Ein erfolgreiches Leben zeigte sich durch Reichtum, Kindersegen und einen unbeschwerten Umgang.
Aber diese Unterscheidung der Ausrichtung war dem König im Grunde vollkommen gleichgültig. Er musste es nur klug formulieren und sein Volk auf neue Zeiten einstellen.
In der Sicht von Ludwig XIV. war es aus einem anderen Grunde viel bedeutsamer, eine Richtungsänderung vorzunehmen.
Frankreich war noch ein fragiler Staat. Vor einiger Zeit bestand unter den Franzosen Einigkeit, dass sich das Land in zwei Glaubensrichtungen aufteilen ließe. Die eine Hälfte sollte vorherrschend durch die Katholiken bestimmt werden, die andere Hälfte durch die Reformierten und diese wiederum waren überwiegend Calvinisten. Paul Marazzis verhandelte schon einhundert Jahre vorher in des Königs Auftrag, welche Städte in welchem Auftrag regiert werden sollten.
Aber Ludwig wollte, dass mit der Zweiteilung Schluss sei, und Frankreich ein Gottesstaat mit einer einigenden Religion wird. Daneben sollte auch eine Teilung in zwei Sprachen, der Langue d’oc im Süden und der Langue d’oïl beseitigt werden. Das Volk sollte nur noch Französisch sprechen. Für den einfachen Bauern war eben diese eine Kunstsprache, die nur in Paris gesprochen wurde und die in der Tat um viele Worte erweitert werden musste, damit sie als Verkehrssprache tauglich war. Dekrete, die vom König verfasst, dann in die Lande geschickt wurden, waren bisher in Kirchenlatein verfasst, damit sie am Ziel umgesetzt werden konnten.
Mit eiserner Faust griff er nun durch.
Mit dem Edikt von Nantes hatte 1598 sein Großvater, König Heinrich IV., den französischen Protestanten Religionsfreiheit zugesichert und die mehr als dreißigjährigen Hugenottenkriege nach der Bartholomäusnacht beendet.
Jetzt sollte es also den Katholizismus als Staatsreligion geben.
Er verbot den evangelischen Gottesdienst, zwang die Pastoren dazu zu konvertieren und wies diejenigen aus dem Land, die seinen Weisungen nicht binnen vierzehn Tagen Folge leisteten. Am 18. Oktober 1685 trat das neue Gesetz in Kraft und etwa sechshunderttausend Reformierte, seit einigen Generationen Nachfolger Calvins, packten ihr Hab und Gut zusammen und verließen das Land in langen Trecks. Die meisten zu Fuß, etliche mit Pferd und Wagen. Alte, Junge, Kinder, Großmütter und - väter zogen in eine ungewisse Zukunft; größtenteils ließen sie ihr Hab und Gut zurück, als es so weit war.
Den Protestanten wurde zugestanden, in Frankreich zu bleiben, wenn sie darauf verzichteten, sich zu versammeln, um ihre Religion auszuüben. Allerdings verloren sie ihre bürgerlichen Rechte, konnten etwa keine Ehen mehr eingehen und kein Eigentum erwerben. Wer mochte da noch bleiben?
AUFBRUCH
An einem schönen Herbsttag des Jahres 1685 kam Johann mit seinem Freund Henrie von einem erfrischenden Bad aus dem Flüsschen Jabron auf der kleinen staubigen Dorfstraße gemächlich entlang getrottet. Eine beachtliche Hitze flimmerte auch zu dieser Jahreszeit noch über dem Ort Le Poët-Laval. Im Sommer war es immer drückend heiß, jetzt war es schon etwas angenehmer. Die Eltern gestatteten Johann deswegen auch problemlos einen kurzen Aufenthalt am Fluss. Immer war auch sein Freund Henrie dabei. Beide waren fünfzehn Jahre alt und hatten mit dem 11. Juli am gleichen Tag Geburtstag.
Johann war ein großer Kerl mit langen Gliedmaßen, welche ungelenk um ihn herumschweiften, wie die dünnen Äste einer Trauerweide im Sturm. Er hatte dunkelbraune Haare, die leicht gelockt seine Stirn umspielten. Der Jahreszeit angemessen trug er eine Kniebundhose aus Leinen und ein hellbeiges Leinenhemd mit Puffärmeln. An der Vorderseite wurde es im oberen Bereich durch eine, mehrfach durch den Stoff gezogene, dunkle Kordel zusammengezogen.
Ebenso gekleidet war sein Freund Henrie, jedoch von kräftiger Statur, hatte blonde Haare und überragte die meisten seiner Altersgenossen.
Natürlich waren sie barfuß, Schuhe und eigen gewebten Strümpfe trugen sie nur zum sonntäglichen Gottesdienst. Seit der König Ludwig XIV. vor einigen Wochen die Glaubensfreiheit abgeschafft hatte, war ein Gottesdienst eigentlich verboten und konnte nur heimlich abgehalten werden. So trafen Sie sich wechselnd in den Wohnstuben oder bei größeren Veranstaltungen, wie etwa einem Trauungsgottesdienst im Steinbruch oder auf freiem Feld.
Die beiden Freunde und natürlich auch ihre Eltern waren im katholischen Frankreich zunächst Protestanten, dann calvinistischen Glaubens.
Wer bei der Ausübung der kirchlichen Zeremonien erwischt wurde, musste mit drakonischen Strafen rechnen. Besonders gerne waren die Protestanten in einigen Gegenden schon lange nicht gesehen. Bis zu einem gewissen Grad hatten sich alle daran gewöhnt, aber jetzt wurde es gefährlich.
Sie wurden Hugenotten genannt und mehr oder minder aktiv verfolgt, sodass von den Eltern davon gesprochen wurde, das Land zu verlassen; weil sie mussten. Aus freien Stücken würde niemand weggehen wollen.
Aber wohin sollten Sie gehen?
Von Genf war die Rede. Das war nicht so weit, aber ein ungewisser Neuanfang allemal.
Das Dorf zog sich entlang des Flusses eine beachtliche Strecke dahin. Umgeben war es von weitläufigen Olivenhainen, in denen bald die Ernte beginnen sollte. Die Häuser waren aus den Steinen gefertigt, die in der näheren Umgebung zu finden waren. Diese sind zum größten Teil unbehauen. Johann fragte sich hin und wieder, wie es den Baumeistern gelungen war aus nicht kantigen Steinen unterschiedlicher Größe ein solides Haus mit Türen und Fenstern zu bauen. Alle Häuser im Ort waren mit roten Dachschindeln gedeckt. Sie lagen nicht direkt an der Straße, sondern von ihr ein Stück zurück, man hatte daher keinen beengten, eher einen großzügigen Eindruck.
Es gab am unteren sowie am oberen Ende des Dorfes je eine Wasserpumpe, an denen sich die Dorfbewohner frisches Trinkwasser in Holzeimer füllten. Die eine Stelle mit einer Pumpe wurde etwas übertrieben „Marktplatz“, die andere angemessener „Dorfplatz“ genannt.
„Lass uns zur Pumpe gehen, ein Schluck frischen Wassers bei der Hitze kann nicht schaden“, sagte Johann und wischte sich mit der Außenseite des Zeigefingers den Schweiß von der Stirn. Als sie auf den Dorfplatz kamen, waren die beiden Töchter des Bürgermeisters, Lisette und Fabienne gerade dabei, zwei Holzeimer mit dem frischen, klaren Wasser zu füllen. Lisette hielt den Eimer, Fabienne pumpte aus Leibeskräften.
Der Bürgermeister Isaac Lacroix führte mit seiner Frau Jasmine die Bäckerei im Ort. Auf dem Hof roch es immer gut nach frisch gebackenem Brot. Im Augenblick war der Meister unterwegs, um mit seinem Esel Nachschub an Holz für den großen Backofen zu besorgen.
Lisette war dem Handschuhmacher Abraham Lamien versprochen. Sie war neunzehn Jahre alt, Fabienne war fünfzehn, wie die beiden Freunde.
Henrie begann zu laufen, um die beiden Schwestern noch ansprechen zu können. Fabienne mochte er besonders. Seinem Freund hatte er seine Liebe zu ihr schon bekundet.
„Los“, rief er zu Johann.
Schnell waren die zwei bei der Pumpe.
„Komm, ich helfe dir“, sagte Henrie und übernahm den Pumpenschwengel.
Ende des Sommers war es schwieriger, das Wasser hochzupumpen. Der Grundwasserstand sank im Laufe des Jahresrhythmus und stieg erst im Winter wieder an.
Fabienne sah ihn dankbar an
„Danke, das ist nett von dir“.
„Johann, du hast im Gottesdienst am letzten Sonntag mit deiner schönen Stimme wunderbar mitgesungen“, meinte Lisette und wechselte den Eimer unter dem Pumpenauslauf.
„Vielen Dank“, ich singe gerne unsere Lieder.
Es gab in der Gemeinde einige Ausgaben des Psalter als Gesangbuch im kleinen Druck für Hugenotten. Gedruckt in Genf, da in Frankreich der Bibeldruck strikt verboten war.
Der in Reimen gefasste Psalter wurde von Clément Marot und Théodore de Bèze verfasst. Dieser diente seit 1562 als Gesangbuch. Nur der Psalter als gesungenes Gotteswort war im Gottesdienst zugelassen, da die Hugenotten sonstige Kirchenlieder ablehnten. Es wurde immer der ganze Psalter gesungen, nichts durfte verändert oder weggelassen werden. Johann kannte einige auswendig. Am schönsten fand er es, wenn sie von der Laute begleitet wurden. Die Schwestern spielten sie beide. Oftmals auch zweistimmig. Wegen des verführerischen Klangs war das jedoch von Pastor Glanz nicht gerne gesehen.
„Ich trage euch die Eimer heim“, bot Henrie Lisette und Fabien an.
„Das ist nett von dir, aber nicht nötig“.
„Wir tragen sie gemeinsam“, bot Johann an. Und so trugen Lisette und Johann, Fabienne und Henrie jeweils einen Eimer am Henkel zu zweit.
Es war nicht weit zum Haus des Bürgermeisters.
Es steht am Rande des Ortes, in der Mulde des Tales, entlang des Flusses, und hat eine herrliche Aussicht auf die bewaldeten Berge.
Henrie begann einen leichten Trab und zog Fabienne scherzhaft mit sich, sodass sie auch in einen leichten Laufschritt verfiel. Dabei begann das Wasser überzuschwappen und benetzte die Füße und den Saum des Kleides.
„Nicht so schnell, es läuft ja alles über“, rief Fabienne munter, aber Henrie provozierte sie noch mehr und so kicherte und lachte sie ausgelassen, als sie vor dem Haus des Bürgermeisters ankamen. Der Eimer war inzwischen nur noch zur Hälfte gefüllt, als beide ihn auf der untersten Treppenstufe des Hauseinganges unsanft abstellten. Sie setzten sich auf die Bank neben der Tür, als Lisette mit Johann um die Ecke bogen, den Eimer behutsam tragend.
Lisette sah Fabienne vorwurfsvoll an, als sie sah, dass der Eimer gehörig Wasser verloren hatte.
Fabienne bemerkte den Blick und rief trotzig:
„Nun gut, dann besorgen wir eben einen neuen vollen Eimer“. Sagte es, ergriff den Eimer, schüttete das Wasser in den kleinen Gänsetrog, reichte Henrie ihre Hand und beide liefen los zur Pumpe, noch ehe Lisette sie warnen konnte, dass die Mutter dieses Benehmen sicherlich ganz und gar unschicklich finden würde.
„Lass sie doch, ich glaube, Henrie mag deine Schwester.
Vielleicht werden sie noch vor dir heiraten“, scherzte Johann und Lisette errötete.
Es war als Scherz gemeint, jedoch konnte er nicht ahnen, dass Lisette noch gar nicht mit sich und Abraham im Reinen war, ob und wann sie ihn heiraten will.
Gewiss, Abraham kommt aus einer guten Familie, ist nett, gebildet, hat einen einträglichen Beruf als Handschuhmacher und er sieht gut aus. Reicht das? Das dachte sie sich in manchen Nächten, wenn sie noch nicht einschlafen konnte.
‚Und die Ehe, was kommt da auf mich zu?‘ fragte sie sich immer öfter. Ein wenig Angst hatte sie schon. Gewiss, es war in ihrer Glaubensgemeinschaft vieles geregelt, was sich in der Zweisamkeit so abspielen sollte. Jedoch wurde offen nicht darüber gesprochen und so blieb ihr vieles unklar und geheimnisumwittert.
Deutlicher wurde Pastor Glanz allemal, wenn es um ein Unterordnen oder Gehorsamkeit geht.
„Der Mann soll so herrschen, dass er das Haupt der Frau, nicht aber ihr Tyrann ist; die Frau soll sich dagegen bescheiden und gehorsam unterordnen.“ Ja, das war so, das wusste sie auch, aber wollte sie das ebenfalls, musste das wirklich für immer so sein?
Auch mit ihren Eltern hatte sie darum einen Streit. Natürlich war ihre Mutter diejenige, die sich unterordnete. Das musste sie so vertreten, wollte sie nicht ihr eigenes Leben infrage stellen. Und natürlich war auch ihr Vater der Meinung, dass eben solches Gottes Wille ist. Es gehe ihm keineswegs um Macht und Beherrschen, sondern es sei eben eine Aufgabe, die jedem Manne von Gott gegeben sei.
Die Gespräche drehten sich immer im Kreis. Letztlich war es Gottes Wille.
Johann wusste von derlei Gedankenqualen von Lisette nichts.
Schließlich erschienen Henrie und Fabienne wieder; diesmal mit einem gut gefüllten Eimer. Lachend und fröhlich und irgendwie bemerkte Lisette einen Stich in ihrem Herzen.
„Ich werde nun nach Hause gehen“, verabschiedete sich Johann und forderte damit, gleichzeitig von Henrie ihn zu begleiten. Dieser dachte nicht weiter nach, winkte fröhlich mit beiden Händen hoch über dem Kopf, wobei er gleichzeitig ein wenig in die Luft sprang. Dann drehte er sich flugs um und folgte Johann.
„Warte, ich komme“, und schon waren beide um die Torecke verschwunden.
„Du magst Fabienne?“, fragte Johann.
„Ich werde sie heiraten“, antwortete Henrie, als wäre alles bereits abgemacht.
Johann prustete los.
„Das geht nicht, du bist noch lange keine fünfundzwanzig Jahre alt. Außerdem dürfen wir Hugenotten hier in Frankreich nicht mehr heiraten“
„Du hast recht, heiraten dürfen wir hier nicht“.
Johann blieb abrupt stehen.
„Willst du dich versündigen?“, rief er aufs höchste empört.
Ohne dass Henrie genau wusste, was sein Freund damit meinte, oder an was er gerade dachte oder sich gar vorstellte, antwortete er:
„Natürlich nicht, ich werde mit ihr nach Genf gehen und dann in der Schweiz ein neues Leben anfangen. Es ist immerhin die langjährige Heimat von Johannes Calvin. Viele Hugenotten leben dort. Sie bilden die größte Glaubensgemeinschaft in der Stadt. Wir müssen uns dort nicht verstecken. Hier in Le Poët-Laval sind wir zwar auch unter uns, jedoch müssen wir uns nun dauernd vor dem König verbergen. Wir riskieren Festungshaft oder die Galeere.“
„Wissen deine Eltern davon?“
„Sie denken so wie ich. Früher oder später werden wir gehen.“ Johann wusste, dass nach der Aufhebung der Glaubensfreiheit viele Familien ins Ausland flüchten würden.
Ludwig stellte sie vor keine echte Wahl: Entweder zum Katholizismus wechseln, also rekatholisiert werden oder rechtlos im Land bleiben. Ohne die Ausübung der Rituale, die zum Glauben gehörten, und dass sie obendrein bei Strafe verboten waren fanden er selbst und viele andere, die er kannte, unerträglich. Oder auswandern, ein halbes Jahr etwa ließ der König ihnen Zeit. Nur wohin sollte man gehen? Das Los der Minderheit in der Fremde wollten sie nicht riskieren. Wenngleich sie innerhalb ihrer Gemeinschaft immer den nötigen Rückhalt finden würden, könnten sie doch von außen angegriffen werden. In diesem Zusammenhang dachte Johann immer an die Juden, die allzu oft als Minderheit drangsaliert wurden. Pastor Glanz hatte sie häufig in seinen Predigten erwähnt. Weil die Juden das Heil in Jesus Christus zurückgewiesen haben, seien sie mit Blindheit und Verderben geschlagen. So könnten sie aus der Perspektive des Christusbekenntnisses nur als Abtrünnige wahrgenommen werden. Nur wenige Anhänger der Reformation nahmen eine konsequent judenfreundliche Haltung ein. Öfter sprach man von den Juden als von Aufschneidern, Lügnern und Verfälschern der Schrift und nannte sie habgierig.
Auch die beiden Freunde waren in ihren alltäglichen Verrichtungen ständig mit der Auseinandersetzung ihres kirchlichen Glaubens beschäftigt. Sie lebten nach strengen moralischen Grundsätzen, teilten ihren Tagesablauf genau ein, schliefen möglichst nicht länger als sechs Stunden, arbeiteten unermüdlich und rationalisierten Arbeitsprozesse. Sie schafften Wohlstand. Aber nicht, um besser leben zu können, sondern als Selbstzweck, als Voraussetzung für weitere Arbeit. Ebenso große Bedeutung wie die Arbeitsamkeit hatte in ihrer Gedankenwelt die Askese. Sie fordert, auf den Genuss des erarbeiteten Wohlstands zu verzichten. Sparsamkeit und Genügsamkeit statt Wohlleben und Vergnügen. Wenn sie sich auch manches Mal vergnüglich trafen, hatte das auch meistens einen ernsteren Zweck. All dies ruhte nun und war in näherer Zukunft nicht mehr möglich. Daher rührte in jedem der Gedanke an Flucht.
Es gab keine Kirche mehr in Le Poët-Laval, der Schulbesuch war nicht möglich. Die Kinder wurden zum Teil im kleinen Rathaus oder bei den Familien zu Hause unterrichtet. Keine Taufe, keine Hochzeit, sogar Totengedenken sollte es nicht mehr geben. In allen Bereichen waren sie als Hugenotten eigentlich rechtlos. Selbst auswandern war schwierig und man erzählte sich, dass es demnächst verboten werden würde. Dann bliebe nur noch die Flucht.
Am Haus von Johanns Familie trennten sich die Freunde.
„Am Sonntag findet der Gottesdienst bei uns statt“, sagte Johann.
„Dann sehen wir uns“.
Er trabte los und lief den kurzen Weg zu seinem Elternhaus.
Er wollte seinen Eltern bis zum Abendessen noch bei der täglichen Arbeit behilflich sein. Sein Vater Pasqual Voutta war Schuhmacher und Strumpfwirker und brachte den ganzen Tag damit zu, Strümpfe an einem großen, eigens dafür konstruierten Webstuhl zu weben.
Damit ließ sich gutes Geld verdienen. Strümpfe waren teuer und nur Reiche konnten sich so etwas leisten. Die einfachen Leute gingen barfüßig, hatten Holzpantinen oder trugen in Lederstiefeln Fußlappen. Das waren einfache, quadratische Leinentücher, die um die Füße gewickelt wurden. Dafür stellte man den Fuß in die Mitte des Tuches, klappte die vordere Spitze über den Rist, fixierte sie, indem man die beiden anderen Spitzen darüber schlug, hielt nun die hintere Spitze fest und schlüpfte in den Schuh.
Strümpfe waren dagegen ein modisches Kleidungsstück. Ludwig XIV. hatte eine eigene Mode kreiert. Sie war aufwendig, die Kleidung bestand aus vielen Teilen und am Hofe waren alle in diesem Stiele gekleidet. Die Garderobe war teuer und ein kleiner Marquis oder Comte musste empfindlich tief in seine Tasche greifen.





























