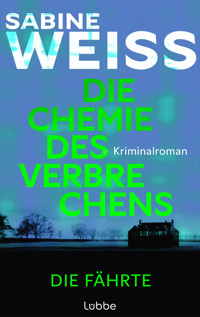Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben der legendären Madame Tussaud als einzigartig lebendiger Roman: »Die Wachsmalerin« von Sabine Weiß jetzt als eBook bei dotbooks. Paris im Sommer 1794: Marie hat ihren Glauben an die Revolution verloren. Vor wenigen Jahren noch hat sie mit ihren Kameraden auf den Ruinen der Bastille getanzt, nun sitzt sie selbst auf der Anklagebank. In ihren letzten Momenten schaut Marie auf ihr bewegtes Leben zurück und versucht zu verstehen, wie es dazu kommen konnte – angefangen bei ihrer schweren Kindheit als Enkelin eines Scharfrichters, über die hoffnungsvollen Lehrjahre als Wachsbildnerin bis hin zum Aufbau des erfolgreichsten Wachsfigurenkabinetts der Welt. Selbst am französischen Hof in Versaille ging sie ein und aus, ein Privileg, das sie nun in höchste Gefahr bringt … Nur wenig ist über das Leben der Marie Grosholtz bekannt. Auf Basis ihrer jahrelangen Recherchen legt Sabine Weiß dennoch einen fundierten und lebendigen Roman vor, der die Pariser Jahre der berühmtem Madame Tussaud nachzeichnet. »So spannend, lebensprall und atmosphärisch, dass es eine Lust ist, ins Paris des 18. Jahrhunderts einzutauchen.« TV-Spielfilm Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Wachsmalerin« von Sabine Weiß. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Paris im Sommer 1794: Marie hat ihren Glauben an die Revolution verloren. Vor wenigen Jahren noch hat sie mit ihren Kameraden auf den Ruinen der Bastille getanzt, nun sitzt sie selbst auf der Anklagebank. In ihren letzten Momenten schaut Marie auf ihr bewegtes Leben zurück und versucht zu verstehen, wie es dazu kommen konnte – angefangen bei ihrer schweren Kindheit als Enkelin eines Scharfrichters, über die hoffnungsvollen Lehrjahre als Wachsbildnerin bis hin zum Aufbau des erfolgreichsten Wachsfigurenkabinetts der Welt. Selbst am französischen Hof in Versaille ging sie ein und aus, ein Privileg, das sie nun in höchste Gefahr bringt …
Nur wenig ist über das Leben der Marie Grosholtz bekannt. Auf Basis ihrer jahrelangen Recherchen legt Sabine Weiß dennoch einen fundierten und lebendigen Roman vor, der die Pariser Jahre der berühmtem Madame Tussaud nachzeichnet.
»So spannend, lebensprall und atmosphärisch, dass es eine Lust ist, ins Paris des 18. Jahrhunderts einzutauchen.« TV-Spielfilm
Über die Autorin:
Sabine Weiß, geboren 1968, studierte Germanistik und Geschichte, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. Für ihre Romane »Die Wachsmalerin« und »Das Kabinett der Wachsmalerin« reiste sie monatelang auf den Spuren der Wachskünstlerin Marie Tussaud durch Frankreich, England, Irland und Schottland.
Bei dotbooks veröffentlichte Sabine Weiß bereits »Das Kabinett der Wachsmalerin«.
Die Autorin im Internet: www.sabineweiss.com
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/pages/Sabine-Weiss-Autorin/126749097370127
***
eBook-Neuausgabe April 2016
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Gemäldes von John James Chalon und shutterstock/FlexDreams
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-433-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Wachsmalerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sabine Weiß
Die Wachsmalerin
Das Leben der Madame Tussaud Historischer Roman
Prolog
Paris, im Erntemonat Messidor 1794
Die Männer, die sie in den Tod führen sollten, kamen mit einem Lächeln. Marie und ihre Mutter Anna waren gerade dabei, feuchte Tücher über die Wachsfiguren zu legen, um sie vor der Sommerglut zu schützen, als es am Eingang laut klopfte. »Öffnet die Tür!«, forderte eine tiefe Männerstimme. Marie zuckte zusammen, ihre Mutter bekreuzigte sich und warf Marie einen entschuldigenden Blick zu. Es war gefährlich, zu seinem christlichen Glauben zu stehen.
Obwohl die Sonne gerade erst die Höhe der Dächer erreicht hatte, begann sich die Hitze im Wachsfigurenkabinett bereits zu stauen. Angst zeichnete sich auf dem Gesicht ihrer Mutter ab. Ein gewöhnlicher Besucher konnte es so früh am Morgen nicht sein. Anna war dünnhäutig geworden. Die letzten Jahre hatten ihr zugesetzt. Die Angst um Curtius, der in diesen gefährlichen Tagen im Auftrag von Robespierre im Rheinland unterwegs war, machte ihr zu schaffen. Und Anna sorgte sich um Marie. Ihre Nähe zum französischen Hof hatte sie genauso in Gefahr gebracht wie die geheimen Aufträge im Namen des Konvents. Dabei hatte Marie kaum über diese Aufträge gesprochen – je weniger ihre Mutter davon wusste, desto besser. Anna hatte nur zu gerne weggesehen, wenn ihre Tochter wieder einmal die Tasche mit ihrem Werkzeug packte. Doch so ganz konnte sie ihre Augen nicht vor dem verschließen, was in ihrem Haus vor sich ging. Der Hunger, die viele Arbeit und die Angst waren allgegenwärtig. Die Nahrungsmittel waren teuer, und die neuen Banknoten, die verhassten Assignaten, so wenig wert, dass Marie damit schon einmal ein Loch in der Wand gestopft hatte. Anna musste manchmal stundenlang für einen Laib Brot anstehen oder versuchen, Kleidung und Schmuck gegen Lebensmittel einzutauschen.
Ihre Mutter wirkte blass, die Haare hingen strähnig unter ihrer Haube hervor. Heute sah man Anna ihre fünfzig Jahre wahrlich an. Auch Marie hatte schon bessere Tage gesehen, das wusste sie, obwohl sie nur selten einen Blick in den Spiegel warf. Wäre ich eine meiner Wachsfiguren, ich würde mich restaurieren oder einschmelzen, dachte sie und musste lächeln. Es kostete sie viel Kraft, den Anschein der Gleichmütigkeit aufrechtzuerhalten. Man sagte ihr nach, sie sei kaltblütig, dabei hatte sie lediglich lernen müssen, ihre Gefühle zu kontrollieren, sich keine Blöße zu geben, um sich und ihre Familie nicht in Gefahr zu bringen.
Heute galt es mehr denn je, sich unauffällig zu verhalten. Das Revolutionstribunal diente allein einem Zweck: die Feinde des Volkes zu bestrafen. Für alle Delikte gab es nur noch eine einzige Strafe: den Tod. Das Rasiermesser der Nation, die heilige Guillotine, wie das Volk sie nannte, arbeitete im Akkord. Zu Hunderten waren die Köpfe in den letzten Wochen vom Richtblock gerollt. Die täglichen Hinrichtungen verwandelten Paris in ein Leichenhaus. Das Blut lief von den Plätzen nicht mehr ab, die Hunde mussten verscheucht werden, damit sie es nicht aufleckten. In der Nähe der Friedhöfe lag ein süßlicher Verwesungsgeruch in der Luft. Die Massengräber waren überfüllt und mancherorts ragten die Gebeine der Toten hervor, weil sie nur notdürftig verscharrt worden waren. Dennoch wehrten sich die Bürger nicht – das Blutbad schien sie abgestumpft zu haben. Einige versuchten sogar noch immer, ihren Gewinn aus dem Terror zu ziehen. Denunziationen waren an der Tagesordnung. Der Vorwurf, ein Feind der Republik zu sein, reichte aus, um eine Verhaftung zu erwirken. Beweise waren nicht mehr nötig. Schnell war ein missliebiger Nachbar, ein geschäftlicher Konkurrent oder ein ungeliebter Ehemann aus dem Weg geschafft. Der Nächste war zum Feind geworden.
Marie trat ans Fenster. Der Boulevard du Temple, bis vor kurzem eines der Vergnügungsviertel der Handwerker und der reichen Müßiggänger, der Halbseidenen und der Adeligen, war wie ausgestorben. Früher schien die Allee ein einziger großer Jahrmarkt zu sein. Im Schatten der Bäume konnte man schlendern, Leute beobachten, Musik hören, sich in einem Café zu einer Partie Billard oder zum Kartenspiel treffen, beim Schach oder Domino zusehen oder auf die abendlichen Feuerwerke warten. An Ständen gab es kalten Braten zu kaufen, geröstete Walnüsse oder Lakritzwasser. Jongleure und Akrobaten waren zu bestaunen, Tiere in Käfigen, gezähmte Bären.
Auch Marie und ihre Familie hatten von der Beliebtheit des Boulevards profitiert. Curtius' Wachsfigurenkabinett zog ebenso viele Besucher an wie der Zirkus ihres Nachbarn Philip Astley, der noch vor einiger Zeit damit geworben hatte, dass er am königlichen Hofe aufgetreten war. Das zählte heute nichts mehr, ja, so eine Werbung wäre inzwischen sogar gefährlich.
Marie schloss den Eingang auf. Die Sonne schien auf den feucht gewischten Fußboden, der Straßenstaub senkte sich in die flachen Pfützen. Vor der Tür des Kabinetts standen zwei Nachbarn, Jean, der Perückenmacher, und Marcel, der Tischler. Beide lächelten sie schief an. Marie atmete auf. Von diesen Bekannten drohte ihnen sicher keine Gefahr. »Kommt herein, Bürger, möchtet ihr einen Schluck Wasser?«, begrüßte Marie die beiden und strich sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. »Gibt es Nachrichten von meinem Onkel?« Jean, ein korpulenter Mann um die vierzig, zwängte seinen Finger in den engen Halsausschnitt, um sich Luft zu machen.
»Nein, leider nicht, Bürgerin Grosholtz. Ein Wasser, ja, das wäre –«, der Ellbogen seines Begleiters, der ihm in die Seite fuhr, machte seiner Rede ein abruptes Ende.
»Kein Wasser, kein langes Geplauder«, ließ sich der hagere Tischler vernehmen. »Machen wir es kurz. Wir sind hier, um euch beide unter Arrest zu nehmen«, sagte er.
»Arrest? Das muss ein Versehen sein ...«
»Das sagen sie alle«, fuhr Jean dazwischen und zupfte an den zu kurzen Ärmeln, als ob er sie so verlängern könnte. »Und dann ziehen sie doch hinter dem Rücken des Volkes die Fäden und machen gemeinsame Sache mit den Königstreuen!«
Marie schoss es heiß und kalt über den Rücken. Wer hatte sie angezeigt? Hatte die Hinrichtung der Schwester des Königs vor einigen Wochen in Erinnerung gebracht, dass sie Madame Élisabeth in der Kunst der Wachsarbeit unterrichtet hatte? Auch wenn es schon Jahre her war, heute wurden Menschen wegen geringerer Vergehen zum Tode verurteilt. Marie durfte sich ihre Angst nicht anmerken lassen. »Meine Mutter und ich sind treue Dienerinnen dieses Staates, patriotische Bürgerinnen. Ich war schon oft im Auftrag des Konvents unterwegs. Philippe Curtius gehört zu den ehrenvollen Bezwingern der Bastille und führt gerade einen Regierungsauftrag im Ausland aus. Es muss sich also um ein Versehen handeln.« Jean lachte höhnisch, Marcel blickte zu Boden und nestelte verlegen an den Knöpfen seiner Uniform.
»Nicht so hochnäsig, junge Frau. Was hier steht, ist nie ein Versehen«, sagte er und hielt ihr ein Papier vor die Nase. Es war ein Haftbefehl. »Packt eure Sachen«, forderte er sie auf.
»Wie lautet die Anklage?«, fragte Marie mit zusammengeschnürter Kehle.
»Das werdet ihr noch früh genug erfahren! Nun packt eure Sachen!«
In Marie verhärtete sich etwas. Das war also aus ihrem Volk geworden, aus einer Nation, an die sie einmal geglaubt hatte! Als sich vor fünf Jahren das Volk bewaffnete und mit der Erstürmung der Bastille in Frankreich ein neues Zeitalter anbrach, hatte Marie mit den ausgelassenen Menschen auf den Ruinen der königlichen Festung getanzt. Die Jahre, in denen die Menschen- und Bürgerrechte ausgerufen wurden, in denen es eine neue Verfassung gab, die allen Bürgern Freiheit und Gleichheit garantierte, versetzten auch sie in Begeisterung. Doch spätestens seit den Septembermassakern 1792 und der Ermordung des Königs Ludwig XVI. und der Königin Marie Antoinette ein Jahr später, war Marie klar, dass diese Revolution nicht mehr ihre Revolution war. Die Jakobinerdiktatur des letzten Jahres betrachtete sie schließlich nur noch mit Abscheu.
Anna starrte auf den Fußboden und bewegte lautlos die Lippen. Marie wusste, dass ihre Mutter jetzt ein Stoßgebet an ihren verbotenen Gott schickte. Hoffentlich bemerkten die Schergen es nicht. Marie ergriff die Hand ihrer Mutter. Dann fühlte sie einen Stoß in den Rücken.
»Wie oft soll ich es dir denn noch sagen, Bürgerin Grosholtz! Oder willst du nichts auf deinem letzten Weg mitnehmen?«
Ihr letzter Weg. Marie kam es vor, als zwinge sie die Last ihres Körpers zu Boden. Manchmal fühlte sie sich so alt. Dabei war sie erst zweiunddreißig Jahre alt. Wie viel war in dieser Zeit passiert! Und manches kam ihr vor, als sei es gerade erst geschehen. Sie spürte noch das Prickeln, das durch ihren Bauch getanzt war, als sie nach langer Lehrzeit endlich das erste Gesicht in Wachs festhalten durfte. Sie sah noch den erstaunten Gesichtsausdruck des Wachshändlers vor sich, der sie übers Ohr hauen wollte und dann der charmanten jungen Wachsbildnerin die Ware doch beinahe zum Einkaufspreis überließ. Und sie spürte noch immer die zarte Berührung von Louis' Fingern auf ihrer Wange. Sie zitterte. Diese Erinnerung lag tief begraben auf dem Grund ihres Herzens – und nun war sie wieder da. Der Schmerz tobte in ihr mit aller Macht. Diese Gefühle hatte sie für immer aus ihrem Herzen verbannen wollen. Damals hatte sie sich den Tod gewünscht. Und nun, da es so weit war, wollte sie um keinen Preis sterben! Marie wusste jedoch, dass jeder Protest zwecklos war. Es würde keine Verhandlung geben, und wenn man erst einmal im Gefängnis saß, führte der Weg nur noch auf das Schafott. Bevor Curtius von ihrem Arrest hören und Hilfe schicken könnte, würden ihre Köpfe schon rollen. Hatte sie für dieses schmachvolle Ende diesen langen Weg beschritten, der an einem finsteren Ort seinen Anfang genommen und sie dennoch bis an den Hof des Königs geführt hatte?
Kapitel 1
Straßburg, 1766
»Marie, bring deinem Großvater sein Mittagsmahl ins Rappele.« Ohne zu zögern zog sich das Mädchen warme Kleidung über und trat an die Seite seiner Großmutter. Marie war zart für ihre fünf Jahre, und sie biss die Zähne zusammen, als ihr die braunen Zöpfe schmerzhaft festgesteckt wurden. »Trödle nicht wieder!«, ermahnte die alte Dame sie. Marie nahm die schwere Stofftasche, der ein würziger Duft nach Fleisch, Gemüse und Kräutern entströmte. Sie spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Seit ihr gestern eines der Gläser heruntergefallen war, hatte sie nur Brotkanten zu essen bekommen.
Marie trat vor die Tür und sog die kühle Luft tief ein. Der Schnee hatte die Stadt eingehüllt. Dumpf und hohl klangen das Klappern der Pferdehufe und die Rufe der fliegenden Händler. Marie mochte das Gedränge auf den Straßen nicht, seit sie als Kleinkind einmal beinahe in einer Menschenmenge verloren gegangen war. Die großen Leiber hatten sie fast erdrückt, dann, als sie schon erschöpft auf den Boden gesunken war, hatte ihr Vater sie gefunden, hochgehoben und aus der Menge getragen. Die Erinnerung machte sie traurig. Kurz danach war er fortgegangen und nicht zurückgekehrt. Seitdem lebten sie bei den Großeltern, die Maries Mutter Anna die Schuld am Verschwinden ihres Sohnes gaben. Kreuz und quer ging Marie durch das Gassengewirr Straßburgs zum Fluss hinunter.
Schon bald schlug ihr aus dem Gerberviertel ein stechender Geruch entgegen. Sie machte sich nichts daraus, schließlich kannte sie den Gestank vom Hundshof in der Nähe ihres Hauses, wo unter einer alten Linde die Knechte ihres Großvaters tollwütige Tiere erschlugen. Ihr Großvater, Johann Jacob Grosholtz, war der Scharfrichter und Abdecker von Straßburg.
Die Ill schimmerte hellgrau am Wegesrand, bald würde Marie mit ihren Eiskufen Kreise auf dem Fluss ziehen können. Gegenüber den vier Stadttürmen an den gedeckten Holzbrücken konnte sie jetzt das Raschpelhüs erkennen, wie das neue Zuchthaus genannt wurde. Das dunkle Gemäuer erschien ihr unheimlich, es erinnerte sie an etwas, an das sie lieber nicht denken wollte. Ein Soldat öffnete die Tür. »Was für einen armen Sünder haben wir denn hier?«, brummte er. Marie zuckte eingeschüchtert zusammen. Dann hörte sie das vertraute tiefe Lachen ihres Großvaters.
»Sie sollen meine Enkelin doch nicht so erschrecken«, mahnte Johann Jacob Grosholtz freundlich und hob das zierliche Mädchen hoch. Sie legte den Arm um ihren Großvater, sein grauer Bart kitzelte ihre Wange. »Was hast du Schönes für mich, Mariechen?« Er nahm die Tasche und schnupperte daran. »Ah, Baeckeoffe«, strahlte er. »Leistest du mir Gesellschaft?« Marie schüttelte den Kopf. »Nein? Wie schade!« Er setzte sie auf den Boden. »Sag deiner Großmutter, dass ich nachher noch Besuch erwarte.« Er zwinkerte ihr zu. Marie zwinkerte zurück, sie wusste, was das hieß. Jemand suchte Rat, wollte, dass ihr Großvater einen eiternden Zahn zog, Kopfschmerzen vertrieb oder eine Schulter wieder einrenkte. Manchmal kamen die Hilfesuchenden nicht wegen seiner medizinischen Kenntnisse, sondern wegen der Heilmittel, die nur er kraft seines Amtes beschaffen konnte. Das Blut eines Hingerichteten sollte beispielsweise bei Fallsucht helfen, und wenn man mit dem Finger oder der Hand eines armen Sünders das Vieh striegelte, würde es wundersam fett. Wenn diese Besucher dann weg waren, schimpfte er auf den Aberglauben, dem anscheinend nicht beizukommen war. Wie seine Vorfahren hatte er an der Universität von Straßburg Medizin studiert. Doch statt eine eigene Praxis zu eröffnen, war er in die Fußstapfen seines Vaters getreten und Scharfrichter geworden. Von den Honoratioren der Stadt wurde es nicht gern gesehen, dass die, die das Leben nahmen, es auf der anderen Seite auch erhielten. Man sagte, der Scharfrichter habe mehr Leute vor der Tür als ein Medicus. Und das, wo es in dieser Stadt von Ärzten, Hebammen, Chirurgen, Wundärzten und Apothekern nur so wimmelte. Deshalb war es besser, in der Öffentlichkeit darüber zu schweigen, dass Johann Jacob Grosholtz als Medicus tätig war. Und wer seinen Rat suchte, der fand ihn auch, ohne dass groß darüber gesprochen wurde.
***
Auf dem Heimweg überlegte Marie, was hinter den dicken Mauern des Raschpelhüs wohl geschah. Ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass die Gefangenen dort die roten Wurzeln, mit denen das Tuch für die Soldatenhosen gefärbt wurde, zu feinem Staub mahlen mussten. Doch Marie wusste, dass das, was darin passierte, auch der Grund dafür war, warum sie kaum Besuch erhielten, warum sie bei Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen immer unter sich waren, warum sie in der Kirche ganz hinten sitzen mussten, warum jedes Glas, aus dem ihr Großvater im Gasthof getrunken hatte, zerbrochen wurde und warum sie keine Freunde fand. Die Menschen mieden den privaten Kontakt zum Clan der Grosholtz' um jeden Preis, ganz als fürchteten sie, durch den bloßen Kontakt beschmutzt zu werden. Ihre Großmutter geriet jedes Mal in Rage, wenn jemand die Straßenseite wechselte, um ihr aus dem Weg zu gehen, oder gar vor ihr ausspuckte. »Der hat wohl Dreck am Stecken und fürchtet selbst den Pranger!« oder »Auch diese Dirn wird irgendwann auf dem Richtplatz enden, glaub es mir!«, wetterte sie dann und vergaß nie zu betonen, dass ihr Vater der angesehene Scharfrichter von Regensburg war.
»Henkersbalg, Henkersbalg!« Der Schneeball traf Marie mit Wucht am Kopf. Ein weiterer folgte, dann noch einer. Hinter einem schneebedeckten Busch entdeckte sie mehrere jungen und Mädchen. Sie grinsten und griffen in den Schnee, um weitere Kugeln daraus zu formen. Marie wollte wegrennen, musste aber an ihren Großvater denken: »Es gibt nichts, weswegen du dich schämen müsstest, Marie«, hatte er ihr oft erklärt. »Die Bürde unseres Berufsstandes wurde uns direkt von Gott übertragen, und unsere Familie trägt sie seit Jahrhunderten mit Würde.«
Würdevoll sah es nicht gerade aus, wie sie versuchte, den eisigen Bällen auszuweichen. Bald hagelten von allen Seiten Schneebälle auf sie ein. Sie strauchelte, landete in einer knietiefen Wehe. Die Kälte kroch ihr sofort in die Haut, als sei sie in eisiges Wasser gefallen. Sie versuchte aufzustehen, rutschte aber mit den Füßen am Boden ab. Ein harter Schlag traf sie im Gesicht, sie schmeckte Blut auf ihren Lippen und hob den Arm, um sich zu schützen. Vergebens, sie konnte die Flut der Bälle nicht abhalten. Dann hörte sie, wie die Stimmen, die noch immer ihrem Singsang folgten, näher kamen. »Henkersbalg, Henkersbalg!« Sie bekam einen Stoß, versuchte aufzustehen. Wurde wieder gestoßen.
»Henkersbalg, Henkersbalg!«
Schnee bedeckte sie. Ihre Wut dehnte sich aus, wie Ringwellen auf einer Wasseroberfläche. Heiß strömte ihr Atem gegen die eisige Höhle, die sich über ihrem Kopf gebildet hatte. Sie versuchte sich zu befreien, die Kälte kroch in ihre Knochen. Der Schnee umschloss sie, als sei sie an den Grund eines Sees gesunken. Heiße Tränen liefen ihr die eisigen Wangen hinunter. Noch einmal nahm sie ihre Kraft zusammen, um sich vom Boden abzustoßen. Sie rang krampfhaft nach Luft, sog dabei eisige Brocken ein, die in ihrem Mund zu kühlem Nass wurden. Ihre Hände und Füße kribbelten. Sie schrie so laut sie konnte. Dann dröhnte nur noch die Stille in ihren Ohren. Sie war so müde, da wäre es gut, einen Augenblick zu schlafen. Marie spürte, wie der Schlaf von ihr Besitz ergriff, sie sich langsam von ihm wegtragen ließ. Warme Hände strichen über ihr Gesicht. Sie fühlte, wie die Eiskristalle auf ihren Wangen schmolzen.
***
Der Bart ihres Großvaters war das Erste, was sie sah, als sie die Augen aufschlug. Ein Gerber hatte die Kinder fortgejagt, Marie aus dem Schneeberg ausgegraben und zu ihrer Familie getragen.
»Die Kleine ist wieder wach, ich habe doch gesagt, es waren nur die Kälte und die Erschöpfung«, sagte er zu Maries Mutter, die außer Atem mit einem großen Bündel Holz in den Raum gestolpert kam. Er stand auf, um Anna das Bündel abzunehmen, hielt jedoch inne, als seine Frau den Raum betrat. Die Abneigung zwischen den beiden Frauen war mit Händen zu greifen.
Zunächst war Elisabetha Grosholtz froh gewesen, als ihr Sohn Johann die achtzehnjährige Anna mit nach Hause brachte – auch wenn sie nur eine Dienstmagd war. Doch seit ihr Sohn im Streit das Haus verlassen hatte, wurden Anna und Marie von seiner Mutter nur noch geduldet. Die beiden sollten ihr Wohnrecht abarbeiten. Anna schloss Marie in die Arme, die Ringe unter ihren Augen waren noch tiefer als sonst.
»Das war das letzte Mal, Mariechen. So etwas wie heute wird nie mehr passieren. Schon bald wird alles anders«, flüsterte sie.
»Hast du schon alles erledigt, Anna?«, fuhr die Großmutter dazwischen. »Die Tiere müssen noch versorgt werden. Jetzt, wo deine unnütze Tochter geruht, es sich bequem zu machen.« Die Vorwürfe über die unbotmäßige Schwiegertochter oder die nutzlosen Esser hatten sie schon oft gehört. Diesmal lächelte Anna ruhig, legte ihrer Tochter die Puppe aus Stoffresten in den Arm und strich die Bettdecke glatt. Für einen Moment spürte Marie sichere Geborgenheit. Als Anna sich auf den Weg in den Stall machte, war ihre Tochter schon wieder eingeschlafen.
***
»Du wirst dich und das Kind mit deinem Eigensinn noch ins Unglück stürzen. Denk bloß nicht, dass wir euch mit offenen Armen wieder aufnehmen, wenn ihr aus diesem Sündenpfuhl Paris zurückgekrochen kommt«, hörte Marie ihre Großmutter schreien. Anna entgegnete etwas, das Marie aber nicht verstand, sie hörte die beiden streitenden Frauen nur gedämpft. Wer würde wohin gehen und wen damit ins Unglück stürzen? Sie überlegte, ob sie zu ihrer Mutter gehen sollte, aber sie würde nur in die Schusslinie geraten und den Streit noch schlimmer machen.
Sie ging in die Kammer ihres Großvaters. Sie liebte diesen Raum mit seinen Geheimnissen. An der Decke hingen Kräuterbüschel, die einen kräftigen Geruch verströmten. An den Wänden standen Folianten neben Schalen aus blau dekorierter Fayence. Daneben Krüge, Glaskolben und ein Blasebalg, dazwischen lag ein Totenschädel, an der Wand hingen getrocknete Eidechsen und ein prächtiges Schwert, in das etwas graviert war, und Marie wusste auch, was: »Ihr Heren steuren dem Unheil / Ich exequire ihr Urteil«, und auf der anderen Seite: »Wan ich das Schwert tue aufheben / wuensche ich dem Suender das ewig Leben«. Ihr Großvater hatte es ihr erzählt, denn sie selbst konnte nicht lesen – noch nicht. Immer, wenn er die Zeit fand, setzte er sich mit Marie an den Tisch und erklärte ihr, was es mit den Buchstaben und Zahlen auf sich hatte. Oft las er ihr mit seiner tiefen Stimme aus den Abenteuern des Robinson Crusoe vor, eines jungen Mannes, den es, von einer törichten Abenteuerlust getrieben, auf eine einsame Insel verschlagen hatte. Der Rauch seiner Pfeife wurde dabei zu fantastischen Bildern in der Luft, in denen Marie manchmal ein Schiff, manchmal eine Insel, aber manchmal auch einen Kannibalen zu entdecken glaubte. Sie wurde ganz in die Welt dieses Buches gezogen. Marie litt mit, wenn Robinson sein Gut und sein Leben aufs Spiel setzte; zugleich fühlte sie sich aber auch angezogen von seiner unbändigen Lust, Abenteuer zu erleben.
Zahlen hatten es ihr ebenso angetan, weil sich eine zur anderen fügte, ganz ohne Wenn und Aber. Auf Großvaters Schreibtisch lag ein dickes in Leder gebundenes Buch. Sie stieg auf den Stuhl und schlug das Buch auf. Schon auf der ersten Seite war die Zeichnung eines unbekleideten Mannes zu sehen. Mit dem Finger zog sie die feinen Linien nach. Es folgten Bilder der einzelnen Körperteile und sogar eines, auf dem man sehen konnte, was sich unter der Haut verbarg – das hatte zumindest ihr Großvater erklärt. Marie blätterte weiter und betrachtete die Zeichnung eines Mannes, dessen Körper an verschiedenen Stellen Male aufwies, aus denen Blut floss. Es erinnerte sie an die Bilder in der Sakristei von St. Pierre-le-Vieux am Stadtrand von Straßburg, wo sie getauft worden war und wo sie mit ihrer Mutter die Messe besuchte. Dann knarrten die Dielen hinter ihr. Ihr Großvater trat heran und sah ihr über die Schulter.
»Was bedeutet das?«, fragte sie und zeigte auf die Wundmale.
»Es sind Verletzungen des menschlichen Körpers, die häufig auftreten. Daraus kann ich ersehen, wie ich den Menschen heilen kann – wenn es in meiner Macht steht.« Er hob sie hoch, setzte sich auf den Stuhl und sie auf seinen Schoß. Marie strich nachdenklich über die silbernen Knöpfe an seinem Wams.
»Steht es denn nicht immer in deiner Macht?« Er lächelte.
»Ich wünschte, es wäre so. Aber oft genug ist der Organismus so stark betroffen, dass die Lebenskräfte entweichen.«
»Warum ist das so? Was ist der Organismus?«, fragte Marie. Ihr Großvater lachte.
»Du willst wirklich wissen, was sich hinter den Dingen verbirgt, nicht?« Ein Schatten zog über sein Gesicht. »Ich wünschte, dein Vater hätte etwas mehr von dieser Neugier gezeigt. Leider wird dir dieser Wissensdurst nichts nützen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ihr nach Paris geht«, sagte er leise. Diesen Namen hörte Marie heute nun schon zum zweiten Mal.
»Ist das der Sündenpfuhl?«, fragte sie. Wieder lächelte der Großvater.
»Hast du etwa gelauscht?«, fragte er und runzelte die Stirn. Sie sagte ihm, dass sie vom Streit der beiden Frauen aufgewacht war. »Ihr werdet uns verlassen, Kind«, sagte Maries Großvater und fügte nachdenklich hinzu: »Paris ist eine Stadt aus Lärm, Rauch und Schmutz, wo die Frauen nicht mehr an die Ehre und die Männer nicht mehr an die Tugend glauben. Das hat mal ein Philosoph geschrieben. Wollen wir hoffen, dass du in Paris sowohl Ehre als auch Tugend erleben wirst.«
Er stand auf, ging zu dem Holzkoffer, in dem er seine Arzneien verwahrte, und kramte aus der untersten Schublade etwas hervor. Als er sich wieder zu ihr gesetzt hatte, gab er Marie ein Stück Strick und ließ seine Hand auf ihren Fingern ruhen.
»Trage es immer bei dir, dann wird alles gut werden«, sagte er.
Marie wusste, was es war. Sie hatte schon oft genug erlebt, wie fremde Menschen ihren Großvater darum gebeten hatten, denn ein Stück Galgenstrick sollte Glück bringen, hieß es. Plötzlich war Marie zum Weinen zumute. Die Fragen überschlugen sich in ihrem Kopf, doch als sie den Mund öffnete, drehte der Großvater sich um: »Geh jetzt. Ich habe noch zu tun. Und du wirst von deiner Mutter gesucht.« Sie verbarg den Stick unter ihrem Nachtkleid. Als sie an der Tür stehen blieb und über die Schulter zu ihm sah, strich er noch immer die Linien der verwundeten Körper auf dem Papier nach.
***
Marie machte einen Augenblick Pause. Sie schob ihre Finger unter die Achseln und freute sich, als ihre Fingerspitzen anfingen, wieder zu kribbeln. Bald würde sie weiterschaufeln können. Ihre Mutter Anna ließ die Forke mit Wucht immer wieder in den Mist fahren. Dabei redete sie die ganze Zeit. Anna malte ihrer Tochter aus, wie ihr neues Leben in Paris aussehen würde. Sie würden in einem Palais wohnen, Marie könnte eine Schule besuchen und mit den Kindern der hohen Herren und feinen Damen spielen, die in ihrem Haushalt ein- und ausgingen. Dann rammte sie die Forke in den Boden, wischte sich die Hände an der Schürze ab und kramte aus der Tasche einen Brief, den sie in ein Tuch gewickelt hatte.
»Doktor Curtius bittet mich, seinen Haushalt zu führen. Er ist ein angesehener Mann. Auf Einladung des Prinzen von Conti hat er sich in Paris niedergelassen. Das ist der Schwager vom König«, sagte Anna stolz. Das imponierte Marie erst einmal gar nicht.
»Maman, werden wir hierher zurückkehren? Wann werde ich Großvater wiedersehen?« Die Fragen brannten in ihrem Mund, sie konnten gar nicht schnell genug den Weg hinausfinden. Doch schon bald antwortete Anna nur noch einsilbig, und schließlich stemmte sie die Hände in die Hüften und beendete das Gespräch: »Es ist auf jeden Fall besser als hier. Und das wird doch wohl genügen, oder?«
***
Schon zwei Tage später brachen sie nach Paris auf. Der Abschied war schnell vonstattengegangen. Nach einigen wenigen Worten gaben ihre Schwiegereltern Anna einen in Tuch eingeschlagenen Gugelhupf, Birewecka, ein Brot aus getrockneten Früchten und Nüssen, und eine Flasche Wein mit auf den Weg. Anna packte den Reiseproviant in den Korb, in dem sich bereits ihre wenigen Besitztümer befanden. Der Großvater hockte sich neben Marie und überreichte ihr ein gut verschnürtes Päckchen.
»Nimm Robinson mit. Lies immer darin und denk daran, was ich dich gelehrt habe«, sagte er. Ihrer Mutter steckte er etwas Geld und ein Paket mit Elsässer Schnupftabak zu. Dann schloss er beide in die Arme und ging, als seine Frau die Diele betrat, wortlos in sein Laboratorium zurück. Die Großmutter brachte Mutter und Tochter noch bis zur Tür, ganz als ob sie sicher sein wollte, dass sie auch wirklich gingen.
Kapitel 2
Paris
An die erste Kutschfahrt ihres Lebens erinnerte Marie sich später kaum noch. Sie, die als erwachsene Frau Jahrzehnte in einer Kutsche verbringen sollte. Die Wege müssen schlammig gewesen sein, die Kutsche eng und zugig und die Gasthäuser schmutzig und verlaust. Erst für die Ankunft in Paris hatte sie wieder Bilder im Kopf. Ein Häusermeer bis zum Horizont, eingehüllt in Rauchschwaden, die aus zahllosen Schornsteinen quollen. Die Ledervorhänge der Kutsche flatterten im eisigen Wind und versperrten oft den Blick auf das Getümmel auf den Straßen. Menschen eilten aneinander vorbei. Abgezehrt aussehende Frauen klammerten sich an das Fenster der Kutsche und boten Waren feil. Vor einer Tür schnitten zwei Metzger einem Ochsen die Kehle durch, das Blut platschte dampfend auf das Pflaster. Peitschen knallten, das Geschrei zweier Kutscher, die einander von ihren Böcken aus anbrüllten, mischte sich in die Rufe der Lastenträger und fahrenden Händler. Marie verstand nur wenig, denn auch wenn man in der Straßburger Gesellschaft Französisch parlierte, hatte sie doch bei ihren Großeltern meist Deutsch gesprochen. Wie ein Strudel wirbelten Menschen, Geräusche, Gerüche um Marie, als sie mit wackligen Knien und kalten Gliedern aus der Kutsche stieg.
Anna zeigte auf dem Weg durch die Straßen immer wieder einen Zettel vor, auf dem »Hôtel d'Aligre, Rue Saint-Honoré« stand, bis endlich ein Passant wortkarg auf ein großes Gebäude wies, das direkt vor ihnen aufragte. Ein Durchgang führte in den Innenhof. Hier drängten sich windschiefe Werkstätten und Buden zu einer belebten Passage. Marie und ihre Mutter fanden einen Aufgang und landeten schließlich im ersten Stockwerk. Die Säle waren durch Holzwände geteilt, kein Mensch war zu sehen, kein Geräusch außer ihren Schritten zu hören. Marie jagten diese unbelebten Räume, die von vergangener Pracht kündeten, Schauer über den Rücken.
»Ist das wirklich der Palast? Ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt«, flüsterte Marie. Ihre Mutter zog sie weiter. Sie gingen auf ein Licht zu, das durch einen Türspalt auf das Parkett fiel. Anna drückte die Tür etwas weiter auf. Jetzt konnte Marie sehen, dass ein Mann an einem Tisch in der Mitte des Raumes saß. Hinter ihm ragten Hände hervor: den kleinen Finger geziert abgespreizt, Daumen und Zeigefinger aneinandergedrückt oder den Zeigefinger in die Luft gerichtet. Es schien, als nehme der Mann den lautlosen Dialog der Hände, die auf einen verzweigten Pfahl gesteckt waren, gar nicht wahr. Gedankenverloren blickte er in eine Holzkiste. Neben ihm lagen Bücher, Kessel und ein Holzkoffer, Kräuter hingen von der Decke herab. Gemälde und fleckige Spiegel lehnten an den Wänden. Marie wollte ihre Mutter etwas fragen, aber Anna legte einen Finger über den Mund und zwinkerte ihr zu. Ihre Ankunft sollte eine Überraschung sein. Das also war Doktor Curtius.
Jetzt hob er die Kiste leicht an, und sie hörten ein Kullern. Er nahm mit spitzen Fingern eine kastaniengroße durchsichtige Kugel hoch und hielt sie in das fahle Licht, das durch die hohen Fenster fiel. Die Kugel sah wie ein Auge aus! Marie schrie auf. Doktor Curtius schreckte hoch. Mit großen Schritten kam er auf sie zu. Er nahm ihre Mutter in den Arm und drückte sie so überschwänglich, dass ihre Füße den Boden nicht mehr berührten.
»Anna! Da seid ihr ja schon! Ich hatte erst in den nächsten Tagen mit euch gerechnet. Sonst hätte ich euch selbstverständlich abgeholt«, sagte er. Dann beugte er sich zu Marie.
»Ah, da bist du ja, Mariechen. Groß geworden bist du«, begrüßte er sie.
Marie starrte auf das Gebilde, das er noch immer in der Hand hielt.
»Das ist ein Glasauge. Ich benötige es für meine Arbeit«, erklärte er.
»Schau mal, wie schön sich das Licht darin bricht.« Marie nahm das Glasauge in die Hand, kniff ein Auge zu und hielt es vor das andere. Dann musterte sie Curtius. Er war etwa dreißig, die schulterlangen dunklen Haare waren mit einem grünen Band im Nacken gebunden, um den Kopf und um die Hände hatte er Tücher geschlungen. Er hatte leicht vorstehende Augen, eine gerade, fleischige Nase und einen fein geschwungenen Mund. Die Pelzverbrämung seines Wamses wies kahle Stellen auf. Er roch gut, nach Tabak und Lavendelwasser.
»Ich erinnere mich nicht an Sie. Sind Sie Doktor Curtius?«, wollte sie wissen.
»Der bin ich«, sagte er und verbeugte sich elegant.
Marie sah sich neugierig um. Der Raum war groß und sah heruntergekommen aus. Ein Ofen stand an der Wand, und obgleich das Rohr zum Fenster hinausführte, hatte der Rauch die Fresken geschwärzt. Mitten im Zimmer lag auf einem Kanapee eine blonde schlafende Frau.
»Und wer ist diese Frau?«, fragte sie. »Darf ich sie auch begrüßen?«
Sie sah den Doktor fragend an.
»Keine Angst, du wirst sie nicht aufwecken«, antwortete er. Er nahm Marie an die Hand und ging auf die Frau zu. Gemeinsam betrachteten sie die Schlafende.
»Sie sieht aus wie ein Engel«, flüsterte Marie.
»Oh, ich bin sicher, viele halten sie auch dafür, vor allem Männer«, sagte Curtius schmunzelnd. »Du kannst sie anfassen. Aber Vorsicht!« Marie zögerte. Curtius nahm ihre Hand und führte sie an das Gesicht der Frau. Es war glatt und kühl. Marie sah ihn mit großen Augen an. Auch ihre Mutter war nun neugierig näher getreten.
»Sie ist mir gut gelungen, nicht wahr? Ich habe sie hergestellt, aus Wachs. Es ist das Porträt von Jeanne Bécu, der Mätresse des Grafen Dubarry. Sie wirkt arglos wie ein Geschöpf des Himmels. Aber sie hat einen brennenden Ehrgeiz, der sie zum Strahlen bringt, so wie eine Kerze in einem Spiegelsaal ein ganzes Feuerwerk entfachen kann. Sie wird es noch zu etwas bringen, das spürt man. Und die Besucher der kommenden Ausstellung werden sie lieben, ich weiß es!«
Marie konnte es kaum fassen, dass die Frau nicht lebte, nicht atmete. Immer wieder ließ sie ihre Finger zart über die Wachsfigur gleiten. Da erhob sich der Doktor und nahm ihre Mutter bei der Hand.
»Aber was vertrödeln wir hier unsere Zeit. Ihr müsst hungrig sein. Später habt ihr noch Gelegenheit genug, euch meine Arbeiten anzusehen.«
Marie folgte ihrer Mutter und dem Doktor nur ungern. Sie konnte den Blick nicht von der wunderschönen Frau abwenden. Sie wäre lieber hier geblieben, hätte sich still zu der Schlafenden gesetzt und herausgefunden, was für Geheimnisse sich noch in diesem Raum verbargen. Denn das Zimmer erinnerte sie an das Laboratorium in Straßburg, vor allem aber an ihren Großvater. Wie sie ihn schon jetzt vermisste!
Einige Zeit später saßen die drei in einer karg eingerichteten Küche. Marie war nun satt und glücklich. Die Wärme des Essens und des Kamins hatten ihre Wangen zum Glühen gebracht. Der Doktor hingegen war erbost. Anna hatte ihm gerade von ihren Erlebnissen in Straßburg berichtet. »Diese unglückseligen, ungezogenen Kinder. Was hätte Marie alles passieren können, wenn der Gerber ihr nicht geholfen hätte! Es ist gut, dass ihr hergekommen seid. Hier weiß niemand, aus was für einer Familie ihr stammt. Hier ist deine Tochter ein Mädchen wie alle anderen. Und kein Henkersbalg mehr.«
»Aber was werden wir deinen Besuchern sagen? Werden sie sich nicht fragen, wer wir sind?«, fragte Anna unsicher.
»Das habe ich mir auch schon überlegt. Wir sagen einfach, dass du meine Schwester bist, die mir den Haushalt führt. Ich kann Hilfe gut gebrauchen, denn es gibt bald viel zu tun. Ich habe einige Kunden, die auf meine Wachsarbeiten warten ...«
Marie hatte sich schon die ganze Zeit gewundert, wieso ein Arzt mit einer großen Puppe aus Wachs spielt. Jetzt hielt sie es nicht mehr aus.
»Wieso haben Sie keine Patienten, Doktor Curtius? Sind Sie denn gar kein richtiger Arzt?«, fragte sie.
»Marie, so etwas fragt man nicht!«, rügte ihre Mutter sie.
»Lass sie nur. Marie, nenn mich nicht mehr Doktor Curtius, ich bin ab jetzt dein Onkel.« Er räusperte sich. »Ich habe meine Ausbildung in Bern abgeschlossen und dort als Doktor gearbeitet. Als Arzt hat man immer Wachs zur Hand, man braucht es beispielsweise zum Füllen von zerfressenen Zähnen. Mich hat dieses Material fasziniert. Ich habe angefangen, Miniaturen herzustellen, die bald sehr beliebt waren und gerne verschenkt wurden. Schnell konnte ich auch den Prinzen von Conti für meine Kunst begeistern. Als mein Gönner und Freund hat er mir geraten, nach Paris zu ziehen und mich ganz auf die Wachsarbeit zu konzentrieren. Er hat mir auch ein Atelier in diesem Palast verschafft, denn hier werden bald die Kunstfreunde ein und aus gehen.«
»Ich finde ihn unheimlich, diesen Palast«, gestand Marie.
Curtius nickte, nahm eine Prise Schnupftabak aus einer Dose und schnäuzte sich. »Er hat auch eine düstere Geschichte. Dieser Palast des Grafen von Schomberg war von König Heinrich IV. für seine Geliebte Gabrielle d'Estrées gekauft worden. Während seines langen, ausschweifenden Lebens war Heinrich IV. nur einer Dame treu – ihr. Der König behandelte sie wie eine Königin, sie war aber auch, erzählt man sich, eine Frau mit Herz und Verstand. Sie verstand es, mit Botschaftern zu verhandeln, begleitete Heinrich aber genauso – sogar während sie sein Kind im Leib trug – auf das Schlachtfeld, damit er ihre Gesellschaft nicht missen musste«, erzählte Curtius. Marie hielt die Augen auf das flackernde Feuer gerichtet und lauschte der warmen Stimme.
»Im April 1599, Gabrielle d'Estrées war im fünften Monat schwanger, brach sie nach einer Abendeinladung zusammen«, fuhr Curtius fort. »Sie war todkrank. Das Kind musste Stück für Stück aus ihr herausgeschnitten werden. Am Ostersamstag, einen Tag bevor sie zur Königin gekrönt worden wäre, starb sie in ihrem eigenen Blut. Die Ärzte schnitten den Leichnam später auf und untersuchten ihn, um die Ursache ihres Todes herauszufinden«, erzählte er ruhig. »Nach der Sectio hieß es, sie sei an einer verdorbenen Zitrone gestorben.« Curtius schenkte sich ungerührt Rotwein ein. »Wenn du mich fragst, ich für meinen Teil vermute, dass sie vergiftet wurde, weil der Vatikan und das Haus der Medici verhindern wollten, dass sie die neue Königin wird.« Marie schwirrte der Kopf – von wem sprach er? Sie hatte noch viel zu lernen. »Heinrich hörte von ihrem Tod und brach unverzüglich auf. Zum Zeichen seiner Trauer kleidete er sich ganz in Schwarz, obwohl Monarchen zu dieser Zeit nur Weiß oder Purpur trugen. Als er ankam, erkannte er seine Geliebte kaum wieder. Gabrielle d'Estrées hatte im Tod so stark grimassiert, dass das wohlgeformte Gesicht und der ebenmäßige Körper völlig entstellt waren. Niemand vermochte der Toten zu einem würdevollen Aussehen zu verhelfen.« In den Schatten des Feuers vermeinte Marie die Ereignisse vor sich zu sehen. »Man legte ihren Leichnam in den Sarg, vernagelte ihn und schob ihn unter das Bett. Heinrich ordnete an, eine Wachsfigur heranzuschaffen, die seiner Geliebten nachgebildet worden war, und ließ sie aufbahren. Die Trauergäste zogen also, ohne es zu wissen, an einem Abbild vorbei, statt an der Leiche der schönen Gabrielle. Auch nach der Beisetzung mochte sich Heinrich nicht von diesem Wachsporträt trennen. Er ließ es in eine Kammer in seinen Privatgemächern im Louvre bringen und täglich neu einkleiden. Jeden Tag besuchte er die Puppe und hielt mit ihr Zwiesprache, selbst nachdem er auf Drängen des Papstes Maria von Medici geheiratet und sich einige Zeit später eine neue Mätresse zugelegt hatte.«
In jener Nacht träumte Marie zum ersten Mal, dass die Wachsfiguren zu ihr sprachen. Und selbst als Marie später erfuhr, dass sich der Tod von Gabrielle d'Estrées gar nicht im Hôtel d'Aligre zugetragen hatte, ließ sie das tragische Schicksal des edlen Königs und seiner Mätresse nicht mehr los.
***
Als in den folgenden Wochen nach und nach auch die anderen Ateliers zum Leben erwachten, ließ die Beklemmung, die Marie in den Fluchten des Hôtel d'Aligre spürte, nach. Staffeleien wurden in die Zimmer getragen, Kisten mit Farben, Leinwände und Bildhauerwerkzeug.
Nun sättigte täglich der Geruch von Farben und Lösungsmitteln die Luft, das Klackern der Meißel hallte von den hohen Decken wider. Für Marie tat sich eine neue Welt auf. Sie konnte sich an den fremdartigen Gestalten kaum sattsehen. Neben ihnen wohnte ein hochmütiger Maler, der seine adeligen Besucher mit Bücklingen hofierte – und dennoch abends in ihrer Küche stand, um wortkarg von Anna einen Teller Suppe zu erbitten. Gegenüber wohnte ein abgerissen gekleideter Bildhauer, der Büsten schuf, die eine strahlende Ähnlichkeit mit seinen Auftraggebern hatten. Und dazu Curtius, aus dessen Atelier man beinahe rund um die Uhr leises Werkeln hören konnte. Wenn Marie ihm seine Mahlzeiten oder eine Schale Milchkaffee brachte, war er stets dabei, etwas in einem Topf zu erwärmen, Wachs mit einem Griffel zu bearbeiten oder über einem Buch zu brüten. Ab und an verschwand er für einige Stunden, um, wie er sagte, etwas in die Wege zu leiten. Wenn er zurückkehrte, trug er oft ein Bild oder ein Buch unter seinem Arm. Dann sah Marie, wie Anna ihm missbilligend nachblickte. Anna und er redeten kaum miteinander. Nur manchmal, wenn Marie schon im Bett lag, hörte sie die beiden leise miteinander sprechen, manchmal auch streiten. Als sie einmal einen besonders heftigen Wortwechsel hörte, hielt es Marie nicht mehr an ihrem Platz.
»Seit Wochen sitzen wir in der Kälte, weil wir keinen Sou für Holz haben – und du trägst das Geld zum Buchhändler und nimmst Gemälde in Kommission. Nun willst du auch noch den Rest für ein Puppenkleid und feinen Likör für fremde Leute ausgeben?« Marie hörte Annas Stimme brechen. »Wenn ich gewusst hätte, dass du verrückt geworden bist, hätte ich meine Tochter nicht in diese Stadt gebracht.« Marie wollte ihrer Mutter zu Hilfe kommen. Sie trat in die Küche und sah die beiden am Tisch sitzen. Curtius hatte die Arme um Anna gelegt. Sie bemerkten Marie nicht, denn der Schein des Feuers reichte nicht bis zur Tür. »Diese Investition wird sich auszahlen. Meine Werke machen schon jetzt von sich reden. Man wird sich bei der Ausstellung nur so drängen, um sie zu sehen. Warte ab, meine Liebe, ich bin das Gegenteil von verrückt.« Curtius strich ihr zärtlich durchs Haar. Marie staunte, als sie sah, dass der Doktor und ihre Mutter sich leidenschaftlich küssten.
Sie schlich in ihr Zimmer zurück und holte das Buch ihres Großvaters hervor. Seit sie bei Onkel Curtius wohnten, ging Marie auf die nahe gelegene Schule der Filles-de-Sainte-Agnès. Zunächst hatten ihr die Besuche dort keine Freude gemacht: ein dunkles, muffig riechendes Gemäuer; Bettler, die morgens vor den Klostertoren warteten, um eine Kelle Suppe und einen Kanten Brot zu erbetteln; Nonnen, die schnell den Rohrstock zur Hand hatten; und andere Mädchen, die Marie auslachten, weil sie einen fremdartigen Akzent hatte. Und dann ihr Name: zu Grossolse verunstalteten sie ihn, weil sie ihn anders nicht aussprechen konnten. Der Unterricht war eine Enttäuschung. Meistens wurde genäht und gestickt. Aber immerhin lernte sie auch Lesen, Schreiben und Rechnen. So war sie schneller als ihre Mutter in der Lage, das Nötigste auf Französisch zu sagen. Sie wollte aber auch in dem Buch ihres Großvaters lesen können. Denn so wie Robinson auf seiner einsamen Insel Trost in der Lektüre der Bibel fand, boten seine gedruckten Abenteuer Marie eine Heimat in der Fremde. Buchstabe für Buchstabe zusammenfügend, schaffte sie zwar täglich nur wenige Zeilen, bis ihr die Augen zufielen, dennoch reichte es aus, um farbenprächtige Bilder von großen Schiffen, dem tosenden Meer und wilden Seemännern vor ihrem inneren Auge zum Leben zu erwecken.
Das Knarren der Dielen ließ sie zusammenzucken. Es war Curtius. Er stutzte. »Hast du dich bei meinen Büchern bedient?« Er nahm das Buch aus ihrer Hand, las den Titel und zog dann die Augenbrauen hoch. »Von wem hast du es?«, fragte er ernst.
»Mein Großvater schenkte es mir zum Abschied. Wir haben darin gemeinsam gelesen«, sagte sie. Curtius' Züge entspannten sich.
»Da kannte wohl jemand seinen Rousseau«, sagte er. »Wie ungewöhnlich. Ein Henker, der die verbotenen Traktate des Freidenkers liest.« Als Marie ihn fragend ansah, erklärte Curtius ihr, dass der große Denker Jean-Jacques Rousseau, mit dem er übrigens über den Prinzen von Conti bekannt sei, in seinem Buch Emile oder Über die Erziehung empfiehlt, dass man Kindern nur ein Werk als Lektüre erlauben solle, nämlich eben diesen Robinson Crusoe des englischen Schriftstellers Daniel Defoe. Rousseaus Buch sei von der Obrigkeit geächtet und vor dem Justizpalast verbrannt worden, dennoch verbreite sich sein Gedankengut unaufhaltsam. Curtius setzte sich zu ihr auf das Bett und schlug das Buch auf. Plötzlich erhob er seine wohltönende Stimme: »... und mich hieß man daher Robinson Kreutznaer, aber durch das gewöhnliche Verderben der Wörter in England nennt man uns jetzt und nennen wir uns selber und schreiben uns Crusoe, und so haben mich auch meine Kameraden immer gerufen.« Er ließ seinen Blick noch einen Augenblick nachdenklich über die Seiten schweifen. »Siehst du, bei mir ist es ähnlich. Auch meine Familie hieß einst Kreutz, nannte sich aber Curtius, da es für die Franzosen einfacher auszusprechen ist. Meine Abenteuer haben mich von Stockach am Bodensee über das schweizerische Bern und deine Heimat Straßburg hierher geführt. Meine Insel ist Paris, nur ist sie ganz und gar nicht einsam.« Er klappte das Buch zu, strich beinahe zärtlich über den Einband und gab es ihr zurück. Marie hätte ihn gerne gefragt, ob er ihr noch etwas vorlesen würde, doch Curtius schien mit seinen Gedanken schon wieder woanders zu sein.
***
Am nächsten Morgen waren, zum ersten Mal seit sie bei Curtius wohnten, die Räume des Ateliers von wohliger Wärme erfüllt. Die Kamine, die so lang waren, dass Marie sich leicht hätte hineinlegen können, leuchteten von brennenden Scheiten. Lange vor Sonnenaufgang waren Anna und Marie aufgestanden. Ihre Mutter wirbelte durch die Räume, stellte Kerzen auf, nahm Lieferanten die Last ab. Ihre Wangen waren vor Aufregung und Arbeit rosig, aus ihren hochgesteckten Haaren hatten sich einige Strähnen gelöst. Marie betrachtete sie, während sie den Boden des Ateliers fegte. Ihre Mutter strahlte beinahe, sie sah so glücklich aus wie lange nicht mehr. Genau genommen konnte sie sich kaum erinnern, ihre Mutter jemals so zufrieden gesehen zu haben. Vielleicht damals, als ihr Vater noch bei ihnen war? Es war Marie, als fühlte sie ein Loch in ihrem Herzen. Sie hatte nur wenige Erinnerungen an ihn. Sie hätte gerne mehr über ihre Familie gesprochen, aber immer, wenn sie das Thema ansprach, versteifte sich ihre Mutter und presste ihre Lippen aufeinander.
Marie kehrte den Staub zu einem Häufchen zusammen. In ihrer Nähe reihte Curtius auf einem Streifen roten Samtes seine Miniaturen auf, nur mit den Fingerspitzen berührte er die fragilen Wachsgebilde, unter denen Marie einen schlanken Frauenkopf, ein ausdrucksvolles Männergesicht und das Bildnis eines Kleinkindes erkennen konnte. Der Doktor trug eine gepuderte Perücke und feine, glänzende Kleidung. Am liebsten wäre sie zu ihm gegangen und hätte ihm zugesehen. Doch Curtius hatte sie bei ihren letzten Versuchen, ihn bei seiner Arbeit zu beobachten oder ihm gar zu helfen, ungeduldig zur Seite geschoben. Heute war er so vertieft und zugleich so angespannt, dass sie ihm lieber nur aus der Ferne zusah. Marie warf den Kehricht aus dem Fenster. Danach begann sie, die Spiegel zu wienern, wie es ihre Mutter ihr aufgetragen hatte. Je mehr die blinden Stellen schwanden, umso besser konnte Marie ihr Gesicht erkennen. Die braunen Augen blickten ernst, die Brauen hatte sie konzentriert zusammengezogen. Die feinen braunen Haare waren unter einer Haube zusammengesteckt. Hübsch fand sie sich nicht. Zumindest nicht so hübsch wie viele Mädchen, die herausgeputzt an der Seite ihrer Eltern auf der Rue Saint-Honoré flanierten. Sie war zu klein, ihre Nase schien ihr zu groß, ihre Haut nicht blass genug.
»Marie, komm, du kannst mir zur Hand gehen«, riss Curtius' Stimme sie aus ihren Gedanken.
Er hatte seine Miniaturen und Büsten aufgereiht, nur die Schlafende Schöne lag noch unberührt auf ihrem Kanapee.
»Zieh dich an, wir müssen etwas abholen.« Marie strahlte: Sie durfte helfen, vielleicht würden sie gar einen Prinzen besuchen! Sie warf sich ein Cape über und folgte ihm.
Sie gingen Richtung Rue Bailleul. In der Passage schafften die Händler ihre Waren in ihre Buden. Frühe Flaneure ließen sich durch die Geschäftigkeit, die um sie herum herrschte, nicht stören. Obgleich der Laden mit den Delikatessen noch geschlossen war, hing der Duft von geräuchertem Schinken und exotischem Obst in der Luft. Curtius hatte jedoch keinen Blick für die Passanten, auch nicht für den alten Mann, der ihm aus einer Kruke auf seinem Rücken Milchkaffee anbot, bereit, dem letzten Käufer den noch halb gefüllten Becher aus der Hand zu reißen, um ihn, erneut gefüllt, an seinen neuen Kunden weiterzureichen. Marie eilte dem Doktor hinterher. Kleine Jungen mit Brettern sprachen sie an. Sie verdienten ihr Geld damit, dass sie ihr Brett über besonders große Pfützen legten, sodass die Passanten trocken darübersteigen konnten. Im Schmutz der Straßen hockten Frauen, Männer und Kinder mit ausgemergelten Gesichtern und streckten ihnen mit flehendem Blick die Hände entgegen. Marie, die stehen geblieben war, sah sich nach dem Doktor um. Kurz überkam sie Panik. Dann erkannte sie seinen wippenden Gang in der Menge. Er war beinahe einen Häuserblock entfernt. Marie raffte den Saum ihres Rockes, der schon jetzt mit Schlamm bespritzt war, und lief ihm schnell hinterher.
Vor einem Haus, an dessen Tor eine prächtige Equipage wartete, blieben sie stehen. Als sie eintreten wollten, kam ihnen eine Dame entgegen, die anmutig die Nase reckte. Unter ihren blonden Haaren ließen dunkle Wimpern die Augen leuchten, das schmale Gesicht war von zwei kleinen Schönheitsflecken verziert. Marie war es, als sei sie ihr schon einmal begegnet, sie konnte sich aber nicht erinnern, wo. Ein Diener mühte sich ab, ihre zwei quirligen Möpse im Zaum zu halten und zugleich seiner Herrin den Verschlag zu öffnen. Ein Mädchen, blond und blass, vielleicht zwei Jahre älter als Marie, aber noch zarter, trug den beiden ein fest verschnürtes Paket hinterher. Sie reckte den Kopf, um über ihrer Last den Weg zu erkennen. Jetzt fiel dem Diener einer der Hunde herunter, das Mädchen stieß gegen ihn, das Paket segelte beinahe zu Boden. Sogleich hieb die Dame mit ihrem Fächer auf Kopf und Rücken der beiden. »Ihr Tölpel«, schimpfte sie wenig damenhaft. »Ungeschicktes Pack, ungeschicktes!«
Hastig bückte sich der Diener, um den Mops wieder aufzuheben, während sich der andere in seiner Hand wand. Als er die beiden Hunde zu der Frau setzen wollte, verzog diese angewidert das sorgfältig geschminkte Gesicht und führte, den kleinen Finger weit abgespreizt, ein Riechfläschchen an die Nase. Sie nahm den sauberen Mops entgegen, während der Diener, über dessen ebenso angewiderten Gesichtsausdruck Marie lächeln musste, den zweiten Hund auf den Kutschbock setzte. Dann nahm er dem Mädchen das Paket ab und verstaute es. Die Kleine ging mit hängenden Schultern in das Geschäft zurück. Jetzt trat Curtius an das Fenster der Kutsche und deutete eine Verbeugung an.
»Gnädige Frau sehen heute wieder bezaubernd aus. Werde ich die Freude haben, Sie als Gast der Ausstellung im Palais Schomberg begrüßen zu dürfen? Ihr Porträt ist fertiggestellt und bereit, abgeholt zu werden.«
Marie hörte einen leisen, leicht lispelnden Singsang aus der Kutsche, Curtius lächelte charmant. Die Dame reichte ihm graziös eine behandschuhte Hand aus dem Fenster, auf die er einen Kuss andeutete.
»Zu schade, dabei hat auch der Prinz von Conti seinen Besuch angekündigt, um die neuesten Wachsminiaturen aus meiner Hand in Augenschein zu nehmen«, sagte ihr Onkel. Die Hand verweilte in Curtius' Fingern. Die Frau antwortete, doch wieder konnte Marie nicht verstehen, was gesprochen wurde. Dann schlug eine Hand an die Holzvertäfelung, woraufhin sich die Kutsche in Bewegung setzte.
Marie sah ihr staunend nach. »Wer war die Dame? Etwa eine berühmte Gräfin?«, fragte sie.
»Nein, das noch nicht. Genau genommen ist sie noch vor gar nicht langer Zeit im Modesalon von Monsieur Labille tätig gewesen. Aber vielleicht kann sie noch eine Gräfin werden, das weiß man ja nie so genau.« Er sah sie prüfend an. »Hast du sie denn nicht erkannt? Neulich noch ließest du dich von ihrem Abbild täuschen. Ich dachte, mir wäre ihr Porträt so wohl gelungen.« Da dämmerte es Marie. Sie hatte die Schlafende Schöne leibhaftig gesehen!
Erst jetzt bemerkte sie, dass sie aus dem Geschäft beobachtet wurden. Neugierig wurden sie von jungen Frauen gemustert, deren Gesichter am Fenster aufgereiht waren wie Perlen an einer Kette. Curtius und Marie traten ein. Die Finger der jungen Frauen bewegten sich flink über ihren Näharbeiten, während sie sich unterhielten und ihre Augen zwischen den Passanten hin und her wandern ließen. Aus dem Hinterzimmer trat eine Dame zu ihnen, warf einen kurzen Blick auf die tuschelnden Näherinnen, zischte »Genug jetzt!« und wandte sich, zufrieden, dass die Frauen verstummt waren, Curtius zu. Ihr Onkel und die Dame tauschten einige Höflichkeiten aus und unterhielten sich dann über die frühere Modistin, die sich schon jetzt wie eine zukünftige Gräfin Dubarry aufspielte.
Marie sah sich um. Der Raum wurde durch das fahle Tageslicht nur wenig erhellt. Ihr Blick blieb an den kostbaren Stoffen hängen, an Quasten und Flitterkram, an Schleiern, Federn, Blumen aus Seide und Damenhüten, die an den Wänden hingen. Sie bewunderte, wie sicher sich die Finger der Frauen bewegten, ohne dass sie einen Blick auf ihre Näharbeit verschwendeten. Das kleine blonde Mädchen hatte sich auf einen Stuhl in einem Winkel gesetzt, die Augen hielt es konzentriert auf Finger, Faden und Stoff gerichtet. Plötzlich wurde es von der Frau gerufen, Laure solle ihr helfen, ein Kleid aus dem Hinterzimmer zu holen. Als sie zurückkehrten, nickte Curtius anerkennend; Marie hielt den Atem an. Das Kleid war ein Traum aus Samt, Seide und Spitze. Marie strich mit der Hand über den feinen Saum. Wie schön musste es sein, dieses prächtige Kleid zu tragen. Man würde sich darin wie eine Prinzessin fühlen!
»Die Robe ist wunderbar«, fand auch Curtius. »Sie ist ihren Preis wert. Und sie entspricht genau einem ihrer Kleider?«
»Das Kleid ist dem nachempfunden, das Jeanne zuletzt anfertigen ließ. Dafür verbürge ich mich«, sagte die Frau.
»Dann wird es seinen Zweck erfüllen«, sagte Curtius, als er die Börse zückte. Die Frau zögerte.
»Darf ich fragen, wofür Sie das Kleid benötigen?«, fragte sie schließlich.
»Ich hatte das Vergnügen, Madame Bécu zu porträtieren. Ihr Wachsporträt wird ein wichtiges Exponat in der nächsten Ausstellung der Akademie Saint-Luc sein«, erklärte Curtius stolz.
»Jeanne? Wieso denn gerade Jeanne? Sie sieht bildschön aus, aber sonst?!«
»Was sonst? Ist das nicht Grund genug? Das Interesse an ihrer Person ist schon jetzt beträchtlich.« Die Dame lachte los und hielt sich dann verschämt eine Hand vor den Mund. Auch die Näherinnen kicherten.
»Das kann ich mir denken. Die Männer rennen ihr hinterher wie Köter einer läufigen Hündin.« Als sie Curtius' ernsten Blick bemerkte, entschuldigte sie sich. »Ich meine nur, Jeanne hat einen gewissen Ruf.«
Curtius reckte das Kinn und räusperte sich. »Der nicht Ihre Sorge sein dürfte.« Er klimperte mit dem Geld in seinem Beutel. Die Frau schlug die Augen nieder.
»Natürlich nicht«, sagte sie.
Sie machte Laure ein Zeichen und hüllte mit ihr zusammen das Kleid ein, als das Unglück geschah. Laure wollte Marie den Saum reichen, stolperte dabei, der Samt glitt auf den Boden, Laure trat darauf, der Spitzensaum zerriss. Das Mädchen duckte sich schon, bevor die ersten Schläge seinen Kopf trafen. »Du nichtsnutziges Ding!«, schimpfte die Dame, während sie auf Laure einschlug. Eine Näherin mit roten Pausbacken sprang auf und wollte dem Mädchen zu Hilfe kommen, setzte sich jedoch wieder, als sie der strenge Blick der Dame traf. Marie fühlte sich an die schmerzhaften Rügen ihrer Großmutter erinnert, Wut brandete in ihr auf, und noch bevor sie wusste, was sie tat, sagte sie: »Ich war es, ich bin auf den Saum getreten, es tut mir leid.« Die Frau ließ von Laure ab, das Mädchen warf Marie einen überraschten Blick zu. Curtius sah Marie mit aufgerissenen Augen an, seine Finger bildeten eine Faust und öffneten sich dann krampfhaft wieder.
»Hätte ich gewusst, wie ungeschickt du bist, ich hätte dich bei deiner Mutter gelassen, damit du weiter Staub kehren kannst«, sagte er aufgebracht. Langsam, den ramponierten Saum wie eine Kostbarkeit erhoben, folgte sie ihm auf dem Weg zurück ins Kabinett.
Curtius schob Marie schweigend in die Küche und schloss die Tür hinter ihr. Wenig später kam Anna herein, in der Hand trug sie das Kleid. Sie legte es vorsichtig auf den Tisch und kniete sich neben Marie auf den Fußboden.
»Ach Mariechen, ich dachte, du wüsstest, was dieser Tag deinem Onkel bedeutet, wie wichtig er ist – auch für uns«, sagte sie leise. »Du bist doch sonst nicht so tollpatschig. Wie ist das nur passiert?« Marie biss sich auf die Lippen, schüttelte trotzig den Kopf.
»Na gut. Wir müssen das Kleid wieder herrichten, so gut es geht. Denn wenn die Besucher in der Wachsfigur mit diesem schönen Kleid die feine Dame wiedererkennen, die Doktor Curtius porträtiert hat, dann werden sie vielleicht auch ein so gelungenes Abbild bei ihm in Auftrag geben.« Anna zog ihren Nähkorb unter der Bank hervor. Marie stand auf und legte das Kleid zurecht.
»Ich möchte helfen. Das Kleid soll wieder so schön werden, wie es vorher war«, sagte sie. Anna nickte. Gemeinsam nähten sie den Saum wieder an. Als sie zufrieden waren, nahm Anna das Kleid und schickte sich an, die Küche zu verlassen.
»Am besten bleibst du heute hier. Ich möchte nicht, dass der Doktor sich aufregt, wenn er dich sieht. Du kannst dir ja die Wäsche vornehmen, die geflickt werden muss, dann wird dir die Zeit nicht so lang«, sagte sie zu ihrer Tochter.
Marie holte die Wäsche und legte sie neben sich auf die Bank. Stück für Stück nahm sie sich die Kleidung vor. Gelegentlich kamen ihre Mutter oder die für die Ausstellung engagierten Dienstboten in die Küche, um etwas zu holen. Dann drangen lebhafte Gesprächsfetzen oder Gelächter in den Raum. Niemand nahm sich jedoch die Zeit, Marie zu berichten, was in den Sälen vor sich ging. Sie fühlte sich ausgeschlossen. Die Geräusche ließen ihre Fantasie Kreise ziehen. Sie malte sich aus, welche hohen Herrschaften durch die Räume flanierten und wie Curtius mitten unter ihnen stand und mit ihnen plauderte – als Gleicher unter Gleichen, geachtet und geehrt. Dieser Glanz würde wohl nie auf sie fallen. Der Doktor würde sie vermutlich nie wieder mitnehmen. Marie legte das letzte Hemd zusammen. Im Palast war es ruhig geworden. Sie fühlte sich müde und einsam. Wenn ihr Vater nur da wäre! Dann wären sie glücklich, wie früher. Marie hörte ihre Mutter lachen. Groll stieg in ihr auf. Sie faltete das Hemd, legte es auf den Haufen und rollte sich auf der Bank zusammen. Sollten die anderen doch feiern, sie wollte gar nicht mehr dabei sein.