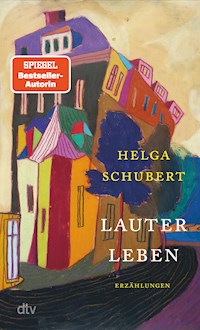9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Was nicht hier ist, ist nirgends." In der Schweriner Nervenklinik werden 1941 im Rahmen nationalsozialistischer Euthanasie 179 Patienten als "lebensunwert" ermordet. Ihre Akten bleiben auch nach dem Ende der Nazizeit unter Verschluss – im Ministerium für Staatssicherheit der DDR –, bis sie nach der Wende 1990 ins Berliner Bundesarchiv gelangen, wo Helga Schubert sie auswertet. Entstanden ist keine historische Studie, sondern ein bewegendes und einzigartiges Stück Literatur: In ›Die Welt da drinnen‹ erzählt Helga Schubert von der Innenwelt der "Wahnsinnigen" und der wahnsinnigen Außenwelt ihrer Ärzte und Pfleger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Helga Schubert
Die Welt da drinnen
Eine deutsche Nervenklinik und der Wahn vom unwerten Leben
Mit einem Vorwort der Autorin
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Vorwort
Dies ist das zweite Buch, das ich über die Gefahr einer geschlossenen Gesellschaft schrieb. Über die Gefahr für jeden einzelnen Menschen, der darin leben und zurechtkommen muss. Über die Gefahr, zum Mörder zu werden oder ermordet zu werden. Im weitesten Sinne.
Auch über die Gefahr, in seiner Seele ermordet zu werden oder andere Menschen in ihrer Seele zu ermorden.
Das erste Buch, es hieß Judasfrauen, schrieb ich vor 1989, noch in einer Zeit, als ich selbst in einer geschlossenen Gesellschaft lebte, in der DDR. Ich erzählte darin Schicksale, die ich in Akten westdeutscher Nachkriegsverfahren gegen Denunziantinnen in Nazideutschland fand. Wegen der vielen Parallelen in der Angst vor dem Geheimdienst erschien es in der DDR erst wenige Wochen vor der Wiedervereinigung Deutschlands.
Dieses zweite Buch über die Gefahren einer geschlossenen Gesellschaft erschien 2003. Ich brauchte jetzt nicht verschlüsselt die totalitäre Gesellschaft anzuklagen. Ich konnte nun offen vor ihr warnen. Das letzte Kapitel dieses Buchs erzählt von einer Lesung in einem Berliner Gymnasium, bei der sich die Schüler die Hierarchien in einer Diktatur vorstellen sollten: Wenn ich jetzt als Beamter 1939 am Beginn des Zweiten Weltkrieges in der Berliner Euthanasiezentrale Hitlers Wunsch (auf einem Zettel) umsetzen müsste, lebensunwertes Leben zu vernichten. Wie komme ich an die potenziellen Opfer, und wie organisiere ich ihre Vernichtung?
Für die Schüler war es unvorstellbar, wie leicht man die furchtbarsten Ideen in einer Diktatur realisieren kann, in der die Presseveröffentlichungen zentral überwacht werden, das Rundfunkhören sogenannter feindlicher Sender unter Strafe steht, das Weiterverbreiten ihrer Nachrichten mit dem Tode bestraft wird. Anzeigen wegen verdächtiger Todesfälle von Behinderten in Krankenhäusern werden von der Polizei nicht angenommen, also nicht verfolgt, Gerichte sind nicht unabhängig, kurz, die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Es droht keine Bestrafung, und die Presse darf nicht berichten, das Parlament darf keine Gesetzesvorlagen offen diskutieren, alles, was man so im Geschichtsunterricht lernt. Wenn es konkret wird, ist es grauenhaft.
Die Welt da drinnen ist die Welt in einer deutschen Nervenheilanstalt.
Es ist aber auch die Welt in einer geschlossenen Gesellschaft um diese Nervenheilanstalt herum, der Diktatur der Nationalsozialisten in Deutschland, außerhalb der geschlossenen Psychiatrie. Es ist die Welt, in der ich nicht lebte und die ich aus Krankenakten kennenlernte.
Unbekannt waren mir die Psychiatrie und ihre Patienten nicht, denn ich habe viele Jahre mit ihnen in meiner Arbeit zu tun gehabt. Ich habe sie festgeschnallt bei Elektroschocks gesehen, wenn sie gekrampft haben, der Narkosearzt daneben, der ihren Kreislauf überwachte. Ich habe sie bis auf die Knochen abgemagert gesehen, wenn sie eine Magersucht hatten.
Ich habe sie halluzinieren gesehen und auf dem Boden des Wartezimmers in der Nervenklinik, wenn sie einen epileptischen Anfall hatten. Ich habe nach etwas Weichem gesucht, damit sie sich nicht auf die Zunge beißen. Die Menschen, die ich für dieses Buch in Krankenakten fand und die alle umgebracht wurden, sind mir nah. Auch mich hätten Angehörige vielleicht resigniert aufgegeben. Und die beteiligten Ärzte und Pflegerinnen? Ich hätte in der Nervenklinik ihre Kollegin sein können. Ich hätte selbst zur Täterin werden können.
Unser politischer Verstand schütze uns vor einer Schwächung der offenen Gesellschaft, vor ihrer Verhöhnung.
Die offene Gesellschaft schützt uns vor allem Hasserfüllten in uns selbst. Auch vor Übergriffen des Staates und vor Übergriffen anderer Menschen. Manchmal dauert es, aber Verbrechen kommen heraus, sie werden bestraft, und es wird darüber berichtet.
Jede Diktatur hat ein Ende. Ihre Unmenschlichkeit ist wie ein Krebs. Sie zerfrisst von innen.
Wir sind nicht ausgeliefert wie die Menschen in diesem Buch.
Neu Meteln im Sommer 2021 Helga Schubert
Eine Mörderanstalt
Das ist hier ja eine Mörderanstalt, hätte er damals im März 1941, kurz vor Antritt seines Jahresurlaubs, zu seinem Vorgesetzten, dem Oberarzt Dr. Alfred L., gesagt.
Jedenfalls bezeugte er das zwölf Jahre später vor dem Kölner Gericht, das gegen Dr. Alfred L. wegen Beihilfe zum Totschlag verhandelte.
Schon seit Ende 1940 hatte er, der Assistenzarzt Dr. Bra., nämlich Beobachtungen gemacht, nach denen er annehmen musste, dass der Angesprochene an den gemeinsam behandelten Patienten Tötungen durch Verabfolgung überdosierter Schlafmittel vornahm.
Dr. Bra. teilte sich mit Dr. Alfred L. (und außerdem auch noch mit Dr. M. und Dr. B.) die Betreuung der Pflegehäuser für die in der Anstalt lebenden Geisteskranken. Diese Patienten wurden oft schon viele Jahre, nach ihrem Geschlecht getrennt, in der Anstalt verwahrt. Ihre Diagnose stand fest. Sie galten als unheilbar.
Die nicht so schwer Erkrankten, die eventuell auch wieder hätten entlassen werden können, und diejenigen, bei denen die Diagnose noch nicht feststand, die also von den Ärzten noch beobachtet werden sollten, lagen in den Aufnahmehäusern.
Besorgt um das Leben ihrer Patienten äußerten sich 1941 auch noch die beiden anderen betreuenden Nervenärzte in den Pflegehäusern: Der eine hatte den Verdacht, dass Dr. Alfred L. Todesursachen auf den Totenscheinen fälschte, und sagte es ihm ins Gesicht. Zudem stellte er Nachforschungen im Sterbebuch und auch bei den Pflegern über die Dosis der von Dr. Alfred L. verordneten Medikamente an.
Der andere Arzt bat aus Angst, in irgendeiner Weise an der Tötung der eigenen Patienten mitwirken zu müssen, um Versetzung auf eine Seuchenstation außerhalb der Anstalt.
Oberarzt Dr. Alfred L. war damals, im Jahre 1941, einundvierzig Jahre alt (er ging also mit dem Jahrhundert). Er, der im Gegensatz zu all seinen Kollegen aus einer Arbeiterfamilie kam, hatte sich durch einen aufmerksamen Lehrer, die Zustimmung seiner Eltern, Fleiß und finanzielles Glück nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik an verschiedenen Universitäten eine qualifizierte medizinische Ausbildung erworben und wurde als überzeugter Nationalsozialist auch kompromissloser Anhänger der Idee, lebensunwertes Leben zu vernichten. Jedenfalls mussten das seine Kollegen damals aus seinen Äußerungen schließen, wie sie übereinstimmend 1953 vor dem Kölner Gericht aussagten. Außerdem war er seit 1933 auch noch für Personalfragen in der Anstalt zuständig, was seine Macht erhöhte.
Dr. Alfred L. schwieg zunächst, was den Verdacht seines Assistenzarztes Dr. Bra. betraf, zumal das Wort Mörderanstalt ohne weitere Zeugen gefallen war, und antwortete ihm erst nach dessen Jahresurlaub Ende Mai 1941.
Da nämlich von der Berliner Euthanasie-Zentrale noch Tötungen in viel größerem Umfang geplant waren – ganze Busse voller Kranker waren zu erwarten –, sollte man sich lieber nicht mit der Kritik an einzelnen Schlafmittelvergiftungen aufhalten, dachte Oberarzt Dr. Alfred L. vielleicht.
Da musste jede Unruhestiftung vermieden werden.
Aus der Luft gegriffen hatte Dr. Bra. seinen Verdacht allerdings nicht, denn am Jahresende lebte von den Patienten der Anstalt nur noch etwas mehr als die Hälfte: Im Jahre 1941 waren nämlich zusätzlich zu den 617 Menschen, die am Jahresbeginn von der Schweriner Anstalt als Patienten geführt wurden, im Laufe des Jahres noch 549 aufgenommen worden.
Von den insgesamt 1166 stationär Behandelten starben 491, und zwar 216 direkt in der Anstalt und die anderen 275 in der Tötungsanstalt Bernburg: Diese wurden mit zwei Bustransporten am 18. Juli und am 1. August dorthin verlegt und noch am selben Tag vergiftet.
Mitgift
Falls Sie dieses Buch eventuell »Wer leben darf« nennen wollen, dann sollten Sie ihm auf jeden Fall den Untertitel »Wer nicht sterben darf« geben, riet mir ein Arzt in einer Gruppe von Intensivmedizinern, die mich zu einer Lesung eingeladen hatten.
Sie dürfen nicht einen einzigen Arzt irritieren, der heutzutage einem Todkranken starke Schmerzmittel gibt und dabei dessen Kreislaufversagen in Kauf nimmt. Das ist eine solche Gratwanderung, gerade in Deutschland: Eben weil die Nazis ihren Mord an Kranken auch Euthanasie nannten, ausgerechnet Euthanasie. Dabei war doch in der griechischen Antike damit der schöne, leichte Tod gemeint, ohne äußere Einwirkung.
Es ist in diesem Land schwer und missverständlich, über Hilfe beim Sterben zu sprechen. Aber Sie müssen an die Angehörigen der Todkranken mit unbeherrschbaren Schmerzen denken und auch an die armen Sterbewilligen selbst am Ende ihres Lebens. Sie müssen an das Ungeborene denken, das behindert wäre, wenn es zur Welt käme, und an seine Eltern, die das gerade erfahren haben. Sie müssen an den Vater oder die Mutter denken, die ganz allein sind mit ihrem Kummer und ihrer Scham, dass sie ihrem erwachsenen schwerstbehinderten Kind den baldigen Tod wünschen, weil sie sich selbst bald nicht mehr allein um den gemeinsamen Haushalt kümmern können. Sie müssen an die Ärztin denken, die am Bett des Koma-Patienten steht und weiß, dass zwar manche nach langer Zeit und mit schweren Hirnschäden doch aufwachen, aber viele nie mehr zu Bewusstsein kommen. Sie müssen an die Staatsanwälte denken, die nach einer Tötung auf Verlangen Anklage erheben, und die Richter, die solche Angeklagten verurteilen müssten. Sie müssen an die Parlamentsabgeordneten denken, die die deutsche Gesetzgebung zur Sterbehilfe mit der anderer Länder vergleichen und das Tabu spüren.
Wenn du in deinem Buch die Euthanasie der Nazis beschreibst, sagte Katja, die sogenannte Euthanasie wohlgemerkt, dann solltest du auch die Klinik, von der du nun zufällig solche Krankenakten gefunden hast, nicht mit ihrem wirklichen Namen nennen. Damit haben die doch überhaupt nichts mehr zu tun, und jetzt bekommen die ein Stigma verpasst. Wenn ich dort arbeiten müsste, ich würde mich zu Tode schämen. Dabei wäre ich doch unschuldig. Ich würde nie an einer aktiven Tötung mitwirken, denn man kann jeden Schmerz bekämpfen, und ich würde auch nie eine Curettage durchführen. Dazu bin ich nicht Ärztin geworden. In Zukunft wird es überhaupt kein Tabu mehr sein, kranke Alte zur Lebensverkürzung aufzufordern. Was willst du noch auf dieser Welt, werden die jungen Gesunden fragen. Du wirst es noch erleben.
Und Tine sagte: Du, das ist eine unendliche Geschichte, die du mit dem Buch vorhast, denn es werden immer neue Gesichtspunkte dazukommen, man wird neue Medikamente gegen Geisteskrankheiten entwickeln, es werden immer neue Akten Ermordeter auftauchen, du wirst immer neue Geschichten von Angehörigen und Geretteten hören, und mit der Diktatur wirst du nie fertig werden. Das ist doch dein Thema, du weißt genug, hör einfach auf, du wirst sehen, das Buch ist fertig. Meine Freundin Tine, die Architektin, liebt Menschen und alte Häuser. Sie gibt sie nicht auf. Wo sie ist, schafft sie Wärme, wo sie arbeitet, Durchblicke. Und oft füllt sich der mittlere Raum in ihrem Haus mit Mann und ihren drei erwachsenen Söhnen und Freundinnen und Freunden der Söhne mit ihren Freundinnen und Freunden und ihren Kindern, mit Schwester und Mutter und Schwiegermutter, mit Hund und Katzen und Blumen und Käsekuchen. Alle kommen sie, rühren sich etwas an und sehen nach, ob noch etwas Tee da ist. Und dann wärmen wir uns alle gegenseitig ein wenig auf.
Vor dem Einschlafen in der Nacht zu heute dachte ich über den Titel und ein mögliches Motto für dieses Buch nach. Wie ein zweites Thema beeinflusst das Motto die Stimmung beim Schreiben und legt die Tonart fest, aber das wiederum nur in der Spannung zum Titel.
Wie sollte ich das Buch nennen? Ausflug ins Gas. Die Welt da drinnen. Das Tor zur Hölle. Euthanasie-Euthanasie. Die Perlkönigin und die Nachtigall. Ein Grab in den Wolken. Gnadenmord. Versuchte Einfühlung in die Gewährung des Gnadentodes. »Ich doch dein liebe Frau.« Mörderanstalt. Vom guten sanften Tod. Wer leben darf.
Der Erwartung einer reinen Dokumentation, wie sie etwa durch den Titel »Wer leben darf« hervorgerufen wird, könnte durch das Motto »Dann habt ihr ein Grab in den Wolken/ Da liegt man nicht eng« aus Celans Todesfuge begegnet werden. Aber diese Zeilen würden wohl eher an jüdische Opfer denken lassen; dabei berichte ich ja in diesem Buch ausschließlich von nichtjüdischen Geisteskranken. Wenn ich Pasolinis Stoßseufzer »Es hilft nichts, man muss eine Geschichte erzählen« als Motto nehme, dann wäre das eine Mahnung, wirklich Menschengeschichten zu schreiben, und auch ein Versprechen an den Leser, keine Abhandlung durcharbeiten zu müssen. Gedruckt auf der ersten leeren Innenseite, wäre es eine Demutsgeste, so eine kleine angedeutete Resignation, es würde dem Leser die Bedenken nehmen, ungeschützt in ein bedrohliches Gedankengebäude genötigt zu werden. Man könnte aber denken, dass ich eigentlich gar nicht erzählen und hinterrücks doch Argumente hineinschmuggeln will.
Wenn ich aber Dürrenmatts Gedicht aus seinem Nachlass als Motto nehme: »… die Welt da draußen ist ungewiss. Sie gehört nicht mir, ist eine unbegreifliche Gnade oder auch ein böser Fluch. Wer kann das wissen: Auf alles gefasst sein …«, dann verbreitet sich eine dunkle Bedrohung, ein Schatten bis in die Gegenwart hinein. Womöglich überliest man die unbegreifliche Gnade und denkt nur an den bösen Fluch.
Hilde Domins Zeilen aus ihrem Gedicht »Der Baum blüht trotzdem« gingen vielleicht aus einem ähnlichen Grund nicht: »Niemand kann es glauben: Auch an blauen Tagen/ bricht das Herz.« Da ist vom Einbruch des Todes oder von plötzlicher Verzweiflung mitten in Schönheit und Leichtigkeit die Rede und nicht von dem Räderwerk der Diktatur, das ich doch schildern will.
Gleichgültigkeit gegen Unrecht ist das Tor zur Hölle, diesen Leitsatz der Vereinigung »Ärzte ohne Grenzen« zog ich auch in Betracht. Er würde sich aber zu sehr gegen die vermeintlich unbeteiligten Zuschauer der damaligen Euthanasie-Aktion richten.
»Wer nicht gehorchen will, will zumeist auch nicht befehlen, und wer befehlen will, hat zumeist auch nicht viel gegen das Gehorchen einzuwenden«, von Hannah Arendt in ihrem Essay »Macht und Gewalt« geschrieben, ist für eine erzählende Arbeit heutzutage einfach zu klar.
Es geht eigentlich nur etwas Ironisches. Ich werde doch diesen Satz von Thomas Bernhard nehmen, beschloss ich im wohligen Wegdämmern: »Bis heute weiß niemand, wer ihn ermordet hat, denn niemand hat auch nur den geringsten Verdacht gegen einen anderen oder sich selbst.«
Das ist genügend kafkaesk, ja, das passt, dachte ich und schlief ein.
Der anschließende Traum war dann ziemlich unverschlüsselt: Ich stand in einer größeren Gesellschaft, in der wir alle schon etwas vom kalten Buffet gekostet hatten. Mit einem Mal wusste ich, dass Zyankali im Essen ist und dass wir alle daran sterben werden. Ich hatte es hineingetan, fiel mir ein. Aber warum? Weder wollte ich Selbstmord begehen noch irgendjemand anderen umbringen. Die Lage war aber eindeutig. Und auch nicht zu ändern. Sollte ich es den anderen sagen? Sie unterhielten sich so unbeschwert. Auch ich musste sterben. Ich wusste, es gab kein Gegengift. Auch wenn jedem sofort der Magen ausgepumpt worden wäre, hätte niemand mehr gerettet werden können. War ich abgelenkt gewesen, mit den Gedanken woanders, wie so oft? Und wieso fiel es mir jetzt erst ein, wo es zu spät war? Wie schade, dass das Leben schon vorbei sein sollte. Ich fand die Lage vollkommen absurd, denn ich war schuld am Tod all dieser Menschen, die ich zum Teil gar nicht kannte, noch nie gesehen hatte. Alle waren arglos. Ich warnte sie nicht.
Ich wachte mitten in der Nacht auf und war unheimlich erleichtert – unheimlich ist hier das richtige Wort. Nur nicht weiterträumen, dachte ich.
Darum stand ich auf, trank etwas Saft, ging im Wohnzimmer umher und dachte: Es sind nur kombinierte Erinnerungsfetzen, kein Wunder, wenn ich mich jahrelang mit Giftmord und Selektion beschäftige.
Ein Zettel
Rückdatiert auf den 1. September 1939, den Beginn des Zweiten Weltkriegs, galt ein Geheimerlass Hitlers, der das Töten von Menschen erlaubte. Dieser Geheimerlass stammte vom Oktober 1939, trug im Briefkopf nur das Hoheitszeichen der NSDAP, war also kein Gesetz, und bestand aus einem einzigen Satz auf einem Zettel:
Adolf Hitler
Berlin, den 1. September 1939
Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann.
Dieser Zettel war die einzige Grundlage für die geheime Tötung von Geisteskranken und behinderten Kindern in deutschen psychiatrischen Kliniken. Diesem Erlass fielen bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 100 000 Erwachsene und 5000 Kinder zum Opfer. Dabei arbeiteten Ärzte, Pfleger, Schwestern, Fürsorgerinnen, Sachbearbeiter, Gutachter, Transporteure, Kraftfahrer, Standesbeamte, Reinigungskräfte, Parteifunktionäre, Geheimdienstmitarbeiter und Krematoriumsbedienstete in genau bestimmter Rollenverteilung zusammen.
Vor Gericht
Dass am 16. August 1946 drei Stationspfleger und eine Stationsschwester der Schweriner Nervenklinik am Sachsenberg wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit in der sowjetischen Besatzungszone zum Tode verurteilt wurden, dagegen ihr geflohener Vorgesetzter Oberarzt Dr. Alfred L., auf dessen Anweisung sie viele ihrer Patienten noch bis zum Ende des Krieges ermordet hatten, 1953 im westdeutschen Köln nach einer Anklage wegen Beihilfe zum Totschlag mit einem Freispruch davonkam, hätte in den Gegenwartskunde-Unterricht der DDR gepasst.
Die Lehrerin hätte vermutlich gesagt: Seht ihr, das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass in der sowjetischen Besatzungszone und danach in unserer antifaschistischen Deutschen Demokratischen Republik die Naziverbrecher bestraft wurden und in der BRD nicht.
Aber was würde sie mir heute auf die Frage antworten, warum bis zum Ende der DDR die Akten der ermordeten Schweriner Patienten unter Verschluss waren und 179 davon erst im Jahre 1990 bei der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit zum Vorschein kamen: Akten selektierter Menschen, nach Bernburg transportiert und dort mit Kohlenmonoxid vergiftet. Unter Verschluss von 1941 bis 1990.
Nachfrage und Auskunft
Wie viel einzelne Schicksale getöteter Geisteskranker könntet ihr in einem Buch aushalten, habe ich ein paar Leute gefragt. Fünf, hat Katja geantwortet.
Höchstens zehn, antwortete Hannes.
Zwölf, sagte die Literaturredakteurin einer Zweiwochenzeitschrift, und dann möglichst in einem Rhythmus angeordnet mit den Geschichten der Täter.
Nicht mehr, aber möglichst auch nicht weniger als 200 Seiten, empfahl mir der Verlagslektor.
Ob ich so etwas lesen, mir so etwas antun werde, weiß ich noch nicht, war die Antwort einer Lehrerin.
Diesem Buch zugrunde liegen die Patientenakten von 179 Menschen aus der Schweriner Nervenklinik auf dem Sachsenberg, die man geisteskrank, wahnsinnig oder verrückt nannte, die im Sprachgebrauch der deutschen Nationalsozialisten lebensunwert waren und darum 1941 im Rahmen der geheimen T4-Aktion (in der Berliner Tiergartenstraße 4 befand sich die Organisationszentrale der sogenannten Euthanasie) ermordet wurden – nur ein kleiner Teil der vermuteten 100 000 Opfer im Deutschen Reich. Die Akten der Schweriner Patienten habe ich im Bundesarchiv in Berlin gelesen, 57 Jahre nach dem Sommer 1941, als sie alle, verlegt in eine andere Anstalt, so die gleichlautende unbestimmte letzte ärztliche Eintragung in jeder ihrer Akten, auf einmal sterben mussten, gleich nach ihrer Ankunft, in einer zu einer Gaskammer umgebauten Dusche des Krankenhauses Bernburg in Sachsen-Anhalt.
Diesen Menschen gemeinsam ist, dass ihre Kinder, Enkel, Urenkel noch heute denken, ihr Vater, ihre Mutter, ihre Großmutter, ihr Urgroßvater wären in der Nervenklinik damals 1941 eines natürlichen Todes gestorben, denn so stand es ja in dem Brief eines Arztes und auf dem Totenschein vom Standesamt. Die Welt da drinnen meint aber nicht nur die Innenwelt der ermordeten Patienten dieser ersten Irren- und Wirren-Anstalt Deutschlands, sondern auch die ihrer Ärzte, Pfleger und Schwestern, wie sie aus den Personal- und Gerichtsunterlagen bruchstückhaft zu erkennen sind.
Nichts aber kann ich von den Menschen sagen, die weiterleben durften, denn ich habe ja nur die Akten der Ermordeten gelesen. Vielleicht, versprach ein Mitarbeiter der Schweriner Nervenheilanstalt, gäbe er mir einmal die Akten solcher Überlebenden zum Lesen. Aber anonymisiert wegen des Datenschutzes, nicht so ungeschwärzt, wie ich sie im Bundesarchiv lesen durfte. Es müsse zum Beispiel unmöglich sein, eine Namensliste der Opfer ins Internet zu stellen und so deren Nachkommen zu gefährden. Denn man könnte, sagte er, wenn man immer noch Anhänger dieses Gedankenguts sei, die Angehörigen, die ja dieses Erbgut hätten, zu beseitigen versuchen oder zumindest zu erfassen.
Im Oktober 1998 beschloss ich, mit dem Aktenlesen aufzuhören und darauf zu vertrauen, dass nach einer kleinen Ruhepause Einzelne aus meinen Mitschriften und meiner Erinnerung hervortreten und von mir ganz einfach verlangen würden, dass ich ihr Schicksal erzählte.
Die Personen der Handlung
200 Seiten habt ihr Raum, teilt euch die Seiten.
Ihr habt jahrelang in großen Schlafsälen zusammengelegen, ihr habt in Arbeitskolonnen geschuftet, zusammen Kartoffeln geschält, Gemüse geputzt, die schweren Essenskübel transportiert, ihr habt zusammen gegessen und abgewaschen, ihr habt euch gestritten und gegenseitig geholfen, habt in der Besuchszeit auf eure Familie gehofft und euch Fotos gezeigt, ihr habt zusammen stundenlang im Transportbus mit zugezogenen Vorhängen gesessen am 18. Juli oder am 1. August 1941, und ihr habt zusammen barfuß auf den weißen Fliesen gestanden im Männerhaus II in der Bernburger Klinik. Dann seid ihr übereinander zusammengesunken, bewusstlos. Vielleicht hat manch einer von euch gedacht oder den andern laut zugerufen: Das habe ich schon immer befürchtet, dass ich einmal hinterrücks getötet werde. Nun ist es so weit.
Die übrigen Seiten sollten die bekommen, die euch betreuten und behandelten, die euch wuschen und pflegten, wenn ihr Fieber hattet, die euch Beruhigungsspritzen gaben, damit ihr einmal eine Nacht durchschlafen konntet, denen ihr manchmal aus Panik die Kittel zerrissen habt und vor Wut die Haare büschelweise auszureißen versuchtet, denen ihr von eurer Kindheit erzählt habt und von euren Männern und Frauen, von euren furchterregenden Stimmen im Kopf und eurer Angst, die alles von euch erfahren hatten in den Jahrzehnten der Anstaltsbehandlung, die immer da waren, tagsüber und in Nachtbereitschaft, die gewissenhaft erst die Erbgesundheitsbögen und dann die Meldebögen für die Euthanasie-Zentrale ausfüllten und euch dann, als die Anweisung dazu kam, für den Transport fertig machten, die eure Angehörigen über eure wahren Todesumstände belogen, die andere Kranke sogar eigenhändig töteten, deshalb nach dem Krieg Selbstmord begingen, flohen oder vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt, später zu lebenslanger Haft begnadigt oder freigesprochen wurden.
Perlkönigin und Nattergallen – Der Haken über dem u
Alwine, die Perlkönigin, erlitt am 24. Februar 1940 einen Ohnmachtsanfall. Bei einer Körpertemperatur von 38° fieberte sie. Der herbeigerufene diensthabende Psychiater vermutete eine Influenza. Er unterzeichnete diese Eintragung in ihrer Krankenakte aber nicht mit seinem Namen. Bis auf eine einzige Ausnahme in all den 178 anderen Krankenakten aus der Heil- und Pflegeanstalt auf dem Schweriner Sachsenberg, die ich gelesen hatte, tat das auch keiner seiner Kollegen.
Aber ich erkannte diesen Arzt trotzdem wieder. Denn er machte als Einziger seine Eintragungen in lateinischen Buchstaben und setzte dabei einen Haken über das u. Da gehörte der Haken aber nicht hin. Denn der u-Haken gehört zur alten Sütterlinschrift. (Wir, in der ersten Schulklasse gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sechs Jahre nach diesem Ohnmachtsanfall, erlernten noch ein paar Wochen lang diese Schrift.)
Er wollte vielleicht modern sein und hing doch an dem früh Erlernten, dachte ich: Da machte er auch einen Haken über dem u der Influenza. So konnte ich diesen Arzt mit dem überflüssigen u-Haken in den Krankenakten von seinen Kollegen unterscheiden, aber nur, wenn ein Wort mit u im Satz vorkam.
Ein zweiter Arzt dagegen unterschied sich deutlich von seinen anderen Kollegen, und ich freute mich schon, wenn ich seine Schrift beim Umblättern der Aktenseite entdeckte, denn er verfasste seine Bemerkungen in winzigen Sütterlin-Arabesken mit dünner Feder, wie in einer Geheimschrift. Nie machte er einen Klecks, und jedes Mal lohnte es sich, seine Grafiken genau zu entziffern: Es waren oft menschenfreundliche Entdeckungen in der fremden Welt seiner ihm anvertrauten verwirrten Patienten. Seine Girlandenzeilen taten mir gut, denn er versuchte, das ihm Unverständliche zu beschreiben und seine Patienten als Schwerkranke zu sehen. Nie las ich bei ihm von Unbrauchbaren, blöde Glotzenden oder Keifenden.
Ein dritter Arzt schrieb in unauffälliger Sütterlinschrift, in jede Akte nur ein paar Wörter, Jahr für Jahr, nur die notwendigsten Mitteilungen: Zerreißt. Schlägt. Ruhiger. Verlegt in Einzelzelle. Hyoscin (er gab bei diesem Medikament die genaue Dosis an). Er machte ebenfalls einen u-Haken, aber der gehörte ja auch zur Sütterlinschrift.
Ein vierter Arzt schrieb ähnlich wie der erste in lateinischen Buchstaben, machte aber keinen u-Haken. Er hatte sich als Einziger ganz auf die neue Schrift eingestellt. Auch als es um Leben und Tod ging, als man nämlich in der Berliner Euthanasie-Zentrale über die Meldebögen schon Bescheid bekommen hatte, dass ein bestimmter Patient nicht mehr arbeiten konnte oder eine Patientin apathisch im Bett lag, und die anderen Ärzte mit u-Haken, Girlanden und sachlichen Kurzwörtern noch etwas Gutes von den bald womöglich als lebensunwert Herausgesuchten berichteten, also von der Hilfsbereitschaft eines schizophrenen Patienten, von seinen militärischen Grüßen, seiner Freundlichkeit und Zuverlässigkeit, oder zumindest von seiner Insichgekehrtheit, dann schrieb dieser vierte Arzt ohne u-Haken: Zu nichts zu gebrauchen, unbrauchbar.
Seine Schrift fand ich in roter Tinte neben jahrzehntealten Eintragungen früherer Ärzte. Deren damalige Aufzeichnungen konnten für die Entscheidung zur Tötung wichtig sein: Denn wenn schon die Mutter Selbstmord in der Anstalt verübt hatte, sah dann nicht die Depression der Tochter, die jetzt auf der Station lag, nach einer ererbten Geisteskrankheit aus? Erblich? schrieb darum dieser vierte Arzt in roter Tintenschrift in die Anamnese von vor 20 Jahren, die, verfasst in ordentlicher Sütterlinschrift, am Anfang der Akte eingeheftet war.
Denn um das Erbliche und die familiäre Belastung und den gesunden Volkskörper ging es diesem Arzt wohl, ohne u-Haken bei den Wörtern »Belastung« und »gesunden«.
Alwines Fieber stieg zwei Tage später auf 39,1°. Der Arzt mit dem u-Haken hatte mit der Diagnose einer Influenza recht behalten. Nur mit der Jahreszahl in der Akte irrte er sich: Er trug seine Bemerkung noch unter dem Jahr 1939 ein. Vermutlich hatte er übersehen, dass seine Eintragung vom 24. Februar die erste über diese Patientin im Jahre 1940 war, dass also noch kein Arzt vor ihm etwas Mitteilenswertes an ihr gefunden hatte. Erst bei der nächsten Eintragung, der zweiten und letzten über sie in diesem Jahr, steht in einer ähnlichen Schrift die richtige Jahreszahl: 1940. »5.8.: Sehr verschroben, wird als Hoheit angeredet, brachte einen toten Vogel aus dem Garten, wollte ihn gebraten haben. Schwer beeinflussbar, leicht erregbar.«
Die u’s in »aus« und »beeinflussbar« standen nackt, ohne u-Haken, vor mir.
Als ich in der Krankenakte Alwines las, dass sie einen toten Vogel aus dem Garten der Anstalt hereingebracht hatte und ihn gebraten haben wollte, fast genau ein Jahr vor ihrem eigenen Tod, war mir unheimlich: Es war ja schon August 1940, bald begann das zweite Kriegsjahr. War sie so hungrig? Hielt sie den Vogel für eine Delikatesse? War es ein archaisches Symbol? Das Herz eines Vogels essen statt das Herz eines Menschen? Vermutlich hatte sie den Vogel schon tot gefunden, denn wenn sie ihn erst getötet hätte, wäre darüber in der Akte berichtet worden.
Ich stellte mir einen kleinen Vogel vor in ihren Händen. Einen kleinen Vogel. Denn einen großen Vogel, eine Taube, eine Krähe oder einen Raben hätte der Arzt in seiner Eintragung vielleicht näher bezeichnet. Kannte er den kleinen Sommervogel nicht? Oder wurde ihm der Vorfall nur erzählt, hielt er ihn für krankhaft und absonderlich und darum mitteilenswert? Ein Minuspunkt für Alwine. Denn er war ja der Arzt ohne u-Haken, der Mitleidlose.
Die Perlkönigin hatte vielleicht eine Nachtigall erkannt, eine kleine tote starre Unscheinbare, die sie sich einverleiben wollte. Ich nahm mir vor, das Andersen-Märchen von der Nachtigall an dieser Stelle aus meinem Kindergedächtnis nachzuerzählen. Da ganz genau gehörte es hin. Aber dann habe ich es doch vorher noch einmal gelesen. Zum Trösten. Denn Alwine, die Perlkönigin, ist ja auch ermordet worden. Ein Jahr später.
Gewundert habe ich mich dann doch, als ich beim Wiederlesen anfing zu weinen – fast ein ganzes Leben hatte ich seit dem ersten Erzähltbekommen gelebt – und gar nicht wieder aufhören konnte zu weinen. Nein, ich durfte mich nicht in die Kälte ziehen lassen, in den Ekel vor diesen Erbarmungswürdigen, sondern ich musste mich an die Girlanden in der Schrift halten, an das Erbarmen, die Heiterkeit, an das Angerührtsein vom Leben in seiner ganzen Verrücktheit.
Und ich war erleichtert, dass meine Tränen zu mir zurückgekommen waren wie die Nachtigall zu dem chinesischen Kaiser, denn in den letzten Monaten musste ich mir künstliche Tränen in die Augen träufeln, so trocken waren sie geworden, so ohne Lidschlag erstarrt. Manchmal las und schrieb ich die ganze Zeit. Und so sehr brannten meine Augen.
Die Diener kamen herein, um nach ihrem toten Kaiser zu sehen – ja, da standen sie, und der Kaiser sagte: Guten Morgen! Das war der entscheidende Satz.
Der Kaiser kommt in der Überschrift des Märchens gar nicht vor; es ist allein das Märchen von der Nachtigall, der Nattergallen im Dänischen. Sie ist die Hauptperson. Von ihrem Gesang sind die Leute so beglückt, dass sie sich immer mit Nacht und Gall begrüßen, wenn sie sich treffen, weil ihnen vor Freude gar keine andere Begrüßung einfällt.
Die Märchen-Nachtigall nimmt nichts übel, weder die Gefangennahme im kaiserlichen Garten noch die Ausweisung aus dem kaiserlichen Reich, als sie schon daraus geflohen war, auch nicht die Zurücksetzung gegenüber der künstlichen Nachtigall, ihrer juwelenverzierten Nachbildung, die immer zur Verfügung stand und auch immer singen konnte, bis, ja, bis sie kaputtging. Erst als der Kaiser einsam und sterbenskrank in seinem Palast liegt und die Nachtigall davon erfährt, kommt sie zurückgeflogen, setzt sich vor sein Fenster, singt für ihn und rettet ihm damit sein Leben.
Und der Tod, der schon beim Kaiser am Sterbebett saß, gibt freiwillig alles zurück, was er ihm schon genommen hatte, nur weil er weiter ihrem sehnsuchtsvollen Gesang lauschen möchte.
Der Kaiser würde sie zwar ganz gern wieder einsperren lassen, aber sie möchte freiwillig kommen und wieder wegfliegen dürfen: Da will ich des Abends auf dem Zweige hier bei deinem Fenster sitzen und dir etwas vorsingen, damit du froh werden kannst und gedankenvoll zugleich. Ich werde von den Glücklichen singen und denen, die da leiden, verspricht sie ihm.
Der mächtige Kaiser von China muss wohl oder übel mit ihrer Bedingung einverstanden sein, ihr sogar versprechen, dass er niemand etwas von ihr erzählt, und wird noch in dieser Nacht ganz gesund. Und dann fliegt die Nachtigall wieder fort zu ihren grünen Wäldern.
Beim Lesen des Märchens in der Ausgabe der Dieterichschen Verlagsbuchhandlung von 1953 fiel mir zum ersten Mal eine Fußnote auf: Im Dänischen eignet sich das Wort für Nachtigall, also Nattergallen, für ein Wortspiel: Gall bedeutet nämlich verrückt.
Gall nimmt vier Buchstaben in der Nattergallen ein. In ihren übrigen Buchstaben ist nichts Verrücktes. Aber eine Nachtigall wird sie nur mit dem Verrückten in sich. Sonst wäre sie nur eine Nachti oder eine Natter. Und wer will die schon singen hören?
Alwine, die Perlkönigin, hatte in jungen Jahren draußen im normalen Leben als sehr begabt gegolten: Sie lernte leicht, hatte ein heiteres Temperament und wurde sogar Filialleiterin eines Modegeschäfts.
Als sie 22 Jahre alt war, verlobte sie sich. Aber dann wurde die Verlobung aufgelöst, und ein Jahr später war es aus. Vielleicht hatte der Verlobte ihre leichte Erregbarkeit nicht ertragen oder sich an ihren merkwürdigen Reden gestört? Seitdem war es mit ihr anders, wie sie selbst spürte.
Aber vier Jahre lang konnte sie noch arbeiten, allein in ihrer Wohnung leben und für sich sorgen.
Danach musste die inzwischen 27-Jährige ihre Arbeit aufgeben, und all ihre Versuche mit neuen Anstellungen schlugen nach kurzer Zeit fehl. In den nächsten vier Jahren, fast den ganzen Ersten Weltkrieg hindurch, bis zum April 1917, kümmerten sich eine ihrer Schwestern und deren Mann um sie, bis es auch zu Hause nicht mehr mit ihr ging und der Schwager die 31-jährige Alwine schließlich in der Nervenklinik vorstellte. Es war die Großherzogliche Heil- und Pflegeanstalt Geinsheim bei Rostock, in der der berühmte Professor Kleist arbeitete.
Alwine J. empfing den Aufnahmearzt in heiterer Stimmung und mit scherzhaften Bemerkungen an ihrem Bett. Sie erzählte ihm von ihren Erscheinungen und glaubte, es hätte sich ein Bund gegen sie gegründet, der sie verfolgte. Sie sei überhaupt alles, sagte sie dem Arzt, denn sie sei die Perlkönigin, trage das Christkind bei sich, und die ganze Welt verfolgte sie. Sie sei die Schneekönigin, Schneewittchen mit den goldenen Schuhen und auch eine verwunschene Prinzessin.
Eigentlich wollte sie ja Liebknecht heiraten, denn der werde die ganze Welt erlösen. Und Breiguste, grot Berta, Lüttwiese sei ihr Name. Breiguste ist der deutsche Michel, grot Berta sind die großen Taten, die wir errungen haben, und Lüttwiese ist die neue Zeitrechnung, die wir bekommen werden.
In Russland sollte in ein paar Monaten die Oktoberrevolution stattfinden.
Der Aufnahmearzt fragte Alwine nach dem Unterschied zwischen Fluss und Teich. Den wusste sie.
Dann sollte sie das Sprichwort »Morgenstund hat Gold im Mund« erklären: »Das sind die, die uns den Sieg schaffen.«
Dann fing Alwine wieder an zu singen, sich für die Vorgänge im Krankensaal zu interessieren und mit Worten zu spielen. Sie hörte Engelsstimmen, fühlte sich von ihnen hypnotisiert und hielt sie für die himmlischen Heerscharen. Aber sie wusste, wo sie sich befand, und kannte auch das Datum.
Zeitlich und örtlich orientiert, notierte darum der Aufnahmearzt. Außer der Erkrankung des Vaters an Epilepsie fand er keine familiäre Belastung mit Nervenkrankheiten. Außer ihr waren alle sieben Geschwister gesund.
Beim ersten Abendbrot warf Alwine den Krankenhausteller in den Saal und rief, sie sei doch Schneewittchen, sie müsse doch von einem goldenen Teller essen.
Vielleicht hatten Schwester und Schwager sie deshalb in ärztliche Behandlung gebracht, denn der Erste Weltkrieg dauerte schon das vierte Jahr.
In der ersten Nacht in der Klinik war sie außerordentlich unruhig, ganz besonders in den frühen Morgenstunden: Sie ging an andere Krankenbetten, riss die Kranken heraus und beschimpfte sie in derber Weise. Darum wurde sie in eine andere Abteilung verlegt.
Nach sieben Tagen in manischer Unruhe begann Alwine am achten Tag sehr zu weinen, denn sie wollte nicht mehr in der Anstalt bleiben.
Weitere fünf Tage vergingen.
Nach 12 Tagen erschien sie dem berichtführenden Arzt plötzlich sehr gereizt, ausfallend und schnippisch. Sie beklagte sich über ihn: Die Medizin und das Essen hätten sie schon krank gemacht. Der mache sie zusätzlich krank. Die Zustände in der Anstalt seien schlimm, sie wolle sie der Öffentlichkeit unterbreiten und müsse sofort einen Process führen.
Dann sang und lachte sie wieder eine ganze Woche lang, verneigte sich abwechselnd nach links und rechts, zog die Haare über das Gesicht, tänzelte in Menuettschritten hin und her, sang Redensarten nach bekannten Melodien und nahm von der Anwesenheit des Arztes keine Notiz.
Da sie immer aus dem Bett aufstehen wollte, verordnete er ihr ein Dauerbad. In dem war sie schwer zu halten.
Im Geschwindschritt durcheilte sie ihr Einzelzimmer, machte dabei mit den Füßen Wischbewegungen auf dem Boden und war oft ganz still dabei.
Einen Monat nach der Aufnahme hatte sie sich beruhigt, gab sich aber abweisend.
Der Arzt notierte: »Sie ist nicht mehr bettflüchtig, zeigt aber stereotype, bizarre Bewegungen der Hände. Ihre Stimmung wurde heiter, sie kokettiert und schmollt und ist bisweilen etwas gehemmt. Sonst aber reich an Bewegungen bizarrer Art.« Die Bewegungen, notierte der Arzt nach einem Monat, sind vollständig zurückgetreten, in ihren Reden bot sie nichts Auffallendes, auch keine Ideenflucht.
Sie konnte sogar über ihre unruhigste Zeit Auskunft geben: Es sei ihr wie im Traume gewesen, sie habe sich etwas besinnungslos dabei gefühlt und oft Flimmern vor den Augen gehabt. Dabei habe sie Engel gesehen, auch ihre Nichten und Hühner, ganz deutlich Tauben. Stimmen hätte sie aber keine gehört, nur immer Ohrensausen verspürt.
Bald erschien sie dem Arzt wieder gereizt und abweisend. Sie fühlte sich in der Anstalt tyrannisiert, erzählte aber gleich danach in heiterer Laune, dass sie über und neben sich Stimmen ihrer Verwandten gehört und sich mit ihnen unterhalten hätte: über Kultur, Politik, Völkerleben und Religion.
An den Bäumen im Park sehe sie Gestalten hängen, und alles würde von einem Scheinwerfer beleuchtet.
Ein paar Tage später berichtete Alwine dem Arzt, ihre Angehörigen hätten ihr bei einem Besuch erzählt, der Vater lebe wieder. Und der Vater sei auch da gewesen. Jetzt höre ich, das ist ihr so eingeimpft, hätte der Vater gesagt.
Der Herr Sanitätsrat wäre auch da gewesen.
Alwine glaubte, einige ihrer persönlichen Sachen in der Anstalt gesehen zu haben, die Wärterinnen zum Beispiel trügen ihre Strümpfe.
Es ist hier alles so zusammengehext, man weiß nicht, was eigentlich die Wahrheit ist.
Der Arzt fand ihren Gesichtsausdruck bei diesen Worten unnatürlich geziert.
Nach insgesamt acht Wochen geriet Alwine wieder in große Erregung und wurde deshalb in die Unruhigenabteilung verlegt. Dort fühlte sie sich durch die Oberin beeinflusst, schrie plötzlich auf und sprach laut durch den ganzen Saal. Sie fühlte sich aufgereizt: Es beginne mit Kopfschmerzen, das Gehirn dehne sich, oben werde der Schädel weich, und das Gehirn trete nach oben aus. Ein starker Brandgeruch belästige sie.
Am nächsten Tag verspürte Alwine an verschiedenen Körperstellen Schmerzen, war dann wieder heiter, sang viel und machte sich an ihren Haaren zu schaffen. In der Unterhaltung mit dem Arzt schien sie abzuschweifen und wiederholte oft einen Satz in englischer Sprache. Sie fand die Luft zu scharf und meinte, daher nicht atmen zu können. Zugleich drückte die Luft an ihren Hals – und sie zeigte dabei auf die Schilddrüsengegend –, sodass sie immer schlucken musste. Es lag ihr wie eine Kugel im Hals, klagte sie, das käme durch die Spielereien der Herren. Sie meinte die Ärzte.
Am 4. August 1917 (auf den Tag genau 81 Jahre später las ich ihre über Jahrzehnte verschlossene Krankenakte) war Alwine zeitweise sehr laut und in ihrer Stimmung meist heiter. Sie sang und kreischte. Man hätte ihr Krämpfe gemacht, rief sie, weil man sie an eine Kette gelegt und ihr den Mund versperrt hätte. Sie sei zum Wiederkäuer gemacht worden durch eine Medizin, und das ginge doch nicht. So viele Irrendörfer gebe es nicht. Sie sei durch Personal im Flur und durch elektrische Ströme, die von der Decke herabgefallen seien und gebrannt hätten, krank gemacht worden. Vielleicht sei das im Sinne der Dogmatik.
Hören Sie Stimmen?, fragte ein Arzt sie einmal.
Das werden Sie wohl besser wissen, antwortete sie ihm, was wollen Sie überhaupt hier? Sie sind mir gar nicht vorgestellt worden.
Am 8. September 1917, es war noch im Ersten Weltkrieg, blieb Alwine in heiterer Stimmung im Bett und erklärte sich für die Königin Luise geb. Alwine …
Am 9. Oktober 1917 wiederholte sie immer die gleichen Worte im gleichen Tonfall: Ich bin, ich bin, ich bin.