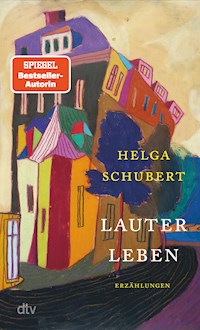19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vom Einverstandensein mit dem Leben – so, wie es ist »Es gibt immer einen Ausweg in eine Rettung, es gibt immer einen Übergang in eine vorher unsichtbare unvorstellbare Lösung.« Eine Frau flaniert in den frühen Achtzigerjahren nach Feierabend durch Ostberlin, weil sie einmal nicht als Erste zuhause sein möchte. In Moskau soll eine Schriftstellerin die Primaballerina Ulanowa portraitieren, wartet tagelang auf ein Treffen und erlebt dann Unverhofftes. Ein Kind atmet zum ersten Mal ein, eine Großmutter zum letzten Mal aus. Und eine Frau in den mittleren Jahren versucht, mit einer Krebsdiagnose umzugehen. Von Sehnsucht und Fernweh, von Diktatur und innerer Freiheit, vom Menschsein und Menschbleiben erzählen diese Geschichten. So treffsicher, so lakonisch kann nur Helga Schubert dem Leben auf den Grund gehen. »Helga Schubert ist eine Zuversichtsautorin.« Melanie Mühl, Frankfurter Allgemeine Zeitung »Leicht heißt nicht leichtgewichtig; das spürt man am nächsten Morgen, wenn die Sätze von Helga Schubert nachhallen.« Claudia Ingenhoven, hr2 »Die Ausbeute eines langen unbeugsamen Lebens. Anrührend und unverwechselbar.« Klara Obermüller, Neue Zürcher Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Es gibt immer einen Ausweg in eine Rettung, es gibt immer einen Übergang in eine vorher unsichtbare unvorstellbare Lösung.«
Aus einem Lebenszeitraum von 65 Jahren, von 1960 bis 2025, hat Helga Schubert in diesem Band Geschichten versammelt, die von Übergängen erzählen: von der Abhängigkeit als Kind in die Verantwortung für das eigene Leben, von den Übergängen in bisher ungewohnte Lebensformen, vom Übergang eines gesellschaftlichen Systems in eines, das man nur aus dem Fernsehgerät kannte. Und schließlich vom Übergang in die Unendlichkeit. Frühe Erzählungen stehen neben bisher unveröffentlichten Texten – einige erhielten in der DDR keine Druckgenehmigung – und neben neuen aus der Gegenwart. ›Luft zum Leben‹ gibt den Blick frei auf ein ostdeutsches Frauenleben im 20. und 21. Jahrhundert und auf eine Schriftstellerin, die nicht müde wird, ihre Stimme zu erheben.
Helga Schubert
Luft zum Leben
Geschichten vom Übergang
Ich fühle mich in der ganzen Welt zu Hause, wo es Wolken und Vögel und Menschentränen gibt.
Rosa Luxemburg
Vorwort
Ich bin schon so alt: 85, kann froh sein, morgens überhaupt wieder aufzuwachen.
Bin wirklich ein altes Schreibtier, hab so viel liegen lassen, vernachlässigt, so viele Kompromisse mit Menschen geschlossen, nur um den Raum und die Zeit und den Rückzug nach innen erlaubt zu bekommen.
In diesem Buch sind Texte von 1960 bis 2025 versammelt, also aus einem Lebenszeitraum von 65 Jahren. Es sind ganz unterschiedliche Arten von Texten: Erzählungen, Vorträge, Aufsätze, sogar WhatsApp-Nachrichten, in denen ich manche Vignette notierte. Es sind auch Erzählungen enthalten, die in der DDR keine Druckgenehmigung erhielten, die ich aber beschützte und in ihren verblichenen Durchschlägen aufhob: in einer Folie, in einem Aktenordner und noch einem Aktenordner. Und auf deren Rückseite schrieb ich: »Nicht gedruckt« oder »Vor 1989 geschrieben«.
Mit 34 Jahren, es war 1974, ich hatte noch kein Buch veröffentlicht, schrieb ich neben meiner Arbeit in der Klinik immer häufiger und auch regelmäßig kleine Erzählungen, direkt in die Schreibmaschine. So lag auch die letzte Erzählung in diesem Band in meiner Manuskriptmappe: Heute Abend. Diese Geschichte gab ich, ohne zu zögern, ein Jahr später drei Schriftstellerkollegen (Schlesinger, Plenzdorf, Stade), weil sie eine Anthologie mit Berliner Geschichten zusammenstellen wollten und ich ihnen empfohlen worden war. Das Besondere war, dass wir ohne Lektor und Verlag selbst bestimmen wollten, wer dabei ist. So etwas gab es in Warschau, Moskau, Prag und Budapest schon: Samisdat. Also ohne Zensur, ohne Druckgenehmigung. Die SED, der Schriftstellerverband und in deren Auftrag der Staatssicherheitsdienst waren alarmiert und versuchten, mit Spitzeln und Drohungen die Absicht zu ersticken. Einige der Autoren zogen ihre Beiträge zurück, distanzierten sich, bekamen Angst, einige wurden selbst zu Spitzeln und Verrätern.
Weil ich meinen Beitrag trotz einer deutlichen Drohung durch eine leitende Mitarbeiterin des Schriftstellerverbandes nicht zurückzog, wurde ich tatsächlich die nächsten 13 Jahre bis zum Ende der DDR im operativen Vorgang »Selbstverlag« observiert. Bis zum Ende der DDR. Es geht in der Diktatur also nicht um den Inhalt. Es geht um die Unbotmäßigkeit.
Der Regiestudent Dietmar Hochmuth hatte Anfang der Achtziger die Idee, die Geschichte mit einer meiner früheren Erzählungen (Die Ausnahme) zusammen als Student an der Moskauer Filmhochschule zu verfilmen. Er drehte in Ostberlin in Schwarz-Weiß mit Christine Schorn und Rolf Hoppe. Jahrzehntelang war die Kopie in einem Archiv verschollen, tauchte aber im vorigen Jahr wieder auf und konnte in einem Filmkunstkino im Berliner Prenzlauer Berg vorgeführt werden: Heute Abend und morgen Früh.
Man muss nur vierzig Jahre warten. Ganz einfach.
Mit meinen Erzählungen wollte ich mich meiner Welt vergewissern.
Ich hoffe, dass diese Texte auch Menschen am Anfang ihres Erwachsenenlebens erreichen, damit sie an einem Lebensbeispiel sehen: Es gibt immer einen Ausweg in eine Rettung, es gibt immer einen Übergang in eine vorher unsichtbare unvorstellbare Lösung.
Ich hoffe, dass die Texte auch zu den mitten im Berufs- und im Familienleben stehenden Menschen um die dreißig bis fünfzig sprechen, denn manche von ihnen wagten einen zweiten Anlauf oder grübeln darüber.
Ich hoffe, dass ich die Sechzig-, Siebzigjährigen erreiche, die am vermeintlichen Ende ihres Berufslebens stehen, ihrer Lebensarbeit, durch die sie sich Selbstachtung und Respekt erwarben.
Und dann möchte ich mit diesem Buch die Menschen meiner Generation erreichen, die noch leben, vielleicht sind sie auch schon manchmal so lebenssatt wie ich, wie viel haben wir in unserem langen Leben erlebt und bewältigt, wir alten Urgroßmütter. Vielleicht haben wir unsere Lebensmenschen schon verloren und leben nun allein. Und brauchen in unserer ungewohnten Schwäche Zuversicht.
Ich möchte von den Übergängen erzählen: von der Abhängigkeit des Kindseins in die Verantwortung für das eigene Leben, dass sich also einer beim Rennen über die Sturmbahn die Gasmaske abreißt, bevor er erstickt. Ich möchte von dem Übergang erzählen, vor dem ich plötzlich stand, als eine für das gesamte Leben befürchtete Einmauerung brach, vom Übergang in eine ungewohnte ersehnte Gesellschaftsordnung, deren Regeln ich nur aus dem Fernsehgerät kannte. Ich möchte von den Übergängen in bisher unbekannte Lebensformen erzählen.
Ich möchte vom Übergang in den Tod erzählen, der als Erlösung kommen kann. Vom Übergang in die Unendlichkeit.
So steht am Anfang des Buchs ein Text von 1960.
Ich war damals zwanzig Jahre alt.
Es kommt mir wie heute vor:
Diese 65 Jahre dazwischen sind nur ein Tag gewesen.
Lebenstopf
Mein Topf Leben quillt über
Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr.
Sein Boden bedeckt mit:
Muttermilch, Vatertod.
Darüber durcheinander:
Heulsirenen vor Bombenkrachen,
lange Reise zum Fern-vom-Schuss.
Hütegans, Schlittenpony, Fremdarbeiter Leo.
Nachtflucht auf dem Herrschaftsleiterwagen.
Zuletzt im Kinderwagen ohne viertes Rad.
Vierzehn Esser im Gnadenbrot,
Stullenschabebutter im Brei,
Abgefahrenes Kohlenklauerbein,
Flickenkleid mit Holzpantinen.
Ungezähltes Zählerablesen bei Hexenwirtin.
Kastanien gegen Zoohunger,
Brennscherenlocken für Rosenrot.
Eis-Freund-Geheimnis.
Zensuren zur Unterschrift.
Schlaraffenland in Pflaumenbäumen.
Hängemattenblättersonne.
Riechwald Schmecksee Hörstadt.
Neugier-Buch für Liebe, Friedhofsharken.
Tränen im Salz-Tränen-Kissen.
Stolz-Schuhe eins zu sechs.
Viel umgeändertes Wissen.
Kafka-Unheimliches,
Mozart-Flöten
Streicheln
Blitzangst Donnererlösung
Hilflose Tränen
Um Freunde im Dunkelwarm.
Ein Kind.
Mein Topf Leben quillt über, Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr.
Luft zum Leben
Eine Mutter stellte ich mir anders vor.
Nein, eine Mutter war ich nicht. Meine Bauchdecke war so fest. Wie sollte darunter ein Kind wachsen? Und wie sollte es aus mir herauskommen? Es müsste mich ja zerreißen. Und dann wäre immer ein Kind da, wenn ich weggehen, verreisen, ausschlafen, lieben will.
Aber ich wurde schwanger mit neunzehn. Und die Ärztin, die mich schon lange kannte, die die Schwangerschaft feststellte und mein Erschrecken sah, sagte zu mir, wenn du es nicht heute deiner Mutter sagst, rufe ich sie an. Kein verantwortungsvoller Arzt wird bei dir eine Unterbrechung vornehmen.
Sie war katholisch und hatte vier Kinder. Und bei uns gab es noch keine legale Unterbrechung. Ich kannte niemand, der es gemacht hätte.
Der Vater des Kindes hatte noch nie mit einer so unerfahrenen Freundin zu tun gehabt und schlug mir, wenn ich es mir mit dem Kind nicht anders überlegte, eine Eheschließung vor.
Ich hatte keinen Vater, keinen großen Bruder, keinen Freund gehabt, ich war so dankbar für Interesse an mir, für das Interesse eines Mannes, dass ich es für Liebe hielt.
Ich habe alle schlimmen Zeichen übersehen. Und wir heirateten.
Die Wohnungen der anderen Frauen, die er zu streichen, die Schallplatten der anderen Frauen, die er abends noch anzuhören hatte. Ich habe wirklich daran geglaubt.
Ich brachte mein Kind um 6 Uhr 25 an einem Sonnabendmorgen zur Welt. Ich lag im Krankenhaus, eine Hebamme drückte mit einem Knie vorsichtig auf meinen Bauch, mir zu helfen. Eine Ärztin lauschte mit einem Hörrohr auf die schwachen, immer schwächer werdenden Herztöne. Mahnte zur Eile. Ich war wach bis zum letzten Moment. Bis zum ersten Moment: ein kleines faltiges bläuliches Kind, die Nabelschnur um den Hals gewickelt, fast erstickt an seiner meiner Nabelschnur. Zu stark hatte es sich bewegt, so sehr hatte es schon gelebt: mein Kind. An meiner seiner Nabelschnur hätte es ersticken können. Es hätte vorher gelebt und wäre tot geboren.
Einundzwanzig, zwei und zwanzig drei. Ich zählte, so langsam ich zählen konnte. Aber mein Kind schrie nicht. Es hing, mit dem Kopf nach unten, mit beiden Füßen in den Händen der Ärztin, wie leblos.
Ich hatte es zur Welt gebracht. Und nun konnte es in der Welt nicht atmen, nicht schreien.
Ich sah, dass es ein Junge war. Ich sah ihn atemlos an. Ich sah, dass sie eine lange dünne Glasröhre in seinen Hals steckten, Flüssigkeit absaugten. Wie sie sich beeilten. Sie antworteten mir gar nicht.
Da schrie mein Kind. Es lebte.
Ich hatte zu viel Milch. Sie legten mir noch das Kind meiner Bettnachbarin an.
Zwei Wochen später Prüfungen im Studium, zwischen den Stillzeiten. Ich war zwanzig.
Als das Kind ein Vierteljahr alt war, brachte ich es jeden Morgen in die Kinderkrippe, pumpte die Milch ab und gab sie mit.
Als das Kind drei war, brachte ich es in den Kindergarten. Im Winter den Kinderwagen durch den Schnee. Abends das müde Kind, das schreiende Kind, das kranke Kind. Und meine Müdigkeit, mein Schreien, meine Krankheiten.
Das zweite Kind wäre ein Jahr jünger gewesen. Ich habe es nicht geboren.
Mein Kind war vier, als die Scheidung begann, und sechs, als ich endlich mit ihm in eine andere Wohnung zog. Seitdem sind dreizehn Jahre vergangen. Und da gab es immer ein Kind: am Abend. Am Morgen. Am Wochenende. In den Ferien.
Ich musste immer an Brot denken, an Butter, an Milch, an Schularbeiten, Elternversammlung. Ich habe so viele Essen gekocht und so viele Pullover gewaschen und so viele Windeln, die froren nachts auf dem Hof. Und ich habe so viel geschimpft und um Ruhe gebeten und um Nachgiebigkeit und Rücksicht. Und ich habe das Kind bedrückt mit meinen Erwartungen, meinen Wünschen, war enttäuscht und entmutigt und hab es so zärtlich geliebt, wenn es im Bett lag und schlief. Und ich habe mich geschämt, weil ich keine sanfte Mutter war, keine streichelnde zärtliche weiche. Aber dies Kind war wie mein Arm. Den streichle ich auch nicht, den hab ich.
Das erste Mal, als ich das Kind abends allein ließ. Es war vier Monate. Und wir fuhren mit der S-Bahn ins Theater.
Es war zu Hause satt und sauber eingeschlafen. Aber in der Bahn war mir plötzlich, als ob ich an einer langen Nabelschnur mit ihm verbunden sei.
Ein Kind, das hielt mich in der Welt. Nie mehr zogen mich Autoscheinwerfer auf die Straße.
Als das Kind zum ersten Mal morgens in seinem Bettchen kniete, als es zum ersten Mal lief, von seinem Vater zu mir, dachte ich, jetzt braucht es dich schon wieder etwas weniger. Und darauf war ich stolz.
Einmal war es todkrank, mit dreieinhalb Jahren. Nachts weckte es mich, erbrach sich, hatte hohes Fieber. Wir holten den Rettungsarzt, am nächsten Tag die Kinderärztin, und jeden Tag baten wir sie wiederzukommen, weil es schlimmer wurde mit dem Husten, bis sie, müde unserer Anrufe, schließlich eine Krankenhausüberweisung vornahm, zur Blinddarmoperation. Aber es war eine Vereiterung in der Lunge. Und die Stationsärztin machte uns Hoffnung, dass unser Kind die Nacht überlebt.
Sein Vater hatte die Sachen des Kindes wieder mitbekommen: seine rote Wollmütze, seine kleinen Stiefelchen, seinen Mantel. So stand er in der Wohnungstür und dachte, nein, er sagte es: Es stirbt, und du hast Schuld.
Ich konnte diese Nacht schlafen, erschöpft und ruhig, ganz sicher, es überlebt. Am nächsten Morgen sagten sie uns, wir könnten es sehen. Aber nur heimlich. Es dürfe sich nicht aufregen.
Es lag in einem Einzelzimmer unter einem Sauerstoffzelt.
Die Schwester zog sich noch einen Kittel über ihren Kittel, als sie an sein Bett trat.
In der Nacht war es punktiert worden. Der Eiter war abgezogen. Es hatte Bluttransfusionen erhalten.
Und nun sah es uns doch durch die Glaswände.
Was hatte es in der Nacht alles erlitten. Und ich hatte nicht bei ihm gesessen, hatte es nicht getröstet, hatte nur auf die Schwestern und Ärzte vertraut.
Es sah uns und richtete sich mühsam auf und streckte die Arme nach uns aus und weinte. Es lebte.
Einmal, als es schon in die Schule ging, kam ich nach Haus und sah auf dem Bürgersteig Blutspuren, die zu unserer Haustür führten. Dort stand eine Menge Kinder, sie beugten sich herunter, mein Kind saß in der Mitte und hielt sich seinen Kopf. Blut lief ihm über die Augen. Eine Wunde an der Stirn. Es hatte sich beim Rollern umgesehen und war gegen einen Betonpfeiler geprallt.
Das Kind, das zum ersten Mal allein mit dem Zug ins Erzgebirge zu den Großeltern fuhr. In meinen Gedanken saß es in einem immer kleiner werdenden Zug und fuhr südlich, fuhr ganz allein, mit Stullen und einer Mark für Brause, fuhr auf der Landkarte südlich, von mir weg.
Seine Mädchen: setzen sich gleich in sein Zimmer. Nein, keinen Tee. Sie möchten lieber eine rauchen. Wollen auch nicht zunehmen, bei der Pille muss man ja aufpassen. Mutter, wie kommt es, dass immer Mädchen was von mir wollen, von denen ich nichts will? Und warum traue ich mich an die andern nicht ran?
Mutter, warum hast du dich scheiden lassen? Ich finde Vater in Ordnung. Du warst auch nicht ohne Schuld, hat er gesagt. Also, ganz ehrlich, so wie es jetzt ist, ist es besser: Sie passt besser zu ihm als du. Und ihr zu Hause passt auch besser zusammen.
Hast du schon mal erlebt, dass man jemand kennenlernt und mit dem sofort reden kann, stundenlang? Den ganzen Abend, die ganze Nacht? Und dass man mit dem dann auch schläft? Und am nächsten Tag aufwacht und dann mit dem rausgeht und Mittag isst und immer so weiterreden könnte?
Also, mein Sohn war erwachsen.
Er lernte Bäume fällen. Er konnte Bäume entasten, mit dem Beil, so scharf, dass man auch Brot damit schneiden konnte. Er lebte tagsüber im Wald, in den Pausen im Wohnwagen, den sie morgens heizten. In der Frühstückspause rösteten sie Brote auf dem Ofen.
Er lernte Traktoren fahren, Baumstämme abschleppen, Lastkraftwagen lenken. Und er lernte, Zapfen zu pflücken:
Du musst den Baumstamm hochsteigen. Du umklammerst ihn dabei. Die Seile hast du auf dem Rücken. Dann musst du dich sichern: Du wirfst ein Seil in den Baumwipfel, steigst höher und sicherst dich mit dem Wipfelsicherungsseil. Wenn du im Wipfel bist, musst du ja beide Arme frei haben zum Zapfenpflücken. Wenn du etwas falsch gemacht hast mit den Seilen, kann es schiefgehen. Du musst oben loslassen können und hast dich selber gesichert, verstehst du? Du ganz allein bist schuld, wenn du runterfällst. Der Meister steht unten und sagt, nun lass los. Das ist vielleicht ein Gefühl. Da oben in der Luft, ganz allein.
An einem Donnerstag um 12 Uhr, als er 19 geworden war, haben wir ihn zur Armee gebracht: sein Vater, seine Freundin und ich.
Alle hatten sie kurze Haare, Jeansanzüge, Tramper, Kutten. Und als der Offizier in Zivil die Jungens fragte: Haben Sie noch Fragen?, riefen einige gut gelaunt: Wann ist der erste Urlaub, wann werden wir entlassen?
Der Offizier sagte ruhig zu ihnen: Wir gehen jetzt zum Bahnhof, von dort fahren wir mit der Bahn zum nächsten Sammelpunkt. Ohne Tritt, marsch. Und die Jungens gingen plötzlich zu zweit, auf der Straße und nicht auf dem Bürgersteig, die enge Kopfsteingasse den Berg hinunter.
Er drehte sich um und winkte, bis sie um die Ecke verschwunden waren. Und ich dachte an die Jahrhunderte, in denen immer wieder Mütter und Freundinnen ihren Söhnen und Freunden so hinterhergesehen hatten.
Zehn Tage später war seine Vereidigung: An einem Mahnmal. Alle im Stahlhelm mit bleichen Gesichtern. Der Weg zum Mahnmal ging über den Friedhof. Hin an den Gräbern vorbei, und auch zurück an den Gräbern vorbei. Die Frauen, die die Gräber harkten.
Ich erkannte ihn nicht unter den vielen Stahlhelmen. Und er sah uns unverwandt von der Seite an, das Gesicht nach vorn ausgerichtet, bis wir ihn erkannten. Dann war es gut. Danach durften wir noch ein wenig bei ihm stehen. Ihn anfassen, streicheln. Wir befühlten seinen Uniformstoff, den Stahlhelm, den am Morgen frisch geölten.
Wie hübsch er in der Uniform aussieht, sagte seine Freundin leise zu mir. Sie steht ihm am besten von allen hier, nicht?
Er stand groß und schlank da. Mit ernsten grauen Augen. Sah seine Eltern an, sein Mädchen an der Hand, und sagte lächelnd: Ihr habt gar nicht gesehen, dass ich Ehrensoldat war. Ich musste die Fahne nach vorn bringen. Haben wir ganz schön üben müssen.
Ein deutscher Soldat, dachte ich. Ich habe ein Kind, das ein deutscher Soldat ist. Mein Vater, der war nur neun Jahre älter, als er starb als deutscher Soldat.
Ich sah meinem Sohn die Übernächtigung an, die Sorge, etwas falsch zu machen. Und fand ihn auch schön, so absurd es klingt, und schämte mich ein wenig für den Gedanken. Meine Großmutter hatte von meinem Vater gesagt, er sah in Uniform sehr männlich aus. Ich konnte doch nicht auch so denken.
Nach dem Mittag durften wir noch zwei Stunden mit ihnen zusammensitzen. Da versammelten sich die Familien um ihren einen Uniformierten: die Frauen mit ihren kleinen Kindern, die Geschwister, die Väter, manchmal selbst in Uniform, und wir, beladen mit Thermobehältern und Früchten. Wenn er aufstand, langte er nach seiner Mütze und seinem Koppel.
Dann mussten sie sich sammeln und aufstellen und im Gleichschritt, marsch, in die Kaserne zurück. Wir gingen noch neben ihm her, liefen, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren.
Dann marschierten sie durch die Kaserneneinfahrt.
Seine Zivilsachen hatte ich schon einen Tag zuvor zu Hause ausgepackt. Jetzt hat er nur noch seine Uniform, dachte ich.
Und als wir ihn nicht mehr sehen konnten, sahen wir uns an, seine Freundin und ich. Ich sah verschwommen, wie sie lächelnd weinte: 530 Tage noch. Der hat nur mich und, sie zögerte kurz und sah mich freundlich an, der hat nun bloß mich und Sie, die ihn lieb haben da drin.
Nach elf Tagen schrieb er: Nun bin ich genau drei Wochen hier. Das Schwerste ist schon so gut wie überstanden.
In der vergangenen Woche wachte ich nachts aus einem furchtbaren Traum auf: Ich war schon ganz alt und erzählte weinend einem Unbekannten, dass mein Kind während der Armeezeit dran glauben musste. Ich setzte mich voll Grauen im Bett auf.
Heute bekam ich zwei Briefe von ihm: der erste ein normaler, der zweite mit Eilboten. Im ersten schrieb er, dass sich in seiner Gasmaske beim Rennen über die Sturmbahn ein Gummipfropf am Filter festgesaugt und er keine Luft mehr bekommen habe. Vor Schreck habe er vergessen, wie er die Gasmaske abkriegen sollte. Die anderen haben es gesehen und ihm nicht geholfen. Da habe er sich alles vom Kopf gerissen und lebe noch. Aber das sei alles kein Grund zur Panik.
Im zweiten Brief, der war ihm wichtiger, schrieb er: dass er auf Urlaub komme, für drei Tage, schon übermorgen. Und ich solle es allen sagen und ich solle alle netten Leutchen grüßen und die Freundin wisse es auch schon und wir sollten mit dem frühstmöglichen Zug rechnen und er habe keine Schlüssel, dick unterstrichen, und er möchte mit ihr allein sein.
Und die Anrede war zum ersten Mal: Liebes Mütterchen.
Ein Geschenk
Die arme Clara, als Witwe mit 60 Mark Rente, schenkte mir zur ersten Weihnacht nach dem Krieg (die Lichter brannten) in der Dachkammerwohnung, der Austauschwohnung, weil ihre eigentliche Wohnung im russischen Sperrgebiet lag, ihre braunen Haare mit rötlichem Schimmer als Perücke für meine Puppe Christel, die ich auch auf der Flucht immer an mich gepresst hatte, nun war sie ganz zerzaust. Die Puppe mit den glänzenden echten Haaren sah mich an, als ich in das Weihnachtszimmer kam. Eigentlich ist es das schönste Geschenk in meinem ganzen Leben. Ich war fünf und hatte die Flucht aus Hinterpommern hinter mir, den Tod meines Großvaters Karl in Greifswald.
Und meine Großmutter Wilhelmine, als sie schon in Berlin lebte, schenkte mir, als ich 22 war, Studentin mit kleinem Kind, zu Weihnachten eine Pralinenschachtel, die sie schon geleert und nun mit Bonbons aufgefüllt hatte in den Stanniol-Vertiefungen.
Der Tod meiner Großmütter
1
Als ob er immer der Gleiche ist: der Tod.
Der Tod kam zu früh, er raffte hinweg, der Tod ereilte ihn, der Tod und das Mädchen. Zum Tode verurteilt. Todessehnsucht. Im Tod vereint. Angst vor dem Tod. Der Schlusspunkt. Endgültig.
Ein siebzehnjähriges Mädchen muss sterben. Sie weiß es und bespricht mit ihrer Mutter, was mit ihren Augen werden soll: Die Augen soll ein blindes Kind bekommen. Damit es mit ihren Augen sehen kann, wenn sie tot ist. Die Augen eines Geliebten in einem fremden Gesicht. Wenn die Mutter einkauft, dann kann hinter ihr in der Schlange das kleine, nicht mehr blinde Kind stehen und sie ansehen: mit den Augen ihrer Tochter.
Auch wenn ich tot bin, könnten meine Augen weiter sehen. Die Pupillen könnten sich zusammenziehen bei grellem Licht. Fremde Augenlider, fremde Tränen auf meinen Augäpfeln.
2
Tote sehen dich immer noch an, immer weiter an, ohne den erlösenden Lidschlag. Mit offenem Mund. Meine Oma hat mich so angesehen. Sie hat mit dem Sterben gewartet, bis ich aus der Schule kam. Komm an mein Bett. Ich war ihre Schwester Ella, und wir saßen in ihrem Kinderzimmer im Elsass.
Geh nicht weg von mir, gib mir die Hand.
Es war wieder Zeit für das Morphium.
Die schwarze bestrahlte Brust, die Geschwulst im Rücken.
Die Krankenschwester musste gleich kommen, sie kam doch immer um elf Uhr zu uns nach Hause.
Ich war sechzehn, ich hatte noch nie einen Menschen sterben sehen und war ganz allein bei meiner Oma. Sie war achtundsechzig, hatte noch ganz schwarze lange Haare und große dunkelblaue Augen.
Ella, sagte sie leise zu mir, gib mir ein wenig Saft, aber komm gleich zurück.
Ich brachte ihr den Saft, half ihr beim Trinken, setzte mich zu ihr, hielt ihre Hand. Der erste Ferientag im Sommer, das offene Fenster mit dem Apfelbaum davor, die vielen Wochen schon ihre Schmerzen, ihr Stöhnen.
Entschuldige, aber es tut so weh.
Das Morphiumrezept mit den vielen Durchschlägen, das eine kleine Fläschchen, das nur für einen Tag reichte.
Ich sah ihr in die Augen, sie war schon besinnungslos.
Ich wünschte so, dass sie jetzt stirbt.
Und sie erbrach sich und starb.
In meinem Schmuckkästchen liegen große Zähne mit Goldkronen darüber. Von wem mögen sie sein? Ob man sie jemand herausgebrochen hat, als er tot war?
Meine Oma hatte Brillantohrringe, die waren in ihre Ohrläppchen fest eingewachsen, nach dem Krieg haben die Soldaten sie ihr nicht herausreißen können. Und nun nahm sie sie mit ins Grab.
Wie konntest du ihr die wertvollen Ohrringe lassen, sagte meine andere Großmutter vorwurfsvoll, sicher hat sie jemand herausgeschnitten.
Aber ich konnte ihr doch nicht die Ohrläppchen aufschneiden. Womit denn? Mit einer Nagelschere?
Ich habe meine Oma nicht mehr berührt, als sie tot war. Ich saß an der Tür und sah sie an, bis es klingelte und die Krankenschwester kam. Die sagte mir, dass ich einen Arzt für den Totenschein holen muss. Aber vorher wollten wir sie schön machen.
Die Schwester wusch und kämmte meine Oma. Vorher schloss sie ihr die Augen. Sie zog ihr ein neues Nachthemd an. Ich weichte die Wäsche ein mit dem Erbrochenen, ging zur Ärztin, rief meine Mutter im Dienst an: dass ihre Mutter gestorben ist. Dann ging ich zum Bestattungshaus, suchte den Sarg aus. Mit dem Totenschein ging ich zur Polizei und zum Standesamt. Vorher schickte ich die Telegramme an die Beerdigungsgäste.
Dann kam der Beerdigungstag, ich machte Kartoffelsalat, wusch ab. Den Koffer hatte ich schon gepackt.
Dann setzte ich mich in den Zug zu meiner anderen Großmutter.
Weit weg zu den Lebenden.
Aber nachts in vielen Träumen kehrt meine Oma zu mir zurück. Ihr Sarg steht in einem großen Raum, der Sargdeckel öffnet sich. Sie stellt sich auf, mit gestreckten Beinen erhebt sie sich. Und ich weiß, dass sie Krebs hat, dass sie noch furchtbare Schmerzen haben wird, und ängstige mich, wie lange die Qual noch gehen werde. Wenn sie doch schon tot wäre, immer wieder muss sie auferstehen, denke ich verzweifelt. Und wenn ich dann nachts im Dunklen aufwache, mich aufrichte und den Traum abschüttele, bin ich erleichtert und dankbar.
3
Meine andere Großmutter war nur ein Jahr älter. Aber sie kam sich jugendlicher, moderner, tüchtiger, klüger, energischer vor. Als ich nach dem Tod und dem Begräbnis meiner Oma zu ihr kam, hatte sie gerade begonnen, ein Haus zu bauen. Ihre zehn Geschwister waren schon tot, auch ihr Mann und ihre beiden Söhne.
Sie war schon 69 und schaffte es.
Im Dunkeln ging sie mit mir zur Baustelle. Da stand das neue Haus im Rohbau, mit spitzem Giebel. Bald war es verputzt. Der Mann, mit dem sie damals lebte, starb bald in dem neuen Haus. Und sie verkaufte es leichten Herzens, zog in die große Stadt Berlin, mit 74 Jahren, in eine kleine Wohnung.
Setzte sich auf ihr Sofa und wartete auf mich.
Wenn sie bei mir übernachtete, wartete sie morgens auf das Frühstück.
Das macht mein Herz nicht mit, wenn du mir erst um neun Frühstück machst.
Einmal träumte sie in meiner Wohnung, in dem gleichen Bett, in dem meine andere Oma gestorben war: Sie ging langsam auf einer gleißenden hellen unendlich großen Fläche, umgeben von einer seligen Ruhe, ganz allein. Da habe sie im Traum gewusst, dass so der Tod ist. Und beim Aufwachen wusste sie, dass er bald kommt.
Beim ersten Schlaganfall war sie allein in ihrer Wohnung. Sie konnte zur Flurtür kriechen und an die Tür klopfen, bis man sie aufheben und ins Krankenhaus bringen konnte.
Das ist sie, dachte ich entsetzt, als ich an ihrem Krankenbett saß. Die eine Gesichtshälfte war gelähmt, unbeweglich, die Augen verschieden hoch. Sie weinte mit ihrer einen Gesichtshälfte, zog mich mit ihrem einen Arm zu sich, ich roch das Krankenhaus an ihr, aber auch die vertraute Seife.
Euthanasie, flüsterte sie beschwörend, ich will tot sein, bitte, bitte, bring mir Gift, lass mich nicht krepieren, wie hässlich ich bin, es wird nie mehr, ich bin 81, bitte, bitte, ich will schnell sterben.
Bei meinem nächsten Besuch sagte der Stationsarzt zu mir: Wir müssen auf sie aufpassen, in ihrer gesunden Hand haben wir alle Schlaftabletten gefunden, die wir ihr nach und nach verabreicht haben. Was meinen Sie, ob sie fähig wäre, sich selbst?
Sie lag im Sterbezimmer, eine Stellwand verbarg das Gesicht des gerade Sterbenden. Auch an andern Betten saß der Besuch.
Ich kann es nicht machen, sagte ich zu ihr – ich war 28 –, so gern ich dir helfen würde, aber vor dem Gesetz wäre es Mord.
Heute Nacht hab ich mit der gelähmten Seite aus dem Bett gehangen. Niemand hat es gemerkt, die ganze Nacht, sagte sie da.
Dann kam der zweite Schlaganfall. Wochen vergingen. Weiße Haare wuchsen nach. Die gefärbten braunen wuchsen vom Gesicht weg. Sie wurde in einen Saal verlegt mit Verwirrten, die saßen auf ihrer Bettkante, kicherten. Und ich besuchte sie, mittwochs und sonntags. Sie schrie, wenn ich ging, und streckte die Arme nach mir aus. Ach, wenn sie sterben könnte ohne mein Zutun, dachte ich.
Löse meine Wohnung auf und kündige zum Ende des Monats, sagte sie Anfang September ganz ruhig zu mir.
Inzwischen lag sie in einem kleinen Zimmer mit zwei anderen Frauen.
Nimm dir, was du willst, das andere verschenke.
Sie gab mir den Wohnungsschlüssel, ich leerte die Wohnung. Am Sonntag, dem 30. September, besuchte ich sie im Krankenhaus, sagte, dass alles erledigt sei. Sie nahm ihre Handtasche vom Nachttisch, öffnete sie und gab mir den Ehering und ihre Armbanduhr. Sie bedankte sich für meine Liebe. Wäre sie gläubig gewesen, hätte man es segnen nennen können.
Sie küsste mich mit ihren trockenen faltigen Lippen. Meine Süße, flüsterte sie, geh nun zu deinem Jungen.
Am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Und ich wusste, als sich die Stationsschwester meldete, dass meine Großmutter nun tot war.
Sie ist ganz ruhig gestorben, sagte die Schwester.
In der Nacht, wir haben es gar nicht gemerkt, nur ein kleiner kurzer Aufschrei, sagten die Frauen im Zimmer.
Sie liegt dort hinten im Zimmer, sagte die Schwester, wir haben auch die Sachen dazugetan, den Bademantel, die Pantoffeln, die Waschsachen, weiter war ja nichts, nicht?
Nein, antwortete ich.
Kommen Sie, Sie können sie ansehen.
Nein, das will ich nicht.
Die Sachen ließ ich da.
Sonst wollen sie ihre Toten immer noch einmal sehen, sogar die Mütter ihre kleinen Kinder. Eine Kinderschwester musste ein totes kleines Kind noch einmal aus dem Leichenkeller holen, auf die Station, musste es anziehen, obwohl es schon ganz steif war, damit sie es der Mutter noch einmal zeigen konnten. Da erst glaubte es die Mutter. Ich habe nie mehr von dieser Großmutter geträumt.
Erst jetzt, nach zwölf Jahren, gelingt es mir manchmal, mich an ihre Herzlichkeit zu erinnern, den Geruch der Königsberger Klopse, die sie extra für mich kochte, an die Flasche Uralt Lavendel auf ihrem Waschtisch. An ihr ungelähmtes Gesicht.
Ein Menschenleben
Im ICE buche ich immer einen Platz im Ruheabteil, möglichst in diesen Sitzen wie im Flugzeug. Und am Gang. Neben der Gepäcknische. Kein Gegenüber, nur ein Nachbar, der so wie ich kurz grüßt und dann seinen Laptop aufklappt. Eine kurze Verständigung über die gemeinsame Steckdose. Dann könnte es stundenlang so schweigend weitergehen. Aber plötzlich stand ein Mensch neben mir im Gang, beugte sich zu mir herunter und flüsterte: Sind Sie es? Hier dürfen wir ja nicht sprechen, ob Sie vielleicht mit mir herausgehen könnten? Ich möchte Sie nicht stören, würde aber gern mit Ihnen sprechen.
Ich sah ein sympathisches sensibles Gesicht, ein schüchternes Lächeln, klappte den Laptop zu, verstaute ihn im Rucksack und folgte auf die Plattform hinter der Tür des Ruheraums, hier konnte man nur stehen, und es war laut durch die Räder. Ich sah mir den mutigen Menschen näher an: Diesmal war es eine nicht nur attraktive, sondern auch elegante junge Frau, die ich auf Anfang dreißig schätzte.
Bleiben Sie noch etwas im Zug?
Ich antwortete, dass ich bei der nächsten Station aussteige.
Weil Sie doch über so etwas schreiben, wissen Sie? Über Situationen, in denen man voll auf Risiko geht.
Ich habe meinen gesamten Jahresurlaub genommen und fahre jetzt zu einem Mann in eine mir unbekannte Gegend in der Schweiz. Wir kennen uns nur übers Internet. Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber es gefällt mir; wie er lebt und denkt. Ich würde für ihn meine Arbeitsstelle und den Wohnort, also mein Land, wechseln. Ich habe es niemandem erzählt. Können Sie mich verstehen?