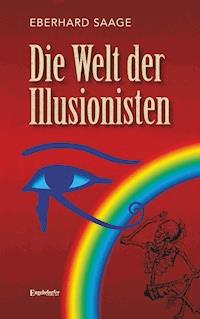
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Etwas solle einmal von ihm bleiben, hatte sich der junge Joseph Adam nach einer schweren Krankheit gewünscht. Er wolle nicht auf dem Friedhof verscharrt und schnell vergessen werden. Nach seinem Tod solle eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus an ihn erinnern. Das war für andere eine seiner Illusionen, ein Traum, aus dem er bald erwachen würde, für ihn jedoch ein konkretes Lebensziel. Die Aufgabe, durch deren Lösung er das erreichte, hatte er sich nicht selbst ausgesucht, sie wurde ihm von Berkel Zorbas, dem Präsidenten Abestans, gestellt. Aus ihrer Sicht gaben sie mit dem Geoengineering zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels nicht nur ihrem Leben einen Sinn, sondern dienten auch allen Menschen. Und deshalb übernahmen sie gegen den erbitterten Widerstand vieler die Verantwortung, die andere nicht tragen wollten. Doch für die Erfüllung seiner Illusionen müsste Joseph Adam viel bezahlen, das wurde ihm von seiner Tante Sarah sofort bewusst gemacht. Zu teuer? Er selbst hätte diese Frage mit Nein beantwortet, denn er glaubte bis zu seinem scheinbaren Tod, dass er nur durch sie wirklich lebte, nicht bloß existierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eberhard Saage
DIE WELT DER ILLUSIONISTEN
Roman
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2017
Bibliografische Information durch die
Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
Umschlaggestaltung Thomas Pegel
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Auferstehung
Reifung
Aufstieg
Entbindung
Donatoren
Erste Konferenz
Krater
Kultur in der Bank
Zweite Konferenz
Neubeginn
Realisierung
Tag der Liebe und des Zorns
Kindheit
Jugend
AUFERSTEHUNG
Am Tage der Liebe und des Zorns gaben sich Menschen in allen Erdteilen hemmungslos ihren Gefühlen hin.
Zur Verabschiedung ihres verehrten Präsidenten Berkel Zorbas und des großen deutschen Politikers Joseph Adam strömten Millionen zum neuen Flughafen der Hauptstadt Abestans. Und die Rentierzüchter, deren Weideflächen wieder wie vor dem Klimawandel genutzt werden konnten, dankten im Namen aller ihren Rettern mit traditionellen Tänzen.
Ehemalige Flüchtlinge, die auf ihren Inseln in Ozeanien, die nun doch nicht vom Meer verschluckt wurden, zurückgekehrt waren und in der alten Heimat ihren Stolz, ihre Lebensfreude und ihre Ehre wiedergefunden hatten, schmückten überlebensgroße Puppen dieser beiden Helden mit herrlichen Blumenkränzen
Der tobende Mob in den ausgedörrten australischen und südafrikanischen Flüchtlingslagern trug ähnliche Puppen mit sich, aber um sie zu bespucken, auf sie zu urinieren und sie schließlich zu verbrennen.
In den europäischen Mittelmeerländern, deren Wüsten in fruchtbares Ackerland verwandelt waren und deren verbrannte Wälder wieder grünten, tanzten die Menschen bei Erntedankfesten.
Die Deutschen feierten ihren großen Sohn, Joseph Adam, als den bedeutendsten Politiker seit Bismarck, und bei einer Ehrung in dessen Heimatstadt, an der die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes teilnahmen, wurde an seinem Geburtshaus eine Gedenktafel enthüllt.
Die sonst so stolzen, gegenüber Fremden sich reserviert verhaltenden Saharabewohner, lagen den beiden Weltrettern bei deren Ankunft zu Füßen. Während einer Rundfahrt durch die aufgeblühte Wüste mit fetten Weiden, riesigen Viehherden, unendlich weiten Getreidefeldern und aufwachsenden Wäldern füllten sich die Herzen von Zorbas und Adam voller Stolz auf ihr Lebenswerk, das sie ganz alleine gegen den erbitterten Widerstand weltweiter Gegner geschaffen hatten.
Doch diese Gegner hofften immer noch auf einen Sieg in allerletzter Minute. Nur ein Politiker konnte ihnen den noch bringen, der US-amerikanische Präsident, dessen Land auch alle Katastrophen des Klimawandels überwunden hatte. Aber würde er sich deshalb nur für die Bevölkerung der USA und für die der Nordhalbkugel einsetzten? Oder auch für die Südhalbkugel, die verdorrte, deren Bewohner in Flüchtlingslagern dahinvegetierten? Auch für die musste er sich doch verantwortlich fühlen, und deshalb warteten weltweit Milliarden voller Spannung auf seine Rede, auch Berkel Zorbas und Joseph Adam.
Der eine wirkte ruhig und gelassen, der andere atmete schwer. Bereits die ersten Sätze des Präsidenten lösten auch dessen Spannung, und sie erhoben ihre Gläser und stießen voller Dankbarkeit an. Aber bevor sie den ersten Schluck trinken konnten, knatterten am Waldrand des Gästehauses, an dem sie Bodygards bewachen sollten, plötzlich die Maschinenpistolen los. Das Leben von Berkel Zorbas und Joseph Adam erlosch.
Die Eilmeldungen darüber veränderten die weltweite Stimmung. Als auf den Leinwänden plötzlich Bilder der blutverschmierten Leichen flimmerten, brach unter den hunderttausenden Demonstranten in Australien, in Südafrika und in anderen Ländern der südlichen Hemisphäre ein unbeschreiblicher Begeisterungssturm los. Die Hassgesänge verwandelten sich in Jubelschreie, Wildfremde fielen sich in die Arme, Glückstränen verschmierten die ausgemergelten Gesichter, die die unerhoffte Freude kurz aufhellte, obwohl jeder eigentlich wusste, dass ihn dieses erfolgreiche Attentat nicht von seinem Leidensweg erlösen würde.
Durch die Kundgebungen der Liebe in den Saharastädten, in Abestan, in Deutschland oder in den USA liefen mit der ersten Nachricht Wellen des Entsetzens. Minutenlang herrschte fassungsloses Schweigen, und auch hier verschmierten Tränen die sonst so zufriedenen Gesichter.
Doch dann fand Einer die richtigen Worte – der US-amerikanische Präsident, der vor den hunderttausenden Demonstranten seine Rede noch nicht beendet hatte. Als ihm die Nachricht von den grausamen Morden übermittelt wurde, schwieg auch er für einen Moment, trat dann aber entschlossen wieder ans Mikrofon: »Dieses abscheuliche Verbrechen erschüttert uns alle. Wir haben einen unersetzbaren Verlust erlitten. Aber die Erinnerung an diese großen Männer wird immer in unseren Herzen wohnen. Sie haben unseren Untergang abgewendet. Wir sind ihnen zu ewigem Dank verpflichtet.«
Aber zusammen mit Berkel Zorbas sollte auch der deutsche Messias auferstehen.
Lange Zeit hatte Adam zwar verstanden, dass Zorbas stets von seinen Leibärzten begleitet wurde, aber nicht geahnt, warum zu deren Tross auch zwei junge, offensichtlich völlig beschäftigungslose Männer gehörten, die alle paar Wochen ausgewechselt wurden. Die kamen von San Borondon, nur so viel erfuhr er, der rätselhaften Insel im Atlantik, auf der es noch flugsaurierähnliche Vögel gab.
Erst vor der zweiten Klimakonferenz hatten die abestanischen Ärzte auch ihn gründlich untersucht, und seitdem gehörten, wenn er Zorbas begleitete, zu dessen Tross nicht mehr zwei junge Männer, sondern vier.
Die Ärzte hatten sich jahrelang auf einen Notfall vorbereitet und arbeiteten jetzt präzise und schnell. Mit ihren transportablen Herz-Lungenmaschinen stabilisierten sie die Lebensfunktionen. Detaillierte Untersuchungen zeigten sofort, dass beide Herzen und Lungen nicht mehr zu retten waren. Also entnahmen sie zwei jugendlichen Donatoren diese Organe und transplantierten sie.
Die weltweiten Veranstaltungen der Liebe und des Zorns waren längst beendet, da flimmerten auf den Bildschirmen neue Bilder: Berkel Zorbas und Joseph Adam lebten!
REIFUNG
Über Joseph Adams großen Triumph bei der Parteigründung berichteten seriöse Zeitungen sehr sachlich. Auf deren Seiten wurden Bilder von ihm am Rednerpult, nach der Wahl zum Parteivorsitzenden, bei der er über 90 Prozent Ja-Stimmen erhalten hatte, oder auf den Schultern seiner Anhänger, die ihn begeistert durch den Saal trugen, gedruckt. Die Boulevardzeitungen zeigten dagegen Bilder von Magda, wie auch sie ihm gebannt zuhört, wie sie die Bühne betritt, und wie sie ihn umarmt.
»Geheimnisvolle Schöne an Adams Seite«, titelte das Zentrale Kampfblatt der Mächtigen, das sich auch Zeitung nannte.
Andere schrieben: »Strahlende Schönheit« – »Das schönste Lächeln der deutschen Politik« oder »Sympathieträgerin.«
»Das passt mir überhaupt nicht«, meinte Magda, aber sie lächelte dabei.
Joseph führte sie vor einen großen Spiegel: »Überzeuge dich doch selbst. Du weißt ja, dass sie recht haben.«
Und die der Spiegel zeigte, war nicht mehr die Dorfschwalbe aus dem Harzvorland, sondern tatsächlich eine strahlende Schönheit. Nach der Entbindung war sie wieder rang und schlank wie eh und je geworden. Sogar ihre Brüste, die Lena zwei Jahre lang gestillt hatten, wirkten mädchenhaft und straff. Um das wieder zu erreichen, hatte sie als Wundermittel kaltes Wasser voller Eiswürfel angewandt.
Ihr langes, dunkelblondes, nur in den Spitzen gelocktes Haar umrahmte ein ebenmäßiges Gesicht mit hoher Stirn und großen blauen Augen, die oft eine kindliche Neugierde ausdrückten, und mit einer Nase im griechischen Profil. Auch das rechte Ohr, hinter das sie die Haare legte, das Kinn und die faltenlosen Wangen waren wohlgeformt. Jedes Detail entsprach dem zeitgemäßen Schönheitsideal, das ja auch kalt wirken könnte, aber bei ihr erzeugte etwas ganz Besonderes, Einmaliges bei jedem einen unvergesslichen Eindruck – ihr strahlendes, ungeheuer sympathisches Lächeln. Damit nahm sie jeden sofort für sich ein.
Nein, nicht jeden, wie sich schnell zeigen sollte, nicht die Reporter des Kampfblattes.
Joseph beeindruckten deren Meldungen zuerst nicht.
»Damit werden wir jetzt leben müssen«, meinte er locker.
»Naivling«, schimpfte seine Tante Sarah, »du hast zwar in den letzten Jahren viel gelernt, bist aber manchmal noch total unreif.«
»Warum denn schon wieder?«
»Wach auf! Wenn der Feind dich lobt, müssen in dir alle Alarmglocken läuten. Jetzt berichten die schon tagelang über Magda. Die bereiten doch etwas vor. Das spüre ich.«
»Sollen sie doch.« Ihr Neffe lächelte herablassend.
Aber dieses Lächeln verging ihm, als er am nächsten Tag die neueste Ausgabe in den Händen hielt. Ein groß aufgemachtes Foto zeigte Magda inmitten ihrer österreichischen Freunde, und darauf war sie unübersehbar hochschwanger. Und am nächsten Tag zeigte ein Foto Magda im knappen Bikini am Strandbad Wannsee, und ein fettgedruckter Pfeil deutete auf einen vergrößerten Ausschnitt ihres Bauches, und der trug die typischen Schwangerschaftsstreifen. Die balkendicke Überschrift lautete: »Wo ist Adams Kind?«
Am dritten Tag erschien ein Bild von Joseph Adam mit einer verzerrten, abstoßend wirkenden Grimasse, die man aus der Aufzeichnung einer seiner Reden herausgefiltert hatte, und darunter stand die Frage: »Ist Adam ein Kindesmörder?«
Bis zu dieser Frage hatten auch Josephs Parteifreunde verächtlich geschwiegen, aber jetzt klingelte das Telefon in seinem Büro fast ununterbrochen. Sein Kollege Haberecht drückte klar aus, was auch andere dachten: »Jetzt geht es nicht mehr um dich oder um Magda, jetzt geht es um die Partei. Bring das ins Reine. Sofort, unverzüglich!«
Auch bei Tante Sarah klingelte das Telefon. Der Fürst Golewani meldete sich aus Österreich: »So geht das nicht weiter! Wir müssen diese Lawine aufhalten, bevor sie bis zu meiner Familie rollt.«
»Das sehe ich auch so. Aber das Beste wäre, wenn du dich darum kümmern würdest. Du hast doch einen guten Draht zu euren Medien.«
Ohne langes Gerede stimmten sie alles Notwendige ab.
Wenig später brachte auch eine Wiener Boulevardzeitung ein Foto von Magda. Daneben wurde der Grabstein ihres Kindes auf einem Wiener Friedhof gezeigt, aber dessen genauer Standort zur Wahrung der Totenruhe verheimlicht. Der bekannte Direktor einer Privatklinik bedauerte zutiefst, dass Magdas Kind nur so kurz gelebt hätte und wegen einer Fehlbildung am Herzen bald nach der Geburt verstorben wäre. Nach seiner Meinung über die deutschen Boulevardzeitungen gefragt, meinte er nur: »Dazu muss ich nichts sagen, die kommentieren sich selbst.«
Die deutschen Zeitungen brachten darüber nur eine Kurzmeldung und fanden sofort eine neue Sensation – ein Mitglied der englischen Königsfamilie war fremdgegangen. Dieses unfassbare Ereignis bestimmte nun tagelang die Schlagzeilen.
»Willst du klagen oder forderst du eine Gegendarstellung?«, fragte Magda ihren Freund.
»Darüber habe ich nur kurz nachgedacht«, antwortete er, »aber was sollte das bringen? Das würde denen doch nur die Möglichkeit geben, alles noch einmal hochzukochen. Also Schwamm drüber.«
»Recht so«, bestätigte seine Tante, »du bist lernfähig.«
»Okay, das ist auch in meinem Interesse«, meinte Magda und äußerte trotzdem ihre Bedenken, »ein Fleck wird an uns bleiben und damit auch an deiner Partei. Nach der vorletzten Umfrage wart ihr schon an der Fünf-Prozent-Hürde, aber jetzt seid ihr auf 3 % zurückgefallen.«
»Ja, das stimmt, aber diesen Fleck kann ich mit etwas anderem wegwischen.«
»Womit denn?«, fragte Sarah, »sei dir da nicht so sicher. Die groß aufgemachten Berichte haben viele gelesen, die kleine Richtigstellung bestimmt nur wenige. Die wissen schon, was sie tun. Ein Sprichwort sagt ›Kein Rauch ohne Feuer.‹ Also erzeugen sie Rauch, und viele glauben, dass es ein Feuer geben würde. Also nochmals, wie willst du das wegwischen?«
»Warte es ab!« Joseph lachte selbstbewusst.
»Gefällt mir.« Magda stand im Zimmer ihrer Kommilitonin Bärbel vor der Kopie eines alten Gemäldes, die diese neu erworben hatte.
›Judith mit dem Haupt des Holofernes von Lucas Cranach‹, stand darunter. Diese Judith trug ein dunkelrotes Kleid, das an der Hüfte mit weißen Bändern festgeschnürt war, und am Hals eine breite, wuchtige Kette. In der rechten Hand hielt sie ein überlanges, breites Schwert, in der linken den abgeschlagenen, noch blutenden Kopf eines bärtigen Mannes mit weit geöffnetem Mund.
»Holofernes?«, fragte Magda.
»Keine Bildungslücke. Über diese biblische Gestalt musste ich mich auch erst schlau machen. Als assyrischer Feldherr belagerte er eine jüdische Stadt. Judith kam nur wegen ihrer großen Schönheit bis zu ihm durch. Er hoffte auf eine Liebesnacht und entließ seine Diener. Aber sie machte ihn betrunken, enthauptete ihn und rettete so ihre Stadt.« Sie blickte Magda an und lächelte spöttisch.
»Woran denkst du?«
»Die Schöne und der Feldherr bzw. der Politiker, vieles wiederholt sich.«
»Ja, manchmal könnte ich ihn auch erschlagen.«
»Hälst du es denn aus, wenn er höher und höher steigt?«
»Muss ich ja, uns verbindet viel.«
»Es gibt auch andere Männer. Nach dir drehen sich doch alle um. Du könntest an jedem Finger zehn haben.«
»Ach«, Magda winkte ab, »wir kennen uns schon seit wir 15 waren.«
Um das Thema zu wechseln, deutet sie auf das Bild. »Das Original würde ich gerne mal sehen.«
»Kannst du, es soll im Jagdschloss Grunewald hängen. Ich bin auch neugierig darauf.«
»Wollen wir gleich hinfahren? Wir haben heute doch Zeit.«
»Nein«, wehrte Bärbel überrascht ab, »heute auf keinen Fall.«
Magda blickte verwundert. Sie konnte ja nicht ahnen, dass ihre Kommilitonin noch etwas vorbereiten musste.
Erst Tage später fuhren sie zu dem Schloss, das an einem See tief im Wald lag, weit abseits von dem Westberliner Großstadtgetümmel. Alle Gebäude waren blendendweiß gestrichen und besaßen rote Wabendächer. Das Hauptgebäude wirkte mit seiner geringen Breite und nur 3 Stockwerken nicht besonders repräsentativ. Es hatte dem Kaiser ja auch nur für gelegentliche Jagden gedient, zum letzten Mal schon viele Jahre vor dem 1. Weltkrieg, wie eine Angestellte erläuterte.
»Judith mit dem Haupt des Holofernes?«, fragte sie dann, »das tut mir aber leid. Dieses Gemälde ist jetzt im Schloss Charlottenburg.«
»Schade.« Magda war enttäuscht.
Ihre Kommilitonin wirkte jedoch nicht so und blickte auf ihre Uhr: »In der Nähe ist ein idyllisches Restaurant. Wollen wir dort einen Happ essen, wenn wir schon mal hier sind?«
Im Seerestaurant war am frühen Nachmittag noch kein Gast und draußen nur ein Tisch gedeckt. Der stand etwas abseits geschützt von Fliederbüschen, deren Blütenduft Magda tief in sich einsog. Auf einer schneeweißen Decke standen nur zwei Gedecke, dazu ein festlicher Leuchter und eine hohe schmale Vase ohne Blumen.
»Für wen wird das sein? Lass uns doch mal gucken.«
»Na hör mal«, empörte sich Magda, »seit wann bist du so neugierig? Ich erkenne dich gar nicht wieder.«
»Komm schon.« Bärbel fasste sie an der rechten Hand und zog sie einfach mit.
Als sie den Tisch erreicht hatten, trat Joseph hinter den Fliederbüschen hervor. Er trug dieses Mal nicht eine seiner Kombinationen, sondern einen dunkelblauen Anzug mit weißem Hemd und dunkelroter Krawatte. In einer Hand hielt er eine langstielige rote Rose.
»Liebe Magda, wir kennen uns schon ewig. Wir haben zusammen viel durchgemacht und unbeschadet überstanden. Du bist nicht nur eine wunderschöne Frau geworden, sondern auch eine tolle Kameradin, mit der ich durchs Leben gehen möchte. Willst du mich heiraten?«
Magda blieb vor Überraschung kurz der Mund offen stehen. Dazu hätte gepasst, dass sie nun glücklich ihr Ja hauchte. Aber sie lachte spöttisch: »Willst du damit in die Medien kommen und den Fleck wegwischen oder geht es auch ein bisschen um mich?«
»Na hör mal, nur um dich.«
Sie blickte ihn prüfend an: »Ich kenne dich, du willst zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.«
Sein Lächeln erlosch.
»Na gut«, sagte sie schnell und schmiegte sich an ihn, »versuchen wir es miteinander.«
Bärbel wandte sich ab: »Meine Aufgabe ist ja erledigt.«
Viele prominente Schäfchen hatten die katholischen Priester in Westberlin nicht. Die Partei »Die Anderen« zu wählen, würden sie von ihren Kanzeln zwar nicht empfehlen, aber dass sich deren Chef bei ihnen trauen lassen wollte, erregte sogar das Interesse ihres Bischofs.
Joseph wählte alles in Weiß, eine weiße Kutsche, makellose Schimmel davor gespannt, obwohl der Kutscher lieber Rappen genommen hätte, Magda im schneeweißen, Unschuld bezeugenden Brautkleid, er im leuchtend weißen Hemd, die Blumenmädchen in weißen Kleidchen.
Die Kameramänner hatten Mühe, den Zuschauern kontrastreiche Bilder zu liefern und mussten sich mit Magdas dunkelrotem Rosenstrauß und Josephs dunkelblauem Anzug begnügen.
Auch der Bischof erschien auf den Bildschirmen, er hatte also richtig kalkuliert. Und doch musste er sich über Joseph und über dessen Priester ärgern, denn der hatte den Bräutigam nicht auf den Vermählungsspruch vorbereitet.
»Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau«, sagte er ihm vor, aber Joseph reagierte darauf nicht. Erst an den bohrenden Blicken des Bischofs erkannte er, dass irgendetwas von ihm erwartet wurde.
»Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau«, wiederholte der Bischof.
»Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau«, echote Joseph nun brav.
»Ich verspreche dir Treue.«
»Ich verspreche dir Treue.«
Und gemeinsam kamen sie bis zum Ende des Spruches gut durch.
Tränenreich umarmten die Mütter ihre Kinderchen, und sogar Magdas Vater brachte es über sich, diesen Kerl, der einmal seine Tochter einem schwer bewaffneten Sonderkommando ausgesetzt hatte, an sich zu drücken.
Nur Jesus am Kreuz blieb angesichts der prunkvollen Zeremonie stumm und unbeweglich, auch als der Bischof zu ihm aufblickte und murmelte: »Ja, schon gut, ich weiß ja, dass du nur mit italienischen Priestern sprichst.«
Aber plötzlich wirkte Jesus’ Gesicht heiter. Das konnte ja nur eine Täuschung gewesen sein, vielleicht hatte sie ein in die Kirche fallender Sonnenstrahl verursacht.
Irritiert wandte sich der Bischof ab und entdeckte erst jetzt die junge Frau mit dem kleinen Mädchen, die weit hinter der Hochzeitsgesellschaft in der allerletzten Bank im Schatten einer Säule saßen, einfach irgendwie unbeteiligt wirkten und leicht übersehen werden konnten, von den Reportern auch übersehen wurden.
Abends, als der Fotograf bereits die fertigen Fotos brachte, bemerkte sie nur Magda darauf und flüsterte Joseph etwas ins Ohr.
»Nicht möglich«, antwortete er, »und wenn schon! Nun werde ich sie bestimmt nicht wiedersehen.«
»Wenn du dich da mal nicht täuschst.«
Nach dieser Hochzeit schrieben die Reporter wieder über das schönste Gesicht der deutschen Politik, und vielleicht erinnerten sie sich sogar selbst nicht mehr an ihre kritischen Berichte über Joseph und Magda. Und worüber sie nicht berichteten, das interessierte auch die Wähler nicht. Bei der nächsten Umfrage überwand Josephs Partei erstmals die Fünf-Prozent-Hürde.
Der innere Zirkel des Arbeitgeberbundes traf sich nicht in einem Sylter Gourmetrestaurant, sondern in der strandnahen Villa eines Mitgliedes. Aber auch dort musste keiner darben. Als die Gäste eintrafen, hantierte in der Küche bereits ein bekannter 2-Sternekoch mit seinen Helferinnen, und die in Goldfarben gedruckte Karte versprach ein exklusives Menü über 14 Gänge mit den dazu passenden edlen Weinen. Der Champagner zur Begrüßung und die Kanapees mit Kaviar, Entenbrust oder Edelfischen wurden auf der Terrasse gereicht. Hier und verteilt auf den gepflegten Rasenflächen standen einzelne Tischchen, an denen sich kleine Gesprächsgruppen bildeten.
Zum geeisten Süppchen und zur Sushi Variation wurde bereits in den Wintergarten gebeten, von dem man ebenfalls einen weiten Blick über das Meer hatte, das an diesem Tage fast spiegelglatt war, und von dem nur ein zartes Lüftchen herüberwehte.
»Das stimmt mich hoffnungsvoll«, meinte ironisch Herr von Söben, der Vorstandschef eines Energiekonzerns, »dann dürfte uns daraus kein ernsthafter Konkurrent erwachsen.«
»Solche Tage sind hier eher selten«, widersprach der Gastgeber, »meist weht ein starker Wind.«
Er blickte in seine Gesprächsagenda: »Womit wir schon beim ersten Punkt wären – unser Verhältnis zu diesem Joseph Adam und seiner neuen Partei. Seine Vita habe ich zusammenstellen lassen. Ich nehme an, dass sie jeder gelesen hat.«
Alle nickten zustimmend.
»Um es kurz zu wiederholen, darin gibt es keinen Ansatzpunkt, um ihn sofort abschießen zu können. Also sollten wir es wieder mit unserer speziellen Methode versuchen, die uns sowieso meist die größten Erfolge brachte, wir sollten ihn einbinden.«
»Wie schätzen Sie in diesem wohl sehr speziellen Fall unsere Erfolgsaussichten ein?«, fragte ein Großunternehmer, »wer ›Die Anderen‹ führt, will sich ja wohl auch anders verhalten?!«
»Bitte, Herr Neumann.« Der Gastgeber forderte einen Referenten auf, dazu Stellung zu nehmen.
»Ich verweise auf einen besonderen Punkt in seiner Vita, auf seine Tumorerkrankung. Die hätte ihn sehr verändert, berichteten meine Mitarbeiter. Seitdem würde er nach Erfolg und Aufstieg gieren. Er wünsche sich, dass einmal etwas von ihm bleiben würde.«
Ein Gelächter unterbrach ihn.
»Ja, tatsächlich, das bewies ja auch sein Verhalten auf diesem Gründungsparteitag.«
»Und was schlagen Sie deshalb vor?«
»Um den ersten Kontakt zu ihm zu bekommen, brauchen wir ein Thema, das nicht einmal sein Vorstandskollege, dieser Haberecht, ablehnen könnte.«
»Also?«
»Darauf hat Herr von Söben gerade angespielt. Wir sollten ihn zur Inbetriebnahme dieser ersten großen Windkraftanlage einladen, die manchen ja schon als echte Alternative zu Atom- und Kohlekraftwerken gilt. Diese Einladung wird er annehmen, muss er annehmen.«
Der Gastgeber blickte in die Runde: »Einverstanden?«
Keiner widersprach.
»Gut, dann machen wir das so.«
Er gab dem Koch, der schon ungeduldig wartete, ein Handzeichen. »Damit kommen wir zur Gänseleber mit Gewürzaprikosen. Dazu wird ein vorzüglicher, 50 Jahre alter Dessertwein gereicht.«
Joseph Adam wartete in seinem Auto neben der weit einsehbaren Straße, bis die Begleitfahrzeuge der Polizei ihm die Ankunft des Ministerpräsidenten ankündigten. Deshalb erschien er fast gleichzeitig mit dem zur Inbetriebnahme der Windkraftanlage und wurde von ihm vor allen Augen per Handschlag begrüßt.
Während der Ansprache des Ministerpräsidenten stand er in der ersten Reihe, und als der den roten Knopf gedrückt hatte und sich das riesige Windrad in Bewegung setzte, hielt ihm ein Reporter sein Mikrofon unter die Nase.
»Ein historischer Tag«, sagte Joseph, »da stimme ich dem Redner zu, hier und heute beginnt die energiepolitische Zukunft.«
»Aber, gestatten Sie einen Widerspruch, Herr Adam, die Kosten für den Windstrom sind doch riesig, der ist doch absolut nicht wettbewerbsfähig. Diese Anlage wird dem Steuerzahler auf der Tasche liegen.«
»Noch«, meinte Joseph zuversichtlich, »noch! Es ist ja auch eine Versuchsanlage. Wir werden mit ihr viel lernen und es später besser machen.«
»Glauben Sie, dass diese Technologie eine Zukunft hat?«
»Ja, davon bin ich fest überzeugt, denn wir brauchen Alternativen zu den herkömmlichen Kraftwerken. Dass wir gegen die Atomkraftwerke sind, brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären. Aber auch die Verbrennung fossiler Energieträger können wir uns nicht ewig leisten. Der Anstieg des Kohlendioxidgehaltes in der Atmosphäre wird bedrohlich.«
Diesen Satz hätte Joseph selbst vor wenigen Monaten noch nicht ausgesprochen, aber eine kleine Zeitungsnotiz hatte seine Meinung verändert.
Magda hielt ihm die Zeitung hin und fragte: »Hast du das gelesen?«
»Was?«
»Das von den Außerirdischen.«
»Nein.«
»Hier steht«, sie lachte unsicher, »in Mexiko hätten Außerirdische einen Wissenschaftler entführt und ihn vor einem dramatischen Klimawandel gewarnt. Die Menschheit würde mit den Emissionen ihren eigenen Untergang herbeiführen.«
»Aha.«
Sie blickte auf: »Das interessiert dich wohl nicht besonders?«
»Nein, viele Reporter schreiben viel, wenn der Tag lang ist. Und jeder Tag hat 24 Stunden.«
»Sollte dich aber interessieren. Hier wird auf diverse Literaturstellen verwiesen. Lies die doch mal, für deine Partei könnte das ein wichtiges Thema werden.«
»Mache ich.«
Auch der Reporter hatte davon noch nichts gehört.
»Bedrohlich?«, fragte er verwundert, »aber Herr Adam, darüber könnten doch nur Spinner reden.«
»Spinner? Nein, ich denke, dass das Vordenker sind.«
Im Festzelt für Prominente saßen Joseph und Magda noch nicht am Tisch des Ministerpräsidenten, aber unmittelbar daneben mit Ehrengästen aus der Wirtschaft. Viele zeigten sich erfreut, den aufstrebenden Politiker und seine reizende Gattin persönlich kennenzulernen.
»Gestatten Sie, mein Name ist Neumann. Ich vertrete hier den Arbeitgeberverbund«, sagte sein Nachbar zur Linken und reichte ihm die Hand, »angenehm.«
»Ganz meinerseits.«
»Wenn ich, ohne mit der Tür ins Haus fallen zu wollen, meine Erwartungen direkt äußern darf, ich sehe Sie bereits im nächsten Bundestag sitzen.«
»Vermuten Sie das, weil ich meinen Wohnsitz von Westberlin nach Frankfurt verlegt habe?«
»Auch deshalb. Dieses Signal hat jeder Insider verstanden. Zumindest alle, die wissen, dass Westberliner nicht in den Bundestag gewählt werden können.«
»Genau aus diesem Grund bin ich umgezogen.«
»Sie werden aber für die Landesgruppe Niedersachsen kandidieren?«
»Nein, für Hessen.«
»Auf Platz 1?«
»Ja.«
»Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Nach der Wahl werden wir uns ja in Bonn gelegentlich begegnen.«
»Gehören Sie zu den Lobbyisten?«
»Ehrlich gesagt, ich mag dieses Wort nicht. Es hat so einen negativen Touch bekommen. Wir sehen uns eher als Berater. Beratung schadet niemandem, auch keinem Politiker.«
»Auch uns nicht, meinen Sie? Aber können Sie darauf hoffen? In den Medien werden wir doch als beratungsresistente, bornierte Ideologen bezeichnet.«
»In denen vielleicht, aber wir bemühen uns um ein detaillierteres Bild. Und wir wissen, dass auch in Ihrer Partei die Einen so und die anderen so sind.«
Ihr Gespräch wurde unterbrochen, denn die Kellner servierten den ersten Gang des leckeren Menüs mit ausgewählten Weinen. Magda hielt sich lieber an den köstlichen, prickelnden Champagner. Ein junger Kellner, der sie ungeniert anhimmelte, schenkte ihr immer wieder nach.
»Ein schöner Tag«, sagte sie beschwipst so laut, dass es Neuman hörte.
»Ein interessanter«, meinte Joseph.
»Wirst du solche Einladungen jetzt öfter annehmen?«
»Wenn du willst, warum nicht?«
»Ich will.«
Neumann berichtete seinem Verbandschef brühwarm jedes Detail dieses Zusammentreffens.
»Dann könnten wir also auch bei seiner Frau ansetzen«, antwortete der.
»Mein Respekt, wie immer haben Sie sofort des Pudels Kern erfasst.«
Neumann überreichte einen Kurzbericht. »Das ist ihre Vita.«
»Na, lassen Sie mal sehen. Sie ist also mit ihrem Studium fertig und sucht in Frankfurt noch eine Arbeit. Sie will nicht nur die Politikergattin spielen. Sehr löblich. Und sie vermisst dort schon ihren Berliner Freundinnenkreis, muss sich in Frankfurt erst einen aufbauen. Okay. Und Sie meinten, dass ihr die erste Feier in der VIP-Lounge gefallen hätte?«
»Offensichtlich sehr.«
»Okay, dann haben wir ja einige Ansatzpunkte. Fangen wir bei ihrem Arbeitsplatz an, natürlich mit der gebotenen Vorsicht. Keiner aus Adams Partei darf erkennen, dass wir an den Stellschrauben drehen. Sie schreiben hier, dass sie BWL studiert hätte, aber auch künstlerisch interessiert wäre. Vielleicht könnten wir sie als Kulturfunktionärin etablieren und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aus den vielen Unternehmergattinnen, die in Kunst und Kultur machen, ergäbe sich dann gleich ihr neuer Freundinnenkreis. Prüfen Sie mal, ob sich da etwas anbietet.«
»Habe ich schon. Zum Beispiel sucht der Dezernent für Kultur und Wissenschaften eine Referentin. Aber ich befürchte, dass der keine Seiteneinsteigerin nehmen würde.«
»Kein Problem. Das regele ich mit dem Bürgermeister.«
Frankfurter Arbeitgeber trafen sich mit den Bundestagsabgeordneten des Landes und folgten der Anregung der neuen Kulturreferentin, Magda Adam, gemeinsam das Kunstmuseum zu besuchen. Im Foyer, in dem vor der offiziellen Begrüßung Fingerfood zu Sekt oder Orangensaft gereicht wurde, bildeten sich Gesprächsgruppen.
Magda ging von einer zur anderen und kurz auch zu Joseph, der hier noch niemanden kannte und einsam und verlassen in einer Ecke stand, und fragte ihn: »Was siehst du?«
»Was soll ich sehen?« Er überblickte das Foyer. »Verschiedene Gruppen von Wirtschaftsbossen und Politikern.«
»Genauer.«
Er zuckte mit den Achseln: »Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Sieh dort.« Sie deutete auf 5 miteinander diskutierende Gäste. »Dort reden mehrere Arbeitgeber mit einem Politiker. Dort ist es genauso. Aber dort …«, sie blickte Joseph prüfend an, »fällt jetzt der Groschen?«
»Ach so«, er lachte auf, »dort steht der berühmte Superbanker Müller im Mittelpunkt, und mehrere Politiker scharen sich um ihn.«
»Genau! Du weißt, was das bedeutet?«
»Klar. Habe ich ja schon vorher gewusst.«
»Na gut, dann komm, ich stell dich dem Banker vor.«
Nach der Begrüßung führte der Museumschef seine Gäste sofort zu Andy Warhols Werken. Banker Müller trat nahe an das Bild »Green Disaster ten times« heran, also folgten ihm alle.
»Aus der Nähe kann man ein einziges Bild detailliert studieren«, erläuterte der Direktor, »Sie erkennen das schwer beschädigte Autowrack, den darin eingeklemmten Körper, dessen linker Arm das Gesicht verdeckt, das Opfer also anonymisiert. Aber lassen Sie uns wenige Schritte zurücktreten. Jetzt können Sie sich nur noch mit bewusster Anstrengung auf ein einziges Bild konzentrieren. Der Gesamtaufbau, je 5 Bilder in 2 Reihen, erinnert uns an einen Filmstreifen. Wir assoziieren deshalb automatisch auf minimale Veränderungen von Bild zu Bild. Aber die gibt es nur im Kontrast, es ist immer das gleiche Bild. Die brutale Situation wirkt aussichtslos für das Opfer.«
»Wollte Warhol damit die Lust am Grauen befriedigen?«, fragte Joseph Adam.
»Er hatte plötzlich erkannt, dass grausame Bilder für uns alltäglich geworden sind und deshalb im Grunde keine Wirkung mehr erzielen. Deshalb begann er seine Serie zu Katastrophen, zu der dieses Bild gehört.«
»Ein weites Feld«, meinte der Banker.
»Sie sagen es. Aber ich denke …«
Während der Direktor weiter über die Gründe dieser Schaffensperiode mutmaßte, zerfiel der zuvor geschlossene Zuhörerkreis wieder in Gruppen, und bei den nächsten Bildern gab er nur noch kurze Erläuterungen.
Auch Joseph fand jetzt einen Gesprächspartner. Neumann, der Verbandsreferent, dessen Erwartungen, dass Joseph Adam in den Bundestag einziehen würde, sich erfüllt hatten, war verspätet eingetroffen.
»So einsam?«, fragte er lächelnd und gab sich selbst die Antwort, »die hiesigen Topmanager wissen mit einem Bundestagsabgeordneten Ihrer Partei noch nichts anzufangen, obwohl Sie ja im Wirtschaftsausschuss tätig sind«
»Blieb mir nichts weiter übrig. Mein Kollege Haberecht drängte darauf, selbst in den Umweltausschuss zu gehen.«
»Ich weiß. Aber ich denke, dass Sie es besser getroffen haben als er. Der Kanzler wird Sie zu seiner Indienreise mitnehmen, bei der ihn wieder viele Topmanager begleiten werden.«
»Mich? Bisher hat er mich noch nicht eingeladen.«
Neumann lachte amüsiert: »Unter uns, im Vertrauen, aber Ihnen kann ich das ja sagen. Sie wissen, wie der Hase läuft. Das hat der auch erst jetzt erfahren.«
Joseph blickte einen Moment verblüfft, aber dann verzog er sein Gesicht.
Magda beobachtete ihn gerade und wirkte kurz irritiert.
»Worüber habt ihr gesprochen?«, fragte sie ihn später.
»Warum fragst du?«
»Du hast gegrinst, so, so, ich konnte es nicht richtig deuten, so triumphierend, ja, triumphierend! Ihr wirktet wie zwei Verschwörer.«
»Ach«, wehrte Joseph ab, »das war eher Unsicherheit.«
Und damit gab er sich selbst das Stichwort, um Magda abzulenken.
»Du weißt ja, wie unsicher ich in den ersten Monaten in Bonn war. Alle neuen Abgeordneten brauchen Zeit, um sich einzuleben. Und viele versinken dann schnell im Alltag. Diverse Sitzungen, nicht nur im Plenum, sondern auch mit Mitarbeitern, in der Fraktion, in der Landesgruppe oder in Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Kontakt halten zu dem Wahlkreisbüro, noch abends diverse Treffen mit Gremien des Bundestages oder Wirtschaftsvertretern und mit vielen anderen.«
»Lobbyisten?«
»Auch mit denen, oft verbunden mit einem Essen. Nicht selten geht es bis weit nach Mitternacht. Manche stöhnen, dass ein 24-Stunden-Tag nicht reichen würde.«
»Und du bist ja auch noch Parteivorsitzender.«
»Eben!«
»Aber du hast kein leichenblasses, ständig übernächtigt wirkendes Gesicht wie zum Beispiel dein Kollege Haberecht. Was machst du anders als der?«
»Ich kann Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden. Ich muss nicht zu jedem Scheiß gehen. Und es macht mir nichts aus, wenn mir Wähler empörte Briefe schreiben, weil sie mich nicht im Plenum gesehen haben. Da habe ich anderes zu tun, als mir dort den Hintern breit zu sitzen.«
»Und was ist das?«
Joseph lächelte: »Du weißt doch, dass ich nicht ewig als Hinterbänkler gelten will.«
»Frau Adam, wenn ich bitten dürfte!«
Der Direktor ersparte Joseph eine bohrende Nachfrage.
Außerhalb der Sitzungsperioden war Joseph meist in seinem Wahlkreis, also auch bei Magda. Aber auch in Frankfurt hatten sie nur wenig Zeit füreinander, denn Magda war schnell zur rechten Hand des Kulturbürgermeisters geworden, der viele Abendtermine auf sie ablud. Dafür durfte sie sich ab und zu wenige Tage frei nehmen, um Joseph in Bonn zu besuchen. So oft es möglich war, begleitete sie ihn dort zu Abendveranstaltungen. Deren Anzahl stieg, seitdem Joseph den Kanzler zu Auslandsterminen begleitete, und deren Teilnehmerkreis veränderte sich stark. Nicht nur die Lobbyisten der Industrie hatten den vielversprechenden Abgeordneten Adam entdeckt, auch Vorstandsvorsitzende hielten es nicht mehr für vergeudete Zeit, mit ihm zu sprechen.
Seinem Kollegen Haberecht schien das in die Karten zu spielen. Der kultivierte schon äußerlich die Unterschiede zu Joseph Adam. Wenn der immer wohlfrisiert und gepflegt in seinen vornehmen Kombinationen auftrat, erschien Haberecht mit seinem Rauschebart und schulterlangen Haaren in Jeans und Pullover. Während Joseph es für zweckmäßig hielt, als Bundestagsabgeordneter Probleme mit der Energiewirtschaft zu diskutieren, fühlte sich Haberecht weiter als Angehöriger der außerparlamentarischen Opposition. Auf den Bildschirmen war er meist bei Blockaden vor Atomkraftwerken zu sehen. Wenn er auch bei der Parteigründung neben Joseph Adam wie ein grüner Junge gewirkt hatte, gelang es ihm nun doch, einige von dessen Anhängern auf seine Seite zu ziehen.
»Der schadet dir«, stellte Magda fest, »ewig kann das nicht so weitergehen.«
»Kommt Zeit, kommt Rat«, meinte Joseph gelassen, »so Gott will, wird sich entscheiden, wer die Partei besser führt.«
Bereits kurz vor dem 26. April hatte Joseph Magda eine Wanderung von Bonn zum Kloster Heiterbach vorgeschlagen.
»Etwa hin und zurück?«
»Warum nicht? Das Wetter soll ja schön werden.«
»Eine Strecke sind 13,9 Kilometer.«
»Notfalls können wir zurück ja ein Taxi nehmen.«
Das Wetter hielt, was die Meteorologen versprochen hatten, strahlender Sonnenschein, kaum eine Wolke am tiefblauen Himmel und eine gute Sicht, die einen Blick über den Rhein bis zum Ahrgebirge ermöglichte. Doch an diesem Tag hatten beide kein Auge dafür.
»Verdammt heiß für eine so lange Wanderung«, stöhnte Joseph schon vor Ramersdorf, »die ersten warmen Tage sind sowieso immer belastend.«
»Vielleicht kann uns das wenigstens ablenken.«
»Ablenken? Heute? Ich denke immerzu daran.«
»Hier ist nicht viel runtergekommen«, meinte Magda zuversichtlich, »die Bayern hat es viel schlimmer erwischt. Dort hatte es ja stark geregnet, also den Staub aus der Atmosphäre gewaschen.«
»Aber auch bei uns tickt der Geigerzähler. Würdest du etwa Salat von hier essen?«
»Nein, das nicht. Die neuen Grenzwerte für Gemüse, die sie heute herausgegeben haben, sind doch insbesondere aus ökonomischen Gründen festgelegt worden.«
»Du sagst es.«
Joseph holte einen Zettel aus seiner Jackentasche, auf dem die Empfehlungen der Behörden standen. »Milch und andere Lebensmittel bevorraten, Kinder nicht rauslassen, nach einem Regen gründlich duschen …«
»Es reicht«, unterbrach ihn Magda. Sie blickte sich suchend um. Der Rheinpark war auch an diesem Samstag gut besucht, aber hinter ihm lagerte kaum jemand in der Rheinaue. Sie deutete auf eine Baumgruppe: »Komm, wir suchen uns dort ein Plätzchen, scheiß auf die geplante Wanderung.«
Minutenlang lagen sie schweigend in der Sonne.
»Es tickt«, sagte Joseph plötzlich.
»Ein komisches Gefühl ist das«, bestätigte Magda, »man will die ersten warmen Tage genießen, denkt aber nur an Tschernobyl. Wer weiß, was wir gerade einatmen oder auf uns runterfällt.«
»Ich hatte die gleichen Gedanken. Vor drei Tagen hat dieser dümmliche Innenminister noch herausposaunt, dass für uns eine Gefährdung absolut auszuschließen wäre. Und genau an diesem Tag drehte sich der Wind und blies alles zu uns. Die Schweden hatten ja schon die Radioaktivität gemessen, als die Sowjets noch alles verheimlichten, auch die Evakuierung von Prypjat.«
Er holte einen anderen Zettel heraus und las Magda die wichtigsten Ereignisse nach dem Supergau vor.
»Wozu hast du den mit?«
»Um es zu verinnerlichen.«
»Wofür?«
»Für die Interviews und Diskussionen im Fernsehen, die es geben wird«, sagte er leichthin.
Aber Magda kannte ihn zu gut: »Worauf zielst du ab?«
»Auf nichts Besonderes. Es ist doch klar, dass jetzt auch unsere Meinung gefragt ist.«
»Ja, das ist klar, aber du denkst noch an etwas anderes bzw. an einen anderen.«
»So?«
»Ja. Und ich ahne schon an wen, an Haberecht.«
»Mag sein. Da spitzt sich einiges zu. Einmal muss ja eine Entscheidung fallen. Und ich glaube, dass Haberecht sie jetzt sucht. Eine bessere Chance kann er nicht bekommen.«
Sie wandte sich erregt ab: »Das kotzt mich an.«
»Was?«
»Der Supergau fordert jetzt schon viele Opfer. Künftig werden Zehntausende oder wer weiß wie viele deshalb vorzeitig sterben. Und Politiker wollen daraus Kapital schlagen.«
»Ich muss das nüchtern und sachlich sehen. Was immer ich mache, an den Tatsachen kann das überhaupt nichts ändern. Aber Haberecht und ich können nicht ewig als gleichberechtigte Parteivorsitzende zusammenarbeiten. Unsere Vorstellungen über die Entwicklung der Partei sind zu unterschiedlich. Einer muss sich durchsetzen. Ich werde erst einmal abwarten, was er jetzt macht. Im Moment triumphiert er und stolziert wie ein Gockel durch den Bundestag. Er und seine Gruppe hätten ja schon seit Jahren vor einer solchen Katastrophe gewarnt.«
»Die spielt ihm ja tatsächlich in seine Karten«, meinte Magda nach kurzem Schweigen, »wenn jetzt eine Entscheidung fallen würde, dann für ihn. Würdest du dich jetzt gegen ihn wenden, würde er dich unangespitzt in den Boden rammen.«
»So weit bin ich auch schon.«
»Aber?«
»Ich muss jetzt langfristig denken, sehr langfristig.«
»Was meinst du?«
»An die weitere Entwicklung. Gestern wurde gemeldet, dass in bestimmten Regionen die Feldfrüchte untergepflügt werden müssten. Nicht etwa nur in der Sowjetunion, nein, auch bei uns in Deutschland. Im Moment sind die Menschen in Schockstarre, aber das wird sie aufschrecken. Die Diskussionen darüber und über die Atomkraftwerke werden sich lange hinziehen. Aber«, er lächelte zuversichtlich, »aber nicht ewig andauern. Heute schwingt das Pendel zu Haberecht, aber eines Tages muss es seine Richtung ändern.«
»Und wieder zu dir schwingen?«
»Ich denke schon.« Josephs Stimme wirkte wieder zuversichtlich. »Eine Zeitlang muss ich aber kleine Brötchen backen. Doch die werde ich nicht ungenutzt verstreichen lassen.«
So realistisch Joseph Adam die neue Situation bewertete, so falsch schätzte er deren Dauer ein. Was er eine Zeitlang genannt hatte, sollte Jahre erfordern. Erst ein neues, historisch zu nennendes Ereignis sollte sie wieder verändern.
Aber so weit war es jetzt noch nicht. »Die Anderen« bestätigten zwar ihre beiden Vorsitzenden, aber praktisch führte sie Haberecht alleine. Und er trieb die so genannten Altparteien vor sich her. Wenn deren Spitzenpolitiker nun auch über die Verringerung des Anteils an Atomstrom diskutierten oder sogar zögerlich das Wort Ausstieg in den Mund nahmen, wurde das als sein Erfolg gewertet.
Nach den nächsten Wahlen mussten für »Die Anderen« neue Bänke ins Plenum gestellt werden. Hinter den beiden Fraktionsvorsitzenden saß Joseph weiter neben Haberecht in der zweiten Reihe, aber sein Platz blieb oft leer. Manchmal sonderte er sich mit anderen Fraktionsmitgliedern in die hinteren Bänke ab, um irgendein Thema zu diskutieren, und dort redete er sogar mit Regierungsmitgliedern.
Erst als es keine Abkehr von den Atomkraftwerken gab und sogar Neubauten genehmigt wurden, wurde die Gruppe um Joseph wieder größer. Weil vorher der scheinbare Erfolg Haberecht zugeschrieben wurde, passierte das jetzt auch mit den Misserfolgen.
»Das Pendel ist umgekehrt«, sagte Joseph zu Magda.
»Dann bist du bald wieder obenauf.«
»Nein, nicht automatisch. Ich denke oft darüber nach, was ich machen muss, um wieder die Oberhand zu gewinnen. Und ich glaube, dass ich dafür ein völlig neues Thema brauche. Ein Thema, das für unsere Partei noch überhaupt keine Rolle spielt, das ich als erster in unsere Agenda bringe, am besten gegen Haberechts erbitterten Widerstand.«
»Welches?«
»Ja, das ist eben die Frage.«
Auch mit Tante Sarah, die nach wie vor seine wichtigste Beraterin war, diskutierte er darüber. Sie fand die Antwort nicht sofort, lud ihn dann aber überraschend nach Westberlin ein.
»Komm am Wochenende zu mir. Welche Termine du auch hast, lass sie platzen.«
»Aber ich …«
»Kein Aber, komm her und frage am Telefon nicht warum. Nur so viel, wir werden noch einen anderen Gast haben, einen ganz besonderen.«
Bundestagsabgeordnete nutzten die Transitstrecke über die Autobahn eher nicht. Aber Joseph wollte sich darauf einlassen, um wenigstens seine Vormittagstermine nicht absagen zu müssen. Die lange Wartezeit und die gründliche Prüfung seiner Papiere und des Kofferraums am Grenzübergang hielt er für normal. Hinter Eisenach blickte er alle paar Sekunden auf den Tacho, um die erlaubte Geschwindigkeit von 100 oder 80 Sachen auf den Holperstrecken ja nicht zu überschreiten.
Nur von dem freien Blick auf den Inselsberg ließ er sich kurz ablenken. Ein ehemaliger DDR-Bürger hatte ihm erzählt, dass manche Rennsteigläufer diesen steilen Hang rückwärts runterliefen, weil ihre überlastete Beinmuskulatur unerträglich schmerzte.





























