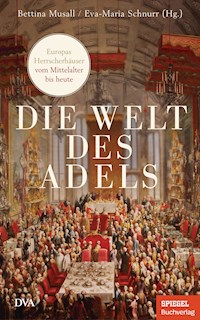
Die Welt des Adels E-Book
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der europäische Adel: Eine Klasse für sich
Wollten Sie nicht schon immer wissen, was bei Hofe wirklich passiert? Wie man sich in der höfisch-ritterlichen Welt kleiden und verhalten musste? Was Aristokratinnen heimlich in ihre Tagebücher schrieben, und welche Blaublüter doch tatsächlich selbst arbeiteten? In diesem Buch geben SPIEGEL-Autoren und renommierte Adels-Experten überraschende Einblicke in die prunkvolle Welt des europäischen Adels. Sie stellen die wichtigsten Herrscherhäuser und ihre Stammsitze vor, und zeigen, welchen politischen und militärischen Einfluss der Adel vom Mittelalter bis heute auf die europäischen Gesellschaften hatte und wie sich seine Rolle im Laufe der Zeit wandelte. Und nicht zuletzt versuchen sie zu ergründen, wozu Adel heute noch verpflichtet. Das Buch wird zahlreiche Abbildungen enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wollten Sie nicht schon immer wissen, was bei Hofe wirklich passiert? Wie man sich in der höfisch-ritterlichen Welt kleiden und verhalten musste? Was Aristokratinnen heimlich in ihre Tagebücher schrieben, und welche Blaublüter doch tatsächlich selbst arbeiteten? In diesem Buch geben SPIEGEL-Autoren und renommierte Adels-Experten überraschende Einblicke in die prunkvolle Welt des europäischen Adels. Sie stellen die wichtigsten Herrscherhäuser und ihre Stammsitze vor, und zeigen, welchen politischen und militärischen Einfluss der Adel vom Mittelalter bis heute auf die europäischen Gesellschaften hatte und wie sich seine Rolle im Laufe der Zeit wandelte. Und nicht zuletzt versuchen sie zu ergründen, wozu Adel heute noch verpflichtet.
Bettina Musall, geboren 1956, ist seit 1985 Redakteurin beim SPIEGEL. Lange Jahre schrieb die Germanistin und Politikwissenschaftlerin für die Ressorts Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur. Für die Reihe SPIEGEL Wissen konzipiert sie überwiegend gesellschaftspolitische Hefte, zum Beispiel zum Thema Bildung. Außerdem liefert sie für SPIEGEL Geschichte zeitgeschichtliche Beiträge. Sie ist Herausgeberin des SPIEGEL/DVA-Buchs »Englands Krone« (2015).
Eva-Maria Schnurr, geboren 1974, ist seit 2013 Redakteurin beim SPIEGEL und verantwortet seit 2017 die Heftreihe SPIEGEL Geschichte. Zuvor arbeitete die promovierte Historikerin als freie Journalistin, u. a. für Zeit und Stern. Sie ist Herausgeberin zahlreicher SPIEGEL-Bücher, unter anderem »Englands Krone« (2014), »Das Christentum« (2018) und »Als Deutschland sich neu erfand« (2019).
Besuchen Sie uns auf www.dva.de.
Bettina Musall und Eva-Maria Schnurr (Hg.)
DIEWELTDESADELS
Europas Herrscherhäuser vom Mittelalter bis heute
Mit Beiträgen vonEckart Conze, Jutta Ditfurth, Uwe Klußmann, Nils Minkmar, Joachim Mohr, Torben Müller, Bettina Musall, Frank Patalong, Martin Pfaffenzeller, Johannes Saltzwedel, Eva-Maria Schnurr, Patrick Spät, Benno Stieber, Anke Wellnitz
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Texte dieses Buches sind erstmals in dem Magazin »Der Adel. Zum Herrschen geboren? Warum viele Familien immer noch so mächtig sind« (Heft 6 / 2019) aus der Reihe SPIEGEL Geschichte erschienen.Copyright © 2021 Deutsche Verlags-Anstalt in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 Münchenund SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 HamburgCovergestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenCoverabbildungen: © Bridgeman Images und © bpk / Benno WundshammerSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN 978-3-641-26863-3V003www.dva.de
INHALT
INHALT
VORWORT
»HÖHERESMENSCHSEIN«
Hochgeboren
EDLEMANNENINSCHWERERRÜSTUNG
Ein Pferd, ein Schwert und ein warmes Bad
ERGEBENSTDIENENZUMEIGENENVORTEIL
Mitsprache!
À LAMODE
DIEALTERNATIVEN
WASVOMADELÜBRIGBLIEB
»ICHBINESMEINEMHAUSUNDMIRSELBSTSCHULDIG«
»Sie glauben, noch zu führen«
»MEINGANZESSCHICKSALHATSICHENTSCHIEDEN«
»UNTERGARKEINENUMSTÄNDENWASCHEN«
AUFSTIEGVERWEHRT
FRONDIENSTMITFREIBIER
Offizier mit Landbesitz
»WIESOLLESNURWERDEN?«
»Hüter des Thrones«
NÜTZLICHEHANDLANGER
SITZ!
Die Fugger
»WIRWURDENNIEVERBOGEN«
»ESGABNUREINEAUSNAHME«
DIEBIBELDERSALONLÖWEN
EINÜBERHOLTESKONZEPT?
ADELSHÄUSEREUROPAS
ANHANG
CHRONIK
BUCHEMPFEHLUNGEN
AUTORENVERZEICHNIS
DANK
PERSONENREGISTER
VORWORT
Dafür, dass es den Adel eigentlich nicht mehr gibt, hat er sich gut gehalten. Hundert Jahre nachdem der ehemals gehobene Stand 1919 seine Vorrechte verlor, schauen Fürstinnen, Herzöge und Grafen noch immer von den Titelbildern einschlägiger Magazine herab. Adelsserien wie The Crown, Versailles oder Downton Abbey befriedigen mit immer neuen Staffeln eine verbreitete bürgerliche Sehnsucht nach Höherem. Die Geschichten von den vermeintlich Bessergestellten, die mit exzentrischen Moden und glamourösen Lebensstilen längst versunkene Welten beschwören, bieten vielen eine Flucht aus dem öden Alltag. Und die Nachfahren ehemals mächtiger Fürstenhäuser spielen das Spiel mit: Sie inszenieren sich öffentlich, füttern den Voyeurismus der Massen mit immer neuen Bildern und behaupten sich so als klar identifizierbare Klasse von erstaunlicher Vitalität.
Woher rührt dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein? Wird es gespeist aus Vergangenheitsverklärung? Haben die abgedankten Herrschaften bis heute mehr Einfluss auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, als die demokratischen Institutionen der Bundesrepublik vermuten lassen? Oder gehört es traditionsgemäß zum Selbstverständnis von Familien mit Stammbaum und Familienarchiv, sich selbst trotz aller Gleichheitsrhetorik irgendwie doch erhaben zu fühlen über die Masse der Normalen?
Beim Verständnis der Gegenwart hilft, wie so oft, der Blick in die Geschichte. Seit dem Mittelalter entstand um die regierenden Herrscherhäuser Europas eine Adelsschicht, die Anspruch auf Privilegien und Mitregentschaft erhob – und in ihren eigenen Landen selbst über Menschen herrschte. Standesdünkel und Führungsanspruch von Aristokraten fußten von Beginn an auf einer vermeintlich gottgewollten Gesellschaftsordnung, die einer kleinen Schicht zugestand, etwas Besseres zu sein als alle anderen. Der international vernetzte Hochadel brauchte anfangs ergebene Kämpfer, um Kriege zu führen, später loyale Repräsentanten, um das Land zu regieren, und schließlich dienstbereite Hofschranzen, um sich selbst zu erhöhen. So sicherten die Monarchen die Privilegien ihrer aristokratischen Entourage – eine nützliche wechselseitige Abhängigkeit, die sich über Jahrhunderte gegenseitig befruchtete und erhielt.
In diesem Buch erklären SPIEGEL-Autorinnen und Autoren, Historikerinnen und Historiker, wie der Adel als gesellschaftliche Schicht entstand, wie Familien wie die von Liechtenstein als treue Vasallen ihrer Lehnsherren groß wurden und welche Rolle Adelige in Mittelalter und früher Neuzeit in der Politik des Heiligen Römischen Reichs spielten. Gestützt auf neueste Forschungen und sorgfältige Recherchen beschreibt dieses Buch unter anderem, wie der Landadel in Preußen herrschte, warum die Aristokratie auch über die Französische Revolution hinaus so mächtig blieb und warum große Teile des Adels mit Hitler und den Nationalsozialisten kooperierten. In unterhaltsamer Kürze werden in diesem Buch zudem die wichtigsten europäischen Fürstenhäuser portraitiert, die teilweise bis in die Gegenwart Staatsoberhäupter stellen.
Nach 1945 war endgültig Schluss mit dem System aus Gnade, Gunst und Gewalt von oben, kritische Adelige wandten sich ab von der Idee einer geborenen Elite. Und doch wirken die Traditionen weiter, wie etwa ein Gespräch mit den heute lebenden Vertretern der Familie Fugger zeigt. Ein Rest von Standesbewusstsein hält sich hartnäckig – und fasziniert bis heute nicht nur Ewiggestrige.
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre
Bettina Musall und Eva-Maria Schnurr
»HÖHERESMENSCHSEIN«
Gab es den Adel immer schon? Eher nicht, sagt der Historiker Werner Hechberger: Der Stand bildete sich erst im Verlauf des Mittelalters heraus. Auch Normalsterbliche hatten die Chance zum Aufstieg.
Ein Interview mit Eva-Maria Schnurr
SPIEGEL: Herr Professor Hechberger, was ist Adel?
Werner Hechberger: Adel ist ein soziales und kulturelles Phänomen, das in vormodernen Gesellschaften entstand. Modellhaft gehen Historiker davon aus, dass sich Agrargesellschaften irgendwann leisten konnten, einige Mitglieder von der normalen Arbeit freizustellen. Diese Leute mussten nicht mehr täglich aufs Feld, sondern übernahmen Spezialaufgaben, die für alle wichtig waren: religiöse oder kriegerische Aufgaben.
Für die Religion waren die Priester zuständig, für die Kriegsführung jene, die später adelig wurden?
Genau, sie sorgten für den Schutz der Gemeinschaft, aber auch für die Expansion des Territoriums. Weil sie dafür Fähigkeiten und Kenntnisse brauchten, genossen sie besonderes Ansehen und hatten eine gesellschaftliche Vorrangstellung, die später auch vererbt wurde. Die Familien verfügten dann normalerweise über reichlichen Grundbesitz und konnten auf eine besondere Abstammung verweisen. Auch ein bestimmtes Selbstverständnis gehörte dazu. Schließlich fixierte man das Ganze rechtlich – der Adel im klassischen Sinn war entstanden, so stellt man sich zumindest in der Theorie die Entstehung des Adels vor.
Gibt es in jeder Gesellschaft so etwas wie Adel?
In vielen Gesellschaften dürfte es das Phänomen der frühen Arbeitsteilung gegeben haben, bei der bestimmte Personengruppen einen Vorrang genossen. Der europäische Adel mag ein paar Besonderheiten haben, die ihn vom Adel in anderen Kulturen unterscheidet. Ein rein mitteleuropäisches Phänomen ist er sicher nicht.
Gab es große Unterschiede innerhalb Europas?
Nein, im Gegenteil: Die Gemeinsamkeiten sind sehr groß. Das begründet sich sicher in der gemeinsamen Religion, dem Christentum. Auch die Adeligen selbst waren sich durchaus bewusst, dass es so etwas wie einen europäischen Adel gab, die Netzwerke reichten früh schon über territoriale Grenzen hinaus.
Wann entstand diese Elite?
Einen Adel gab es schon in der Antike: die römische Nobilitas, jene römischen Bürger also, die Grundbesitz hatten und politische Ämter bekleiden konnten. Es gibt einige Historiker, die meinen, dieser Adel habe nahtlos bis ins Mittelalter fortbestanden, aber das ist umstritten. Sicher wurden einige Vorstellungen übernommen, und wahrscheinlich gab es auch personelle Kontinuitäten, vor allem in den ehemaligen römischen Gebieten, in Gallien etwa. Aus der germanischen Vorzeit, den Gebieten außerhalb des römischen Einflusses, haben wir kaum aussagekräftige Quellen. Die Archäologie weist auf beträchtliche soziale Unterschiede in den germanischen Gesellschaften hin – welches Gesellschaftsmodell dahinterstand, ist allerdings unklar. Man geht aber davon aus, dass Familien, die während der Völkerwanderungszeit eine führende Funktion hatten, diese auch danach behielten.
Ab wann weiß man Konkreteres?
In der Karolingerzeit, ab Mitte des 8. Jahrhunderts, kann man recht eindeutig eine Oberschicht feststellen: eine Personengruppe, die über Ämter und Reichtum verfügt und deren Status schon faktisch erblich ist. Ab dieser Zeit sind dann auch vereinzelt personelle Kontinuitäten nachweisbar. Möglicherweise hängt das mit dem Wandel der Kriegsführung zusammen: In der Merowingerzeit – vom 5. bis zum 8. Jahrhundert – bestanden die Heere wahrscheinlich hauptsächlich aus Fußsoldaten, hier konnten fast alle freien Mitglieder der Gesellschaft problemlos Kriegsdienste leisten. In der Karolingerzeit wurde die Reiterei dominierend, wer nun effektiv kämpfen wollte, musste über großen materiellen Besitz verfügen: Er musste ein Pferd unterhalten, eine Rüstung besitzen, hier konnten viele nicht mehr mithalten, sodass die sozialen Unterschiede größer wurden.
War Kriegertum die einzige Wurzel des Adels?
Eine andere waren möglicherweise Ämter, die vom König verliehen waren. In der fränkischen Zeit sind neben zuverlässigen Gefolgsleuten offenbar auch lokale Machthaber zu Grafen ernannt und damit in die Aristokratie eingegliedert worden.
Ab wann hatten die Aristokraten eine rechtliche Sonderstellung?
Im Hochmittelalter, ab dem 12. Jahrhundert, wurden bestimmte Privilegien rechtlich fixiert. Die sozialen Unterschiede wurden zu verfassungsmäßigen Rangstufen, es bildete sich ein Reichsfürstenstand, der sich schließlich mit den Grafen und freien Herren als Hochadel abgrenzte. Bekannt ist die Heerschild-Ordnung aus dem »Sachsenspiegel«: Die Besitzer von Lehen wurden in sieben »Heerschilde« eingeteilt, das erste bildete der König oder Kaiser als oberster Lehnsherr. Das zweite und dritte waren geistliche und weltliche Reichsfürsten, das vierte Grafen und freie Herren, darunter kamen rangniedrigere Vasallen und Dienstleute, die Ministerialen, bis hin zum »Einschildritter«, der Lehen nur empfangen, nicht aber selbst vergeben konnte. Dieses Bild war kein Gesellschaftsmodell, sondern sollte nur lehnsrechtliche Beziehungen systematisch darstellen. Aber es zeigt eben auch die Unterschiede innerhalb des Adels und die Bemühungen, sich vom Nichtadel rechtlich abzugrenzen.
Weshalb hat sich das Konzept der erblichen Adelsherrschaft durchgesetzt? Aus heutiger Sicht erscheint es ja ziemlich ungerecht.
Es war auch damals nicht die einzige Form, Herrschaft zu organisieren. Schon im Frühmittelalter gab es Herrschaft, die durch Wahl legitimiert war, der Abt im Kloster etwa. Auch der König wurde anfangs gewählt und ab dem Hochmittelalter dann auch die städtischen Regierungen. So gegensätzlich, wie sie scheinen, sind diese unterschiedlichen Formen von Herrschaft aber gar nicht. Herrschaft beruhte auch im Mittelalter nicht auf bloßer Gewalt und reiner Willkür, sondern sie bedurfte immer zumindest teilweise der Zustimmung der Beherrschten, sie musste sich also legitimieren. Und das ist der Adelsherrschaft offenbar gelungen: Sie scheint einigermaßen effektiv gewesen zu sein.
Was waren die Aufgaben des Adels?
Der Schutz der Armen und Machtlosen. Der Schutzgedanke stammt aus der Antike, wurde christlich untermauert und immer wieder betont, er war zentral für die Legitimation des Adels. Vom 10. Jahrhundert an wurde die Idee ausgebaut zum bekannten Drei-Stände-Schema der Gesellschaft. Nun unterschied man drei Funktionen: die Oratores, also jene, die beten, die Laboratores, die Arbeitenden, und die Pugnatores, die Leute, die kämpfen. Das Schema galt als gottgewollt, und somit war auch die Tätigkeit durch Gott legitimiert.
Auch aufgrund solcher Schemata haben viele Menschen heute das Bild von einer statischen mittelalterlichen Gesellschaft, in der es keine soziale Mobilität gab. So, wie Sie es schildern, war der Adel ja keineswegs eine von Beginn an abgeschlossene Gruppe, sondern es gab Bewegung in der Gesellschaft. War sozialer Aufstieg im Mittelalter doch möglich?
Ich glaube nicht, dass die mittelalterliche Gesellschaft so starr war, wie wir sie heute sehen. Die damaligen Gesellschaftsbilder waren normative Entwürfe: Die Gesellschaft sollte statisch sein. In der Realität war sie es nicht. Aufstieg war immer möglich. Die Ministerialen etwa waren ursprünglich unfreie Dienstmannen, die in der Verwaltung Funktionen ausübten oder Kriegsdienste leisteten. Sie fanden ab dem 12. Jahrhundert Anschluss an den Adel, und ihre Nachkommen bildeten den niederen Adel des späten Mittelalters. Und schon früher, im späten 9. und frühen 10. Jahrhundert, gab es im Adel vielleicht besonders hohe Fluktuation.
Wie kam es dazu?
Das späte Karolingerreich wurde von außen bedroht, von Ungarn und Normannen. Einige Quellen berichten von großen Verlusten fränkischer Heere, der bayerische Adel soll fast völlig aufgerieben worden sein. Das ist ganz sicher übertrieben, aber für solche Zeiten liegt die Annahme nahe, dass neue Männer durch Erfolge im Kampf nachrücken konnten und sozial aufstiegen. In Einzelfällen kann man das nachweisen.
Welche Rolle spielten Statussymbole für die soziale Abgrenzung zwischen einfacher Bevölkerung und Adel? Musste man als Adeliger Reichtum oder Besitz demonstrieren oder ein bestimmtes Verhalten zeigen?
Der Historiker Johannes Fried hat mal formuliert: »Adelslos ist es, herrisch aufzutreten.« Die meisten Forscher dürften sich einig sein, dass soziale Abgrenzung durch ein besonderes Verhalten immer schon dazugehört hat. Das ist ja auch logisch: Wer Schutz ausüben will, muss auch deutlich zeigen, dass er notfalls gewaltbereit ist. Seit der Antike grenzte der Adel sich über einen eigenen Habitus ab, über bestimmte Verhaltensnormen: Anfangs spielten militärische Aspekte eine große Rolle. Seit dem 12. Jahrhundert wurden die Normen im Kontext der ritterlich-höfischen Kultur stark verfeinert, nun gab es detaillierte Vorgaben, wie man sich als Adeliger verhalten sollte: Demut, Mäßigung und Höflichkeit waren wichtig, man musste Schach spielen können, den Damen den Hof machen und vieles mehr. Der normale Ritter hat sich sicher nicht brav an diesen Tugendkatalog gehalten, aber das Ideal hatte Auswirkungen auf die Wirklichkeit.
Sie haben anfangs gesagt, dass europäischer Adel und Christentum eng verbunden waren. Welche Folgen hatte das?
Die adelige Vorherrschaft wurde, wie Herrschaft im Mittelalter generell, religiös begründet. Aber das war durchaus ambivalent, und das macht es unglaublich interessant. Denn nach christlicher Lehre sind ja alle Menschen vor Gott gleich, es gibt keine Privilegien. Soziale Unterschiede auf Erden musste man deshalb immer schon rechtfertigen – und nach heftigem Blättern in der Bibel kann man dafür tatsächlich ein paar Stellen finden, die Herrschaft von Menschen über Menschen begründen können. So hat etwa Noah Kanaan, den Sohn seines Sohnes Ham, und dessen Nachkommen dazu verflucht, Knechte von Hams Brüdern zu werden, nachdem Ham seinen Vater betrunken und nackt schlafend gesehen hatte. Aber aus Kreisen des Mönchtums kam immer wieder Kritik am Adel, an seinen Privilegien und an Hierarchien allgemein. In den Bauernunruhen des Spätmittelalters wurde das zur Fundamentalkritik, die sogar die Existenz des Adels gänzlich infrage stellte. Beim englischen Bauernaufstand von 1381 soll der Priester John Ball demonstrativ gefragt haben: »Als Adam grub und Eva spann – wo war denn da der Edelmann?« Wenn man auf die Bibel klopft, kann man immer eine Rechtfertigung verlangen.
Wie kommt es, dass der Adel im Spätmittelalter so stark unter Rechtfertigungsdruck geriet?
Der israelische Historiker Gadi Algazi hat vor ein paar Jahren ein interessantes Konzept vertreten: Er fragte, vor wem die Adeligen zu dieser Zeit die Bauern eigentlich schützten. Die Antwort verblüfft: vor den Fehden anderer Adeliger. Aber wenn der Adel vornehmlich Schutz gegen andere Adelige bot, konnte daraus natürlich Fundamentalkritik erwachsen. Ein anderer, vielleicht wichtigerer Grund mag sein, dass im Spätmittelalter alternative Eliten entstanden: Die Kaufleute in den Städten wurden meist durch Leistung reich, nicht durch Herkunft – forderten aber nun eine ähnliche gesellschaftliche Position ein wie der Adel. Und auch ein Universitätsstudium konnte nun zu sozialem Aufstieg führen.
Wie reagierte der Adel?
Er war nun gezwungen, klarer zu definieren, was ihn eigentlich auszeichnet. Es scheint mir, dass der Adel nun erst recht ein eigenes Bewusstsein, ein eigenes Selbstverständnis als Gruppe ausbildete und sich noch stärker abgrenzte. Nun gab es so etwas wie Jagdverbote für Bauern und Jagdrechte für Adelige, die auch der gesellschaftlichen Unterscheidung dienten. Die Trennlinie zwischen Adel und Bauern wurde nun fast zu einer ideologischen Kampflinie.
Der Adel veränderte sich im Verlauf des Mittelalters massiv, erfand sich auch immer wieder neu. Gibt es einen Gedanken, der sich von Beginn an durchzieht?
Sicher das Selbstverständnis als Elite, die Vorstellung, besser zu sein als die anderen, die Idee vom »höheren Menschsein«, wie es einmal der Historiker Otto Gerhard Oexle genannt hat. Das ist die Grundidee. Das Spezifische am europäischen Adel ist vielleicht der Dienstgedanke: das Bewusstsein, dass man nie automatisch herrscht, sondern einen Dienst leisten soll an der Gesellschaft. Das wäre ja eigentlich auch etwas, auf das man sich heute wieder besinnen könnte.
Was hat das Konzept Adel so erfolgreich gemacht, dass es so lange überdauert hat?
Früher ging man von einer Krise des Adels im späten Mittelalter aus: Es entstanden alternative Eliten, und die Kriegsführung änderte sich, es gab Feuerwaffen, Landsknechtsheere, neue Kampfweisen, der Ritter wurde überflüssig.
Aber diese Krise gab es gar nicht?
Sie führte jedenfalls nicht automatisch zum Niedergang des Adels. Die Forschungen der Adelshistoriker in den vergangenen 20 Jahren haben ganz eindeutig gezeigt: Der Adel ist ausgesprochen anpassungsfähig. Viele Adelige suchten sich ein anderes Auskommen. Man konnte in der Theorie die Arbeit verachten, den Handel und den Umgang mit Geld – wie es dem adeligen Wertekodex entsprach –, aber in der Praxis dennoch erstaunlich erfolgreich im Handel sein. Es gab niederadelige Familien, die wagten sich ins Kreditgeschäft und finanzierten sogar den Landesherrn oder übernahmen Ämter in der Landesherrschaft. Andere wurden Kriegsunternehmer. Nur die extremen Nichtanpasser endeten als Raubritter – aber sie waren eher die Ausnahme. Der Großteil des Adels reagierte auf die Veränderungen erstaunlich flexibel.
Herr Professor Hechberger, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Werner Hechberger, Jahrgang 1963, ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Koblenz-Landau. Er forscht über das Mittelalter.
Schnelles Wissen
Durften Adelige Bürgerliche heiraten?
Heiraten zwischen adeligen Familien dienten seit dem Mittelalter dem Aufbau von Netzwerken. Ehen mit Nichtadeligen waren verpönt oder verboten. Als sich im 18. Jahrhundert die Idee der Liebesheirat durchsetzte, regelte das Allgemeine Preußische Landrecht von 1794, unter welchen Bedingungen der adelige Status bei einer Ehe erhalten blieb. Regelungen, die bisher nur für den Hochadel galten, wurden nun auf den gesamten Adel übertragen: Adelige Männer durften ohne Zustimmung von drei Verwandten oder dem Landesherrn keine Ehe mit Frauen aus dem »Bauern- oder geringern Bürgerstande« eingehen. Lediglich Töchter des höheren Bürgerstandes – von öffentlichen Beamten, Gelehrten, Kaufleuten – kamen als Bräute infrage. Wenn adelige Frauen bürgerlich heirateten, verloren sie ihre Adelsvorrechte, ihr Name wurde aus dem »Gotha« gestrichen.
Was ist eine »Adelsprobe«?
Die Ahnen- oder Adelsprobe diente seit dem Hochmittelalter dazu nachzuweisen, dass jemand tatsächlich adeliger Abstammung war. Für den Eintritt etwa in Stifte oder Orden, aber auch für Heiraten wurde eine solche Adelsprobe verlangt. Mindestens wurde der Nachweis von vier standesgemäßen Ahnen verlangt, doch es konnten bis zu 32 Vorfahren verlangt werden, also eine nachgewiesen adelige Abstammung bis in die Generation der Ururgroßeltern. Als Beweismittel dienten Zeugen oder eidliche Beglaubigungen. Die Adelsprobe war bis ins 19. Jahrhundert hinein üblich.
Hochgeboren
Was bedeuten die verschiedenen Adelstitel?
Adel beruhte ursprünglich auf Herrschaft über Menschen. Die Herrschaftsrechte und damit die Titel wurden vom König als Lehen vergeben und im Laufe der Zeit erblich, auch feste Herrschaftsterritorien bildeten sich heraus. Die Titel veränderten sich oft und das Ziel vieler Adelsfamilien war es, in den nächst-»höheren« Stand aufzusteigen, also etwa vom Freiherrn zum Grafen zu werden.
Fürsten: Anfangs die Einzigen, die nur der Herrschaft des Königs unterworfen waren. Von circa 1500 an gab es auch andere »reichsunmittelbare« Stände, den Fürsten blieben soziale Reputation und politischer Einfluss im »Reichsfürstenrat« des Reichstags. Auch Grafen und Herzöge konnten Fürsten sein.
Anrede: »Königliche Hoheit« (bei ehemaligen regierenden Häusern), sonst »Durchlaucht«.
Herzog: Übte in einem Herzogtum königliche Amtsgewalt aus. Herzöge waren über mehrere Grafschaften gesetzt, ihr Status höher als der von Grafen. Im Französischen spricht man von Duc, im Englischen von Duke.
Anrede: »Durchlaucht«.
Graf: Ursprünglich königliche Amtsträger in bestimmten Bezirken, den Grafschaften. Daraus entwickelten sich eigene Herrschaftsrechte. Markgrafen (französisch: Marquis), Pfalzgrafen und Landgrafen gehörten dem Fürstenstand an. Der französische »Comte« und der englische »Count« entsprechen dem Grafen.
Anrede: »Erlaucht« beziehungsweise »Hochgeboren«.
Freiherr: Der Titel bedeutet »Freier Edelmann« und hing, wie alle anderen Adelstitel, an einem Herrschaftsgebiet, etwa einem Gut. Entspricht dem in anderen europäischen Ländern verwendeten Titel »Baron«, den es in Deutschland nicht gab.
Anrede: »Hochwohlgeboren«.
Historischer Adel: Mit dieser adelsintern heute noch verwendeten Bezeichnung sind Familien gemeint, die ihren Adelstitel gemäß dem 1919 abgeschafften Adelsrecht tragen. Wer etwa durch Adoption den Titel erworben hat, zählt nicht dazu.
EDLEMANNENINSCHWERERRÜSTUNG
Ritter haben das Bild des mittelalterlichen Adels geprägt. Pracht und Risiko der höfischen Lebensform wurden zum Mythos.
Von Johannes Saltzwedel
Glanzvoll war Kaiser Heinrich VI. im November 1194 im sizilischen Palermo eingezogen. Wieder war er seinem Traum eines europäischen Imperiums nähergekommen. Und der Staufer wusste genau, wem er diesen Erfolg zu verdanken hatte: Markward von Annweiler.
Der kluge, ritterlich gewandete Markward hatte wohl schon an Heinrichs Erziehung mitgewirkt. Vom Amt des Truchsessen, in dem es so komplexe Dinge wie die Verwaltung der kaiserlichen Pfalzen und das diplomatische Protokoll zu organisieren gab, war er in die Außenpolitik aufgerückt. Unter Heinrichs Vater, Friedrich Barbarossa, hatte Markward im Ersten Kreuzzug geholfen, die Festung Nikitz bei Adrianopel zu erobern, später war er als Gesandter in Konstantinopel gewesen. Eben erst hatte er die misstrauischen Seemächte Genua und Pisa auf des Kaisers Seite gebracht. Bald sollte ganz Sizilien unter staufischer Kontrolle stehen.
Dabei agierte das politische Multitalent keineswegs unabhängig. Markward kam aus einfachen Hofbeamtenkreisen; zumindest auf dem Papier war er bislang ein Höriger gewesen, den sein Herr verschenken oder verkaufen konnte. »Ministeriale« wie er blieben Werkzeuge, im schlimmsten Fall Handlanger.
Das sollte sich für Markward nach dem sizilischen Erfolg ändern. Heinrich verlieh ihm beim Hoftag im apulischen Bari die persönliche Freiheit – und dazu auch gleich das Herzogtum in Ravenna und der Romagna sowie die Markgrafschaft Ancona als Erblehen. Aus dem dienstbaren Untertan ohne Hausmacht war fast im Handumdrehen ein adeliger Landesherr geworden, der bald weite Abschnitte der Adriaküste kontrollierte.
Natürlich war Markwards Aufstieg zu höchsten Ritterehren etwas Ungewöhnliches. Aber mit seiner Anerkennung ehrte Heinrich ihn als Vorbild: Wehrhaft, ergeben und doch eigenständig verantwortungsvoll sollte ein Ritter sein; alte aristokratische Ideale von Unabhängigkeit und erblicher Grundherrschaft verschmolzen mit dem Bild des treuen Dienstmannen und des christlichen Streiters. Aus kaiserlicher Sicht konnte es gar nicht genug solcher weitblickenden Ritter im Dienst des Reiches geben.
Freilich steckte die »Reichsaristokratie« (wie der Mediävist Hubertus Tellenbach sie genannt hat) vor 1200 noch in den Anfängen. Früher waren für kleine Grundherren Scharmützel untereinander so alltäglich gewesen wie Essen und Schlaf; Raubzüge hatten, so formulierte es der akribische Sozialhistoriker Marc Bloch, geradezu als aristokratischer »Lebenszweck« gegolten. Dieses raue Dasein war erst durch das Lehenswesen deutlich zivilisiert worden, vor allem, weil die meisten Lehen um die Mitte des 11. Jahrhunderts erblich geworden waren.
Als der Jurist Eike von Repgow im 13. Jahrhundert seinen »Sachsenspiegel« verfasste, stellte er zwar eine säuberliche »Heerschildordnung« auf, die vom König an der Spitze bis hinab zu den letzten kleinen »Hintersassen« reichte. Doch das hatte »weitgehend nur theoretische Bedeutung«, wie der Mediävist Joachim Bumke warnt. Gerade die Anziehungskraft des Ritterstandes belegt, wie durchlässig die Schichten blieben. Begüterte Lehensleute mussten dem König Kriegsfolge leisten und stellten auch berittene Kämpfer. Diese Reiterkrieger, keineswegs immer Adlige, waren Keimzelle des Rittertums; ihre steinernen Wohntürme oder kleinen Kastelle bildeten den Ursprung der Burgen.
Wehrhaft ragende Mauern, kunstvoll durch Gräben und Tore geschützt: Burgen – hier Burg Eltz in der Eifel – sind seit dem hohen Mittelalter ein Symbol des Rittertums.(Quelle: Hans-Günther OED/SZ Photo)
Zur Zeit Heinrichs VI., in einer Epoche des kräftigen Bevölkerungswachstums, war das Rittertum ein sozialer Schmelztiegel, denn es bekam Zulauf von beiden Seiten: Aufstrebende Ministeriale wie Markward sahen hier die Chance zu Ruhm und baldiger Freiheit, aber auch Abkömmlinge der alten Hofaristokratie lockte das Ansehen des tugendhaften Kämpfers. Herkunftsstolz, aristokratische Haltung und die Ideologie vom »edlen« Rittertum verschmolzen in einem geradezu mythischen Adelsideal. Entscheidend beschleunigt wurde diese Entwicklung durch die Kreuzzüge seit 1095.
»Erst als man begann, den Gebrauch der Waffen moralisch zu rechtfertigen, wurde aus dem adeligen ›Krieger‹ ein ›Ritter‹«, sagt Joachim Bumke pointiert. Der »miles christianus« übte sein vordem sündiges Waffenwerk endlich mit Gottes Segen aus: Er durfte hoffen, trotz Leichen und Beutemachens nicht in die Hölle zu kommen. Bald wurde dieses positive Image durch mönchisch organisierte Elitetruppen wie die Johanniter oder den Templerorden zusätzlich verklärt.
Kein Wunder, dass im hohen und späteren Mittelalter ein regelrechter Kult um die Daseinsform des Ritters und der höfischen Eleganz herrschte. Als Parzival, der Titelheld im großen Versepos des Wolfram von Eschenbach (um 1220), eines Morgens zum ersten Mal in seinem Leben drei Berittene »von Fuß auf gewappnet« heranpreschen sieht, fällt er ehrfürchtig auf die Knie: »Der Knappe glaubte ohne Spott, / ein jeglicher sei ein Gott.«
Einer der Kämpen trägt über der Rüstung kostbare Gewänder: »Im Tau schleppte der Mantelsaum. / Güldene Schellen, kleine, / hörte er vor dem Beine / an den Bügelriemen klingen, / die hinab zum Fuße gingen. / Sein rechter Arm von Schellen klang, / wenn er ihn bot oder schwang, / damit es beim Schwertwechsel so tönt. / Der Held war an Preis gewöhnt. / So ritt der Höfe Zierde / in köstlicher Zimierde«, heißt es in der Übersetzung von Wolfgang Mohr.
Klar, dass der ahnungslose junge Parzival am liebsten auch solch ein »Kunstwerk Gottes« mit blinkendem Panzer, Kettenhemd und Glöckchenzier werden möchte. Dabei hatte seine Mutter Herzeleide gerade dies verhindern wollen, war doch ihr heldenhafter Mann auf Kriegszügen umgekommen. Nicht lange, und Parzival führt tatsächlich das Schwert, sogar von des legendären Königs Artus Gnaden. Aus Wolframs Reimerzählung erfuhren die Zuhörer in allen Details, was ein edler, tapferer Ritter so tut oder tun sollte: Kämpfe gegen Monster und Unholde, sittsam-kluges, tugendhaftes Benehmen in der Gesellschaft, Beistand für schöne, bisweilen kapriziöse Frauen und manchmal auch zarte erotische Bande zu ihnen.
Literarische Überhöhungen des ritterlichen Daseins wurden von 1200 an eine Hauptattraktion der Adelshöfe Mitteleuropas. In hochstilisierter Liebeslyrik, dem Minnesang, ging es gewitzt um Leidenschaft, Psychologie und stilvolles Miteinander. Meist wurden die Stücke von professionellen reisenden »Troubadours« gedichtet und gesungen; aber auch Regenten und adlige Herren versuchten sich als Minnesänger.
Die erzählende weltliche Dichtung wurde erst recht zum geistreichen Spiel mit den neuen Idealen. Von Anfang an ging es dabei um mehr als adelige Superhelden in blitzendem Eisen. Die Hauptfiguren mussten sich bewähren; der »Parzival« handelt letztlich von der Suche nach dem geheimnisvollen »Gral« und dem Ritterorden, der ihn hütet. In seinem nächsten Versroman »Willehalm« fragt Wolfram dann sogar, ob ein Ritter feindliche Heiden, nämlich die muslimischen Kreuzzugsgegner, bedenkenlos abschlachten darf – sind sie denn nicht auch von Gott erschaffene Menschen?
Zum Glanz der Ideologie vom christlich-tugendhaften, adeligen Ritter trugen die parallel aufkommenden Turniere viel bei. Entstanden aus militärischem Training, entwickelten sich die durchaus riskanten Wettkämpfe allmählich zur Showsportart mit kompliziertem Regelwerk. Aber das ursprüngliche Szenario blieb: Schwer gerüstet preschten zwei Reiter in Kampfbahnen aufeinander zu und versuchten, den Gegner mit eingelegter Lanze aus dem Sattel zu heben.
Ein von Kopf bis Fuß gepanzerter Streiter war nur durch äußere Zeichen erkennbar, am deutlichsten an den Mustern und Symbolen auf seinem Schutzschild. Schon um beim Turnier nicht verwechselt zu werden, legte jeder ritterlich Gewappnete Wert auf ein individuelles Wappen. Im Deutschen macht die enge Wortverwandtschaft zwischen »Waffe« und »Wappen« hörbar, wie gut der neue Brauch das ritterliche »Schild-Amt« (Wolfram) ergänzte; Stammbäume oder Familiengrabmale wirkten dank der bunten Zier sowieso viel hübscher. Begeistert tüftelten Heraldiker immer subtilere Geschlechterzeichen und Wappenregeln aus.
All dies war für





























