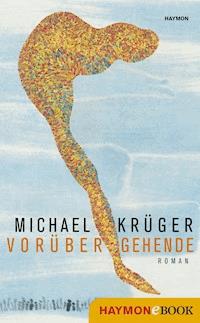17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Michael Krüger, der langjährige Leiter des Hanser Verlags, war und ist auch seit er sich aus dem Verlagsgeschäft zurückgezogen hat als Dichter und Schriftsteller, als Kritiker, Herausgeber und Übersetzer aktiv. Im deutschen Kulturleben ist er omnipräsent und unverzichtbar. Hier legt der leidenschaftlich Lesende, Schreibende, Verlegende nun eine Rückschau auf sein reiches Leben vor. Er berichtet von seiner Kindheit in Sachsen-Anhalt, seiner Jugend in Berlin, der Arbeit in München, den literarischen Reisen und von der Fülle seiner Begegnungen und Erlebnisse mit deutschsprachigen und internationalen Dichtern; mit den meisten war er befreundet.
Der Enthusiasmus von Michael Krügers leichthändig unterhaltenden und geistvoll anregenden Schilderungen nimmt vom ersten bis zum letzten Satz gefangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cover
Titel
Michael Krüger
Verabredung mit Dichtern
Erinnerungen und Begegnungen
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5497.
© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2023Sämtliche Fotos im Kapitel „Strandbad Wannsee“: privat
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Jan Skácel und Michael Krüger in Lucca, Italien, Juni 1989, Foto: © Isolde Ohlbaum
eISBN 978-3-518-77745-9
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Ariane
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Vorwort
Strandbad Wannsee. Szenen einer Nachkriegskindheit zwischen Nikolassee, Schlachtensee und Wannsee
Lehre bei Herbig, das literarische Berlin, Diagonale
London
Reinhard Lettau
Walter Höllerer
Klaus Wagenbach
Carl Hanser Verlag
Meine römischen Winter
oder
Über das Ende des Neorealismus in Italien
Lindos
Meine schwedischen Freunde
Meine israelischen Dichter
The Boys und einige andere
Meine (Schreib-)Tische in New York
Meine holländischen Dichter
Meine polnischen Freunde
Glück gehabt Ein Gespräch mit Knut Cordsen
Nachbemerkung
Dank
Informationen zum Buch
Vorwort
Als ich 2013 den Hanser Verlag in München verließ, in dem ich mein ganzes Berufsleben verbracht habe, dachten viele meiner Kollegen in anderen Verlagen, ich würde nun meine Erinnerungen schreiben, und machten mir wunderbare Angebote. Ich war natürlich geschmeichelt, aber auch, offen gesagt, verblüfft darüber, was sie sich erwarteten. Skandale? Enthüllungen? Beleidigungen? Ratschläge, wie man mit Autoren tunlichst nicht umgehen sollte? Sogar ein ausländischer Kollege war darunter, der offenbar hoffte, das Buch dann als Lizenz an alle Teilnehmer unseres legendären Verlegeressens auf der Frankfurter Buchmesse zu verkaufen.
Ich habe alle freundlichen Angebote ausgeschlagen. Anders als der von mir bewunderte Siegfried Unseld habe ich nie Tagebuch geführt, und anders als mein lieber Freund Klaus Wagenbach war ich nicht in endlose politische Streitigkeiten verwickelt, die zur deutschen Geschichte gehören: RAF, Rudi Dutschke, Ulrike Meinhof und so weiter. Ich habe nichts anderes getan, als mit meinen klugen, umsichtigen, belesenen Kolleginnen und Kollegen den Verlag zu leiten, dessen Geschichte bis 2003 von Reinhard Wittmann aufgeschrieben vorliegt. Natürlich hätte ich meine Version der Geschichte erzählen können, zum Beispiel wie es dazu kam, dass in meiner Zeit der literarische Verlag sehr schnell wuchs: Wie wir den historisch wichtigen, aber völlig maroden Zsolnay Verlag in Wien kauften, in dessen Archiv im Keller nur noch die Mäuse tätig waren; sie fraßen sich durch eine wie durch ein Wunder erhaltene Korrespondenz und hatten schon große Teile der Verträge von Graham Greene und John Le Carré angenagt; und wie wir später auch den noch älteren Deuticke Verlag kauften, in dem einstmals die Bücher von Sigmund Freud und Karl Popper erschienen; wie wir beide Verlage in den alten Räumen (mit dem alten knarrenden Parkett und den alten zugigen Fenstern) in der Prinz-Eugen-Straße im IV. Bezirk zusammenführten und mit vereinigten Kräften einen robusten Verlag daraus formten (der in manchen Jahren wegen der ungebremsten Schreiblust von Henning Mankell zu platzen drohte); wie eines Tages Renate Nagel anrief, weil sie ihren Verlag Nagel & Kimche in Winterthur aus gesundheitlichen Gründen in andere Hände übergeben wollte und sich unsere Hände ausersehen hatte – die auch zugriffen; wie wir den Hanser Kinderbuch-Verlag gründeten, der durch viel Arbeit und etwas Glück unmittelbar nach der Gründung bereits »erwachsen« war; wie schließlich, nach dem Fall der Mauer, Hanser Berlin entstand. Ich hätte von meiner dreißigjährigen Herausgeberschaft der Zeitschrift »Akzente« erzählen können, meiner schönen und anstrengenden Droge am Wochenende. Und natürlich hätte ich auch bemerkenswerte Interna aus dem dtv, dem Deutschen Taschenbuch Verlag berichten können, der einmal ein Dutzend Gesellschafter hatte, von denen drei übriggeblieben sind. Ja, und in diesen Geschichten wären natürlich auch alle ausländischen Verleger und Lektoren vorgekommen, mit denen wir zusammengearbeitet haben (und von denen viele schon tot sind), eine wunderbare Gesellschaft von Käuzen und Eulen, ein herrliches Bestiarium, in dem (für mich) die Emigranten eine besondere Rolle gespielt haben: der dicke François Erval, ein aus Ungarn stammender Jude, der gleichzeitig in mehreren Sprachen reden, lesen, essen, trinken und rauchen konnte und für den großen Verlag Gallimard in Paris arbeitete; oder Marion Boyars in London, die mit John Calder, einem Freund und Verleger Becketts, in London einen kleinen Verlag besaß; ich könnte von Calder selber erzählen, der einmal im Jahr durch die Campus-Buchhandlungen Amerikas reiste und alle Musterexemplare in einem riesigen Paletot mit breiten Innentaschen bei sich trug, so dass er sich kaum erheben konnte. Von Roberto Calasso und seinem Adelphi Verlag in Milano, der für mich der schönste europäische Verlag ist. Von Anne Freyer und Le Seuil; und den spanischen Freunden, von denen einer mich eine Stunde vor seinem Tod anrief, um sich für die schöne gemeinsame Zeit zu bedanken. Von den skandinavischen und den holländischen Freunden, die allesamt so viel von Literatur verstanden, aber auch gerne nach Deutschland kamen, weil sie ungestört einen trinken wollten. Ich hatte ja das große Glück, noch in einer Zeit arbeiten zu dürfen, in der es einen Unterschied gab zwischen Literatur und Unterhaltung und wo einem Autor von Gedichten noch nicht mitgeteilt wurde, man sei für Lyrik (das heißt: für Literatur) nicht zuständig, er oder sie solle sich an einen kleinen Verlag wenden. Überhaupt hätte ich von einer Zeit erzählen können, in der der Begriff »Konzern« nur in Büchern vorkam, aber das wäre eine Sozialgeschichte des Buchhandels geworden, die ich mir nicht zugetraut habe. Wenn ich jetzt manchmal an meinen Bücherregalen entlanggehe und auf den Rücken »Geschichte der Philosophie« in acht Bänden bei Ullstein Taschenbuch lese oder die zwanzig Bände »Anthropologie« bei dtv sehe, dann kribbelt es mir in den Fingern. Warum ist so etwas heute unmöglich, wo andererseits riesige Summen für drittklassige Romane und halbseidene Sachbücher ausgegeben werden, denen man schon von weitem ansieht, dass sie nach drei Monaten wieder vergessen sind. Aber das ist eine andere Geschichte, die andere, mit weniger Schaum vor dem Mund, schreiben müssen.
Und natürlich hätte ich, wenn ich Erinnerungen geschrieben hätte, von den Autoren sprechen wollen, dem Zentrum unserer Arbeit. Aber habe ich nicht schon einmal über sie alle geschrieben? In Vorworten und Nachrufen, in Sammelbänden und zu Preisverleihungen, zu runden Geburtstagen und anderen fröhlichen und traurigen Anlässen? Erzähl’s noch einmal, bitte. Aber dazu hätte ich in das Archiv des Verlages hinabsteigen und die Leitz-Ordner, die damals die Papierberge in Ordnung hielten, durchwühlen müssen – und dazu hatte ich keine Lust. Anders als in unserem Gewerbe üblich, hatte der Aufsichtsrat mir beim Ausscheiden keinen Katzentisch angeboten, was zu meiner Zeit noch selbstverständlich war: Als ich in den Verlag eintrat und in dem umgebauten Wohnhaus in der Kolberger Straße in Bogenhausen – einen Steinwurf vom Thomas-Mann-Haus in der Poschinger Straße entfernt – ein ehemaliges Badezimmer bezog, kam einmal in der Woche Herbert G. Göpfert vorbei, der damals schon Professor für Editionskunde an der Universität war, um in der ehemaligen Toilette seine Fußnoten für den »kleinen« Mörike zu schreiben. Und der unvergessene Fritz Arnold, mein Vorgänger, der Mann mit der spitzen Nase und der spitzen Zunge, hatte bis weit über achtzig seinen Arbeitsplatz im Verlag (wo er mittags die »Abendzeitung« las und bei seiner Brotzeit nicht gestört werden wollte) und war besonders für die »Witwen« und andere schwierige Fälle zuständig (Esther Calvino, Rita Gombrowicz, Susan Sontag, um nur die Spitze eines Eisbergs zu nennen).
Aber ich hatte nicht einmal Zeit, mich über dieses seltsame Verhalten des Aufsichtsrats zu wundern, weil mich die Mitglieder der Bayerischen Akademie der Schönen Künste zu ihrem Präsidenten wählten. Ich gehörte dieser Institution schon länger an, war also oberflächlich mit ihrem Getriebe vertraut und ging mit Lust und dem im Verlag antrainierten Schwung an die Arbeit. Leider war meine Mutter nicht mehr am Leben, der ich nur zu gerne von dieser Ernennung berichtet hätte. Verlagsdirektor, Schriftsteller, Zeitschriftenherausgeber, das waren alles mehr oder weniger ordentliche, wenn auch etwas undurchsichtige Berufe, die man mit einigem Aufwand den Freundinnen und der Familie im Osten erklären konnte, aber Präsident war natürlich mehr, auch wenn es sich nicht um eine Akademie für Obstanbau handelte, meine eigentliche Bestimmung, wenn es nach ihr gegangen wäre. Viele meiner Vorgänger, von Heinz Friedrich über Wieland Schmied bis zu Dieter Borchmeyer, waren mir gut bekannt, und bekannt war mir auch das Problem der Unterfinanzierung der Akademie, das schon auf vielen Tischen der sich ablösenden Kulturminister gelandet war. Manche Minister waren so kurz im Amt, dass man sich kaum ihre Namen merken konnte; nur eine Ministerin – die buchstäblich nach wenigen Wochen wieder abtreten musste – hat sich einmal in den großartigen Räumen in der Residenz blicken lassen, wo es die schönste Aussicht in München gibt. Es ist mir bis heute ein Rätsel, warum diese hellen Räume nicht genutzt werden. Die Akademie kann sie nicht nutzen, weil sie kein Geld hat, der Staat kann sie nicht nutzen, weil er sie nicht kennt. Einige Male im Jahr dringen herrliche Gerüche aus den unter der Akademie liegenden Räumen zu uns herauf, wenn nämlich der bayerische Ministerpräsident einen Empfang gibt: Dann zeigt man den Gästen die berühmte bayerische Gastfreundschaft. Wenn bei uns ein berühmter Künstler zu Gast ist, dann muss er sich sein Essen gewissermaßen selber mitbringen, weil im Haushalt nicht vorgesehen ist, dass Künstler Hunger haben. Warum die Akademie, in der unmittelbaren Nachkriegszeit unter prekären Umständen gegründet, vom Staat so wenig geliebt wird, bleibt ein Rätsel. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in Bayern Intellektualität traditionellerweise nicht besonders hoch im Kurs steht. Als in Deutschland um 1800 in einer großen Bewegung die bürgerliche Kultur entstand, kam keiner ihrer Protagonisten aus Bayern: Kein Goethe, kein Schiller, kein Kant und kein Hegel, kein Hölderlin und keine romantische Schule, auch Schopenhauer und Nietzsche haben einen Bogen um Bayern gemacht. In München war die Malerei zu Hause, und es wurde musiziert.
Einige der institutionellen Probleme der Akademie konnten wir lösen, die Hauptsachen blieben ungelöst. Zwei Perioden habe ich durchgehalten, ein drittes Mal wollte ich mich – obwohl mich fast alle der Kollegen dazu ermunterten – nicht zur Wahl stellen. Denn anders als in den anderen Akademien in Mainz, Berlin und Darmstadt, denen ich angehöre, gibt es in Bayern ein paar Mitglieder, die sich neben ihrer Kompositionsarbeit vornehmlich dem Aufbau von Intrigen widmen oder neben Romanen noch durch Artikel auffallen möchten, in denen sie dafür eintreten, Interna der Akademie-Sitzungen ausplaudern zu dürfen. Nichts für mich. Vielleicht gelingt es einem meiner Nachfolger, zusammen mit der Kulturbehörde die Idee der Akademie neu zu beleben. Sonst wird sie eines schönen Tages verschwunden sein.
Natürlich könnte ich alle diese Intrigen hier ausbreiten. Manche sind tatsächlich interessant, manche sogar brisant, und mit ein wenig Geschick würde ich vielleicht sogar ein kleines Skandälchen damit herausfordern können, die Androhung einer einstweiligen Verfügung, geschwärzte Zeilen, lautstarken Protest. Aber dazu habe ich nicht die geringste Lust. Man vergiftet sich nur selber, wenn man sich auf das Niveau dieser neuen Blog-Warte begibt. Wir haben jedenfalls große Abende in der Akademie erlebt, und das Essen danach haben wir gerne aus eigener Tasche bezahlt. Aber – wer soll die Geschichte dieser Höhepunkte lesen?
Ich könnte natürlich einiges von meiner Faszination für den sogenannten Jungen Deutschen Film erzählen, der in meiner Jugend die ästhetischen Fragestellungen beherrschte. Wenn man in Schwabing – ich wohnte damals in der Herzogstraße: Im ersten Stock des Hauses lebte der Regisseur Haro Senft, im Nebenhaus der Regisseur Volker Vogeler, ein paar Häuser weiter Uwe Brandner – auf die Straße trat, um eine Flasche Milch (oder eine Schachtel Zigaretten) zu holen, begegnete man unweigerlich den Protagonisten, den Schauspielern, Regisseuren, Drehbuchautoren (männlich und weiblich und so weiter), Cuttern, Produzenten und Komponisten, die es für ein paar Jahre fertigbrachten, den deutschen Film in aller Welt interessant zu machen. Bei Enno Patalas und Frieda Grafe traf ich François Truffaut, Jean-Luc Godard oder Douglas Sirk, der als Hans Detlef Sierck in Hamburg geboren wurde und Deutschland mit seiner jüdischen Frau verlassen hatte. Seine in Hollywood gedrehten Melodramen waren gerade nicht zuletzt durch den Zuspruch von Fassbinder wiederentdeckt worden, jetzt saß dieser feine alte Herr im Wohnzimmer von Enno und Frieda und erzählte mir in einer wunderbar klaren und reichen Sprache von seinem Philosophiestudium bei Ernst Cassirer und vom Seminar bei dem Kunsthistoriker Erwin Panofsky, als sei es gestern gewesen. Frieda und Enno übersetzten dann auch das erste Filmbuch für Hanser, Truffauts »Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?«, dem viele andere folgten. Peter W. Jansen und Wolfram Schütte gaben die Reihe Film bei uns heraus, in der der Junge Deutsche Film als Teil des internationalen Films seinen Auftritt hatte: Achternbusch, Kluge, Fassbinder, Schlöndorff, Reitz, Wenders und die anderen standen nun in einer Reihe mit Cassavetes, Polanski, Bergman, Chabrol oder Coppola; wir verlegten erste monografische Bücher wie Peter Buchkas »Wim Wenders«, die Bücher von Werner Herzog und Ingmar Bergman (der damals wegen eines Streits mit der schwedischen Steuer in München lebte), Eric Rohmer und Bresson; aber auch Untersuchungen zur Geschichte und Ökonomie des Films und die wichtigsten theoretischen Studien zum Film, von Rudolf Arnheims Arbeiten bis zu einer vielbändigen Eisenstein-Ausgabe oder die Geschichte des Films im Dritten Reich. Wir waren zu dem deutschen Filmverlag geworden, und natürlich blieb es nicht aus, dass nicht nur meine editorischen, sondern auch meine schauspielerischen Fähigkeiten gesucht waren. Ich könnte also davon erzählen, wie ich in Bernhard Sinkels erstem Film, »Clinch«, die Hauptrolle übernommen habe (mit Hannelore Elsner in einer Nebenrolle), in fast allen Filmen von Uwe Brandner aufgetreten bin (wenn auch nicht in tragenden Rollen), mit Flori Furtwängler Drehbücher geschrieben habe, die dem Bayerischen Rundfunk zu riskant waren, mit Johannes Schaaf über die Rolle des Gottfried Benn verhandelt habe (der Film wurde nach meiner Absage nicht gedreht) und bei Ula Stöckl meine begrenzten Fähigkeiten zeigen durfte. Aber die große Geschichte des Jungen Deutschen Films (in der ich als Darsteller eine, als Lektor mehrere Fußnoten beanspruchen darf) sucht noch nach einem guten Chronisten. Gott sei Dank haben meine Freunde Volker Schlöndorff, Werner Herzog und Edgar Reitz ordentliche Autobiografien veröffentlicht; Fassbinder hat seinen autobiografischen Roman, über den wir einen Vertrag geschlossen hatten, nicht mehr schreiben können. Mehrfach habe ich den Produzenten Günter Rohrbach, der wunderbar schreiben kann, aufgefordert, seine Geschichte mit dem Film aufzuschreiben; seine Antwort lautete immer: Wenn ich mal neunzig bin und keine Filme mehr produzieren kann. Jetzt ist er vierundneunzig und hat immer noch nicht angefangen.
Ich könnte natürlich auch von dem Nebeneinander von sehr verschiedenen Lebensstilen erzählen, die in München aufeinanderprallten. Hier das leichte Leben, das sogenannte Schwabinger Gefühl, das sich über die dreißiger Jahre und die Nazi-Zeit hinweg erhalten hatte und in den sechziger Jahren gerade dabei war, sich zu verflüchtigen. Und daneben das »neureiche« München, das der Regisseur Helmut Dietl aufs Korn genommen (und unsterblich gemacht) hat. Auf der anderen Seite das »schwere« Bayern, die schweißnassen Tiraden von Franz Josef Strauß, der schreckliche Kreis um die »National-Zeitung« des Gerhard Frey oder die ekelhaften Auslassungen des Franz Xaver Schönhuber, der die Manieren, die ihm in der Hitler-Jugend und als NSDAP- und SS-Mitglied beigebracht worden waren, unverblümt bis in den Bayerischen Rundfunk getragen hatte, wo er stellvertretender Chefredakteur wurde. Mit der Veröffentlichung seiner Memoiren hat er sich dann um Kopf und Kragen geredet, aber als Chef der »Republikaner« einen neuen Wirkungskreis erhalten. Der Bayerische Rundfunk hat ihn schließlich entlassen (müssen), aber seine Pension weiter bezahlt. Keiner hat sich gewundert, als er nach dem Brandanschlag auf eine Synagoge in Lübeck behauptete, der damalige Präsident des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis, sei für den Antisemitismus in Deutschland verantwortlich. In dieses Kapitel gehört auch der »Fall« von Hans Egon Holthusen, von dem es in Wikipedia heißt: »H. war ein deutscher Lyriker, Literaturwissenschaftler, Essayist und Kritiker.« Die englischsprachige Eintragung hat den Tätigkeitskreis um eine Nuance erweitert: »H. was a German Nazi, lyric poet, essayist and literary scholar.« Holthusens Erinnerungen an die große Zeit hat er – freiwillig – in einem Essay bekannt gemacht, den er im »Merkur« veröffentlichte, der »Zeitschrift für europäisches Denken«, die von meinem Freund Hans Paeschke herausgegeben wurde. Karl Heinz Bohrer, der einmal sein Nachfolger werden würde, und ich hatten ihn den »Eichelhäher« getauft. Eichelhäher sind Singvögel und gehören bekanntlich trotz ihres bunten Gefieders zur Familie der Rabenvögel, sie sind über ganz Europa verbreitet, und obwohl sie häufig Opfer von Nesträubern sind, ist ihr Bestand nicht gefährdet. Hans Paeschke konnte nicht wirklich singen, aber als solider Raucher, der sich lebenslang vergeblich das Rauchen abgewöhnen wollte, konnte er prächtig krächzen. Die Redaktionsräume waren in einer Wohnung in einem Haus in der Ainmillerstraße untergebracht, ganz in der Nähe von Enno Patalas, der mit Frieda eine große Altbauwohnung bewohnte, und dem Haus, in dem Rilke die Jahre vor seinem Weggang in die Schweiz verbracht hat. Der Eichelhäher hatte immer Probleme, das war seiner Zeitschrift eingeschrieben. Wenn ich am Abend mit dem Fahrrad durch den Englischen Garten nach Hause fuhr, machte ich manchmal einen Sprung zu Paeschke hinauf, im Sommer trafen wir uns in einem Gartenlokal an der Ecke oder rauchten eine Zigarette auf einer Bank im nahegelegenen winzigen »Park«. Er seufzte, inhalierte, seufzte – und dann kam eine langwierige Beschreibung einer verkorksten Situation, für die er eine Lösung suchte. Denn der Liberalismus, für den die Zeitschrift bekannt war, hatte seine Grenzen, wenn ein Autor es ablehnte, mit einem anderen im gleichen Heft zu erscheinen. Nach der Veröffentlichung von Holthusens Bekenntnis war es natürlich schwer, Jean Améry zu halten, andere wollten nicht mit Arnold Gehlen in einem Heft erscheinen, alles war immer »delikat« und verlangte lange Erklärungen in Briefform, die er gewissermaßen mit mir probte. Die schematische Einteilung links/rechts wollte er natürlich nicht akzeptieren, einzig und allein der »europäische Geist« zählte, die Haltung und die Qualität. Außerdem hatte der Eichelhäher die für manche Autoren unangenehme Eigenschaft, jeden Beitrag nach seiner Façon heftig zu redigieren, so dass mir einer seiner Autoren einmal sagte, eigentlich müsste über allen Beiträgen im »Merkur« stehen: Von Hans Paeschke unter Mitarbeit von … Das ist natürlich übertrieben, aber sein Ringen mit dem Komma nahm gelegentlich komische Formen an. Alles in allem aber war der »Merkur« damals die beste intellektuelle Zeitschrift in Deutschland, weshalb ich gerührt war, als der Eichelhäher mich als Redakteur unter der neuen Herausgeberschaft von Karl Heinz Bohrer vorschlug. Ich fuhr nach Stuttgart und wurde von Ernst Klett unter die Lupe genommen, es folgten endlose Sitzungen in der Ainmillerstraße und den Lokalen in der Umgebung, in denen mir eingeschärft wurde, wie ich mich zu verhalten hätte, welche Autoren welche Behandlung erwarteten, welche man kurzhalten sollte und welche eine Extra-Portion Honig brauchten, und wenn wir den Eichelhäher endlich wieder bei seinen Papieren abgeliefert hatten, sagte Bohrer in seiner lakonischen Art: Damit das ganz klar ist: Keiner dieser Ratschläge wird befolgt!
Aber ich wollte meine Arbeit bei Hanser nicht aufgeben, und so wurde es nichts mit mir bei der »Zeitschrift für europäisches Denken«, die dann – nach einer Zwischenherausgeberschaft des pragmatisch-klugen Hans Schwab-Felisch – von Karl Heinz Bohrer und Kurt Scheel geleitet wurde. Typen wie den Eichelhäher gibt es leider nicht mehr (oder kaum noch) in der intellektuellen Szene, Asketen, die von Zigaretten und Rotwein leben, grundsätzlich unglücklich verliebt sind, dafür aber tagelang glücklich strahlen, wenn sie wieder einen aufsehenerregenden Artikel in ihrem Blatt haben.
Ich könnte ein wenig von Christian Enzensberger erzählen, damals Professor für Anglistik an der LMU, der mit seinem Freund Giuseppe in einem Häuschen an der Bahnstrecke nach Tölz wohnte, von den Indianern, die bei ihm im Keller lebten und eigentlich Inder waren und dort nicht sein sollten; von Christians eigenwilliger Naturphilosophie, die immer verrückter wurde und seinen ganzen Einsatz erforderte: wie er stundenlang am Ufer der Isar auf einem Bein stand und in den Himmel starrte – aber Christian und sein Weg von einer materialistischen Ästhetik zu einer »experimentellen« Naturphilosophie unter besonderer Berücksichtigung seiner eigenen experimentellen Lebensweise erfordern ein eigenes Buch. Er war einer der klügsten und schrägsten Menschen, die mir begegnet sind; wenn Giuseppe guter Laune war, bin ich zweimal in der Woche zum Essen bei ihnen gewesen, war er in trüber Stimmung, war es besser, das Haus zu meiden: Der sanfte Giuseppe konnte entsetzlich wütend werden. Nach Giuseppes Rückkehr nach Italien gründete Christian eine Wohngemeinschaft in der Tengstraße. Dort traf ich oft seine unglaublich freundlichen Eltern: den schweigsamen, immer lächelnden Vater, der mit meinem Vater das Postscheckamt in Nürnberg aufgebaut hatte, und die liebe Mutter, die von den unglaublichen Eskapaden ihrer Söhne berichtete: Stell dir vor, der Uli hat das und der Martin hat jenes gemacht, der Christian hat mal wieder etwas nicht gemacht, und der Mang wollte etwas tun, ist aber verschwunden und so weiter, sie hatte viel zu tun, das Leben ihrer vier Söhne zu überblicken.
Ich könnte die Geschichte des Dichters und »Hochstaplers« Carl Werner erzählen, aber auch sie bräuchte eigentlich ein eigenes Buch. Kein Mensch wusste, wer er war. Er wohnte mit seinem Freund, Apotheker bei der Bundeswehr, in einer riesigen Wohnung in der Isabellastraße, deren Balkone von einem natürlich »weltberühmten« Pflanzenkenner ausgestattet waren: Da hockte er und redete buchstäblich unverständliches Zeug über den mangelnden »Dienst an sich«, die »Pflicht« und ähnliche große Probleme, schrieb pathetische Gedichte über den Krieg und das Unglück – und half anderen Menschen: Wer in Not war, ging zu Carl Werner, über den hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, er sei ein unehelicher Spross der Hohenzollern. Gelegentlich gab es eine große Diskussion in seiner Wohnung in Schwabing, wo die unlösbaren Fragen der Gegenwart beantwortet wurden.
Einmal rief mich der (marxistische) Philosoph Ernst Fischer aus Wien an, er solle bei einem gewissen, ihm völlig unbekannten Carl Werner einen Vortrag halten, ob ich eine Ahnung hätte, wer das sei, das Honorar sei so üppig, dass er eigentlich nicht nein sagen könne. Und dann rief Carl Werner an, ob ich seinen alten, lieben Freund Fischer vom Bahnhof abholen könne, ein entzückender Mensch, ein ganz edler, entzückender Mensch, an dem wir alle eine große Freude haben würden. Ich holte Fischer vom Bahnhof ab, der buchstäblich keine Ahnung hatte von Carl Werner, nie gehört, wir fuhren in die Isabellastraße, Carl Werner öffnet die Tür und umarmt buchstäblich mit Tränen in den Augen seinen alten, lieben Freund, der alles völlig verdattert mit sich machen ließ. In der Wohnung saßen auf von Carl Werner selber mit schwarzem Kunststoff bezogenen Bänken Christian Enzensberger und Kuno Raeber, Horst Bienek und Ivan Nagel, der Philosoph Arnold Metzger, dessen Frau eigens gebackene Kekse mitgebracht hatte, und Werner Vordtriede, Wolfgang Koeppen und Reinhard Baumgart, aber auch Menschen aus der Industrie wie Herr Rodenstock oder berühmte Gewerkschaftsführer aus Bonn, insgesamt vierzig oder fünfzig Menschen, die alle mit rotem Wein aus Fünfliterflaschen bewirtet wurden. Und da damals noch geraucht werden durfte und Carl Werner der gierigste Raucher war, hörten wir schließlich nur noch die nicht besonders originellen Ausführungen von Fischer – Beckett ist der Dichter der entfremdeten Welt –, der selber hinter einer Rauchwand verschwunden war. Entzückend, entzückend! Das waren die letzten Worte, die Ernst Fischer mit auf den Weg bekam, als ich ihn endlich in seine Pension bringen konnte.
Die Geschichte der Autorenbuchhandlung könnte ich erzählen – und da ich der letzte Überlebende der Gründungsmitglieder bin, könnte mir auch keiner widersprechen. Aber wer will diese Geschichten um Inge Poppe und Paul Wühr, Jörg Drews und Peter Laemmle, Martin Gregor-Dellin, Barbara König und Jürgen Kolbe, Fritz Arnold und Christoph Buggert, Tankred Dorst und Günter Herburger noch einmal hören? Ich sehe keinen, der den Finger hebt, also lasse ich es.
Den großen schizophrenen Dichter Harald Kaas kennt leider keiner mehr, den sollen andere wiederentdecken; über Wolfgang Bächler habe ich mindestens zehn Nachworte und Artikel geschrieben, aber es hat alles nichts genützt: Er hat keinen Literaturpreis erhalten und war Mitglied keiner Akademie. Über Hermann und Hanne Lenz ist viel geschrieben worden, gelesen wird er nicht mehr. Ich könnte erzählen, wie ich mit Laszlo Glozer im Sommer das Haus von Hille und Reinhard Baumgart gehütet habe und wir uns überlegen mussten, wie wir der Tochter von Ute und Jürgen Habermas das Verschwinden der Katze erklären sollten, was wir nicht konnten. Die Tochter hat alles überstanden, von der Katze wurde nichts mehr gehört. Über meine Besuche bei Friedhelm Kemp in der Paradiesstraße könnte ich einiges erzählen; auch über Cyrus Atabay, den persischen Dichter. Über meine Freundschaft mit Hubert Burda und die vierzig Jahre Petrarca-Preis habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Über das Zusammenleben mit Tankred und Ursula Dorst, Tilman Spengler und Charlotte Franke in einem Haus am Starnberger See habe ich mich oft ausgelassen, auch über meinen lieben Freund Peter Hamm, der mit seiner Frau Marianne Koch auf der anderen Seite des Sees bei Tutzing lebte: ein Wunder an Belesenheit. Soll ich über die Anfänge des Lyrik Kabinetts berichten? Wie wir mit Seamus und Maria Heaney in der Küche von Ursula Haeusgen saßen und irische Balladen sangen. Habe ich das nicht schon erzählt? Soll ich erzählen, wie Botho Strauß in einer Gärtnerei in München arbeitete? Ich werde mich hüten. Aber ich werde noch einmal über ihn und sein unerhört konzentriertes Werk schreiben. Vielleicht in zwanzig Jahren, wenn sich keiner mehr für Literatur interessiert.
Ich muss auch dringend über meine »Lehrer« schreiben, über die vielen Freunde, die mich unentgeltlich erzogen haben. Über einige von ihnen habe ich Lobreden verfasst, über andere Nachrufe geschrieben, sie aber nie zusammen vorgestellt als das ideale Kollegium: von Walter Höllerer über Norbert Miller und Wolf Lepenies bis zu Peter von Matt, von Karl Heinz Bohrer und Alfred Brendel bis zu Ronald Dworkin, von Henning Ritter bis Hanno Helbling, von Rolf Michaelis bis zu Martin Meyer, von Hanns Grössel bis zu Karlheinz Stierle. Vielleicht gelingt es mir, einmal darzustellen, weshalb diese bunt gemischte Gruppe dafür verantwortlich zu machen ist, dass aus mir ein erträglicher Zeitgenosse wurde.
In den letzten Jahren, die ich wegen einer scheußlichen Krankheit mit meiner Frau Ariane in Quarantäne verbringen musste, besuchten uns, wenn wir auf der Terrasse sitzen konnten, gelegentlich Ute und Jürgen Habermas, die in der Nähe wohnen. Da beide über ein phänomenales Gedächtnis verfügen, habe ich sie immer angebohrt: Wie war das mit Gadamer, mit Mitscherlich, mit Horkheimer oder Adorno – und dann begann eine klare, oft ironische, häufig sarkastische Rede, die so voller funkelnder Details und feiner Beobachtungen steckte, dass ich nur staunen konnte. Ihnen stand ihr gesamtes Leben zur Verfügung, und man hatte nie den Eindruck, dass einer der beiden irgendetwas ausließ, weil es entfallen war. Alles war präsent, die Erinnerungsbilder leuchteten, es war ein Vergnügen, ihnen zuzuhören. Nach ihren Besuchen habe ich mich manchmal hingesetzt, um mit ähnlicher Präzision und Leichtigkeit über mein Leben zu schreiben – vergeblich.
Leider besitze ich diese Gabe nicht. Bei mir ist alles unsicher, vieles verschwimmt, und wenn ich etwas ganz klar vor Augen habe, dann fehlen mir die Worte, es auch so präzise hinzuschreiben. Es ist mir, mit anderen Worten, vollkommen unmöglich, mein Leben als einen erzählbaren Ablauf zu sehen und darzustellen.
Deshalb habe ich auf den folgenden Seiten nur einige Begegnungen festgehalten: meine Kindheit in Sachsen-Anhalt, meine Jugend in Berlin, meine Arbeit in München, meine literarischen Reisen. Ich weiß natürlich, dass das Wesentliche ungesagt geblieben ist; also werde ich später noch meine persönliche Literaturgeschichte schreiben, in der dann alles Wichtige meines Leselebens vermerkt sein wird.
Darauf können Sie sich freuen.
Wo ich geboren wurde
1
Mein Großvater konnte über hundert Vögel
an ihren Stimmen erkennen, nicht gerechnet
die Dialekte, die in den Hecken gesprochen wurden,
dunklen Schulen hinter dem Hof,
wo die Braunkehlchen Aufsicht hatten.
Mein Großvater war Spezialist für Kartoffeln.
Mit den Händen grub er sie aus, zerbrach sie
mit den Daumen, die weiß wurden,
und ließ mich an der Bruchstelle lecken.
Mehlig, gut für Schweine und Menschen.
Auch nach der Enteignung wollte er unbedingt
an Gott glauben, weshalb ich die Kartoffeln
ausbuddeln musste aus seinem ehemaligen Acker.
Wie auf holländischen Bildern zogen
schwere Wolken über den sächsischen Himmel,
sie kamen aus Russland und Polen
und fuhren nach Westen, ihre Fracht wurde leichter,
durchsichtiger und feiner, bis sie in Frankreich
als Seide verkauft wurde. Im Westen, sagte er,
finden Verwandlungen statt, wir werden verwandelt.
Im Dorf fehlten einige seiner Freunde,
die mussten in Russland die Wolken beladen.
2
Meine Großmutter benutzte die Brennschere,
um ihre dünnen Haare zu wellen. Man muss
dem Herrgott ordentlich frisiert gegenübertreten.
Der kam meistens nachts, wenn ich schon
schlafen sollte, setzte sich auf den Bettrand
und unterhielt sich mit ihr auf Sächsisch.
Beide flüsterten, als hätten sie ein Geheimnis.
Manchmal waren sie freundlich zueinander,
dann wieder zankte sie mit ihm wie
mit dem Großvater, wenn der sein Glasauge
neben den Teller legte. Wenn man es falsch herum
einsetzt, kann man nach innen sehen,
in den Kopf hinein, wo die Gedanken leben,
sagte er und stopfte seine Pfeife mit Eigenbau,
der neben dem Tisch an der Wand hing, labbrige Blätter,
von einem Faden durchzogen. Die Ärmel der Joppe
des Großvaters waren von Brandlöchern genarbt.
Wie deine Lunge, sagte die Großmutter, beides
aus braunem Stoff. So vergingen die Tage.
Abends gab es Kartoffeln mit Sauce oder ohne.
Wenn auf dem Hof geschlachtet wurde, fand ich
Wellfleisch auf meinem Teller, aber ich durfte nicht
fragen, wie es zu uns gefunden hatte.
Wellfleisch kann fliegen, damit war alles gesagt.
Ich stellte mir Gott als einen Menschen vor,
der alles mit sich machen ließ.
3
Mein Großvater las nicht mehr. Alle Bücher stehen
in meinem Kopf, sagte er, aber ganz durcheinander.
Dafür erzählte er gerne, am liebsten vom König,
der sich angeblich für ihn interessiert hatte.
Auf der Jagd sollte er ihm einen Hasen
vor die Flinte treiben, aber der Großvater hatte
das Tier unter seinem Mantel versteckt.
Ich kann noch heute das Hasenherz schlagen hören,
rief er und fasste sich an die Stelle, wo seine Uhr
hing. Hasen haben ein schlechtes Herz,
damit kann man keinen Staat machen. Vom Staat
war nicht viel zu erwarten. Wenn die Großmutter
nicht im Zimmer war, hörten wir Radio, messerscharfe
Stimmen, die den Rauch seiner Pfeife zittern ließen.
Saubande, sagte mein Großvater, der sonst nie
fluchte. In der Nähe von Beromünster war die Musik
zu Hause, da fahren wir eines Tages hin, sagte er,
und hören Bach und Tschaikowski. Dann schlief er ein.
Das Lid über seinem Glasauge war nie ganz geschlossen.
4
Als ich mein Dorf kürzlich besuchte,
fiel mir alles wieder ein, nur ungeordnet:
der Kunsthonig und der schwarze Sirup, der sämig
durch die Löcher im Brot tropfte, die fauchenden Feuer
über Meuselwitz, die kyrillischen Gewehre im Steinbruch
von Keyna, der Kohlenstaub, Warmbier, der ängstliche Gott,
der schnatternde Alarmruf des Wiedehopfs,
die puckernden Flüsse auf dem Handrücken des Großvaters,
der blaue Teppich unter den Pflaumenbäumen,
die Eselsohren in der Bibel, die fromme Armut,
das Glück. Auch die Toten redeten mit, von fern her
angereist in altmodischen Kleidern, die Frauen
mit Haarnetzen, die Männer in gewendeter Uniform,
mit Schusslöchern auf der eingefallenen Brust.
Und in der Mitte mein Großvater, ein Auge auf die Welt
und eines nach innen gerichtet, vor sich ein Teller
Kartoffeln, mehlig und buttergelb, gut für die Schweine
und Menschen und mich.
5
Das alles bin ich, der Mann mit dem Hasenherz.
Nicht mehr, eher weniger.
(1990)
Strandbad Wannsee
Szenen einer Nachkriegskindheit zwischen Nikolassee, Schlachtensee und Wannsee
Mein Vater war ein enthusiastischer Sportler, der noch im Alter jedes Jahr das goldene Sportabzeichen wiederholte. Wenn er mit der Urkunde nach Hause kam, verschwitzt und glücklich, sagte er stets erleichtert den Satz: Es ging noch immer erstaunlich gut. Warum er sich der jährlichen Tortur unterzog, war nicht herauszufinden. Aber zwei Drittel der von uns freiwillig ausgeführten Tätigkeiten haben keine stichhaltige Begründung. Warum sammelt einer Bierdeckel? Als Kind hatte ich eine kleine Sammlung von Bierdeckeln, auf die ich auch noch stolz war. Einige der schönsten Exemplare hatte ich zum Entsetzen meiner Mutter an die Wand genagelt. Wo andere ihren ersten van Gogh hängen hatten oder ein Foto von Elvis Presley oder Vico Torriani, hingen bei mir die Bierfilze aus Bayern, Belgien und Dänemark. Besonders ein Deckel aus Jamaika erregte unter meinen Freunden Aufsehen, auf dem ein exotisches Tier abgebildet war, das als Original nicht einmal im Zoologischen Garten bei uns in Berlin existierte: der Wimpelschwanz. Nachdem ich mit diesem Abschnitt meiner Kindheit abgeschlossen und die Bierdeckel in den Müll geschmissen hatte, las ich in der Zeitung, dass auf einer Bierdeckeltauschbörse besonders seltene Exemplare für Tausende von Mark weggegangen waren – ich hatte also unfreiwillig ein Vermögen verhudelt. Um mich über diesen Verlust zu trösten, sagte meine kluge Großmutter, der wahre Sammler sammelt nicht wegen des Werts der Gegenstände, sondern einfach so. Ob das stimmte? Wurde der Kopf der Nofretete, den wir im Museum in Dahlem bestaunten und den meine Mutter von atemberaubender Schönheit fand, einfach so gesammelt? Wann hörte »einfach so« auf? Ich bin nach dem Debakel mit den Bierdeckeln nie mehr Sammler geworden, nicht einmal die vielen tausend Bücher, die sich im Laufe meines Lebens einmal in meinem Besitz befanden, habe ich gesammelt, sie haben sich vielmehr angesammelt, wie von selber. (Wie bedrückend wertlos diese Bücher waren, habe ich bei meinem letzten Umzug erfahren müssen, als ich einige von ihnen heimlich loswerden, »abstoßen« wollte: Der Antiquar wollte für die Abholung der Bücher entlohnt werden!) Und was die Sammlungen meiner Großeltern betrifft: Mein Großvater hatte sämtliche Bände von Diel’s Apfel-Enzyklopädie gesammelt, mit den herrlichen Farbtafeln! Diese Sprache, dieser Reichtum an Wörtern, um das Apfelfleisch zu beschreiben, die Haut der Frucht, das Kerngehäuse, den Säuregehalt oder die Farbe der Kerne! Und wie viel verschiedene Apfelsorten es einmal gegeben hat! Gar nicht zu reden, mit welcher Klarheit jeder Apfel in das größere System eingereiht wurde! Wer einmal in Diel’s Enzyklopädie vergraben war, brauchte lange, um sich wieder in normalen Nachschlagewerken zurechtzufinden. Leider hat mein Großvater bei der Enteignung nur einen Band mitnehmen dürfen, der so langsam aus dem Leim ging, weil wir immer wieder darin geblättert haben. Und meine Großmutter hatte eine beträchtliche Sammlung von Meissener Porzellan aufgebaut, das Geschirr mit dem berühmten Stachelbeermuster »für Sonntage«, aber auch Unikate wie eine große Suppenterrine, auf deren Deckel ein Papagei thronte, die nie in Betrieb genommen wurde. Auch diese Sammlung war enteignet worden. Auf welche Weise einige Stücke daraus – zum Beispiel der Papagei, aber ohne Terrine – doch noch in unseren Besitz gekommen sind, wurde immer nur angedeutet, weil es offenbar nicht mit rechten Dingen zugegangen war – aber nichts, rein gar nichts war mit rechten Dingen zugegangen. Nach einem langen, arbeitsreichen Leben besaßen meine Großeltern gerade mal das, was sie auf dem Leibe trugen; dazu gehörte, als kostbarstes Stück, eine Granatbrosche. Wie oft habe ich, wenn die Sonne ins Fenster schien, die Großmutter gebeten, sich ins Licht zu setzen, damit ich die feurigen Blitze ihrer Granatbrosche bewundern konnte. Übrigens gab es neben dem einen Band aus Diel’s Apfellexikon noch zwei Bücher in dem winzigen Zimmer der Großeltern: eine unförmige illustrierte Bibel, aus der mir die Großmutter oft vorlas, und eine Flora von Deutschland, die ein Vorfahr von uns geschrieben und gezeichnet hatte (und die es, natürlich heute mit Fotos bebildert, immer noch gibt): der »Garcke«. Also drei üppig mit Bildern versehene Bücher, die mir die Kinderbücher ersetzten, die es bei uns nicht gab. Der »Garcke« war zugleich auch mein erstes Schulbuch. Wenn ich mit meinem Großvater über seine ehemaligen Felder ging, sammelten wir Pflanzen, die meine Großmutter trocknen und als Gemüse, Tees oder Gewürze verarbeiten konnte, nachdem wir sie im detailverliebten »Garcke« bestimmt hatten. Was nicht in dem Buch verzeichnet war, gab es – mit Ausnahme von Tabak-Pflanzen – auch nicht in der Natur, der »Garcke« und die Natur waren eins. Ich liebte das Buch besonders wegen der Passagen, in denen es um Gerüche ging: Nichts war schöner, als eine Pflanze zwischen den Fingern zu verreiben und den Geruch zu bemerken, der auch im Buch beschrieben war. Ich fragte mich immer, was zuerst da war, der Geruch oder seine Beschreibung im »Garcke«.
Mein sportlicher Vater war ein mit buchstäblich allen Wassern gewaschener Paddler, der alle großen Flüsse Deutschlands, wenn nicht Europas gepaddelt hatte und nun am Sonntag die sportlich nicht gerade herausfordernden Gewässer rund um Berlin durchpflügen musste. Seine Boote – Klepper-Faltboot, auf diese Marke ließ er nichts kommen – lagen in einem der Post gehörenden Bootshaus in bester Lage am Kleinen Wannsee, zwei Sprünge über Land vom Kleist-Grab entfernt. Wenn wir ihm nicht entwischen konnten, musste eines der vier Kinder mit ihm am Sonntag aufs Wasser gehen, was keiner von uns als besondere Auszeichnung empfand. Einmal aus prinzipiellen Gründen, weil wir ein gesundes Misstrauen gegen Sport hatten, und ferner, weil das Paddeln im Zweier ein extremes Gleichzeitigkeitsgefühl voraussetzt, was uns offenbar abging. Individualismus, wie er uns als Lebensform vorschwebte, war nicht gefragt. Man darf, wenn man im Zweisitzer vorne sitzt – und natürlich mussten wir vorne sitzen –, den Rhythmus nicht einfach beschleunigen oder verlangsamen, weil das erste Gesetz der Paddelordnung lautet: Wer hinten sitzt, bestimmt. Während ich mich gerne in die Nähe der damals aufkommenden Motorboote begeben wollte, weil ich neugierig war, wie die von uns natürlich verachteten Neureichen, die Piefkes, so lebten, die nie in ihrem Leben ein Paddel berührt hatten und gar nicht ermessen konnten, welche Schönheit, welche ungeahnte Freiheit im Paddeln liegt, bevorzugte mein Vater die offene Fläche und fand es beleidigend, Segelbooten ausweichen zu müssen. Sogar auf die Ruderer, die mit ihren Vierern und Achtern an uns vorbeizogen, schaute er verächtlich, weil sie, zum Beispiel in reißenden Gewässern, dem Klepper-Boot natürlich nicht das Wasser reichen konnten. Mein Vater erzählte oft, um uns anzuspornen, die abenteuerliche Geschichte eines Verrückten, der in den zwanziger Jahren mit dem Faltboot den Atlantik überquert hatte. Ich habe vergessen, ob er den Mann gekannt hat, jedenfalls erzählte er diese Geschichte so mitreißend, dass wir immer gespannt auf den Höhepunkt warteten. Nachdem der Faltboot-Held nämlich tatsächlich den Atlantik geschafft hatte, war er auf der Weiterfahrt von der Karibik nach New York zum letzten Mal gesehen worden: Wahrscheinlich hatte ihn ein Krokodil samt Klepper-Boot verspeist. Der Werbespruch der Faltbootwerft wurde aber trotz dieses tragischen Falles nicht geändert: Fahre fröhlich um die Welt / mit Klepperboot und Klepperzelt. Zur Welt gehörten natürlich auch der Wannsee und die Havel, auch wenn sie nicht gerade reißend waren, und selbst Gewitter waren auszuhalten, wenn die Blitze nicht zu nahe kamen.
Aber zu der prinzipiellen Abneigung der Kinder gegen Klepperboote kam noch etwas hinzu, was uns die Fahrten im Doppel-Klepper verleidete: Mein normalerweise sehr zivilisiert auftretender Vater hatte die unangenehme Eigenschaft, plötzlich und unvermittelt und ohne mit dem einförmigen Paddeln innezuhalten, bei strahlender Sonne mitten auf dem Wannsee von hinten zu fragen: Wo liegt Peking? Wenn man daraufhin das Paddel ablegte, um den Stand der Sonne zu erfassen, und etwas vage mit der rechten Hand einen Halbkreis beschrieb, an dem mit etwas Glück Peking hätte liegen können, erhielt man einen Schwall Wasser über den Kopf. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Enttäuschung. Er war ganz einfach zutiefst enttäuscht, dass ich nicht in der Lage war, hinter Kladow oder hinter Schwanenwerder das unendlich große Reich der Mitte und darin die Stadt Peking zu orten. Und aus Enttäuschung schlug er mit seinem Paddel auf das unschuldige Wasser des Wannsees, das mich daraufhin mit einer ungezügelten Woge kalt überschwemmte. Es war mir offen gesagt ein Rätsel, wie man an einem schönen Sommertag auf dem Wannsee an Peking oder, noch schlimmer, an Timbuktu oder Istanbul denken konnte. Nicht einmal Leipzig kam mir in den Sinn oder Paris. Aber vor allen Dingen wollte mir nicht einleuchten, dass es zur Bildung – zur einfachen und nicht einmal zur höheren, humanistischen Bildung – gehören sollte, auf dem Wasser des Wannsees, der nur zur Hälfte dem humanistisch denkenden Westen gehörte, zu wissen, ob Peking mehr hinter Glienicke und Timbuktu mehr in Richtung des Schlachtensees lag. Der andere, nicht-humanistische Teil, in dem ganz eindeutig Peking und Leipzig angesiedelt waren, gehörte zum Osten, zum Ostblock, und weil der mütterliche Teil der Familie aus dem Osten stammte, wussten wir, wovon wir sprachen. Da nun aber um ganz Berlin herum Osten war, war es doch eigentlich gleichgültig, wo Peking lag? Gerade der Süden war lange Osten, bis er in Franken humanistischer Westen wurde. Eine solche Argumentation war für meinen humanistischen Vater eine billige Ausflucht. Er war der Ansicht, dass das Ideal des Lebens darin bestand, alles zu wissen, da das aber nach dem Krieg in Berlin selbst auf den höheren Schulen nicht zu haben war, musste man sich notgedrungen mit dem, was möglich war, zufrieden geben. Mein Argument, dass Gott der Allmächtige die Erde als eine Kugel konzipiert hatte, man also auf verschiedenen Wegen die Stadt Timbuktu erreichen könne, wie ja auch Columbus, der eigentlich nach Indien fahren wollte, schließlich in New York in der Nähe des Broadway an Land gegangen sei, verfing nicht. Ich möchte wirklich wissen, was ihr in der Schule lernt, brummte er. Wer nicht weiß, wo Timbuktu liegt, wird es nie erreichen – und natürlich hat er recht behalten: Ich bin nie in Timbuktu gewesen.
Ich will gerne zugeben, dass auch mir das Lernprogramm in der Schule nicht immer einsichtig war. Meine Mutter erzählte gerne die Geschichte, dass ich, als wir noch in Charlottenburg wohnten, nach der Einschulung zwar morgens zum Schulbeginn in die Wald-Schule ging, aber in der Meinung, dass nach einer Stunde das Tagespensum abgearbeitet war. Ich ging nach der ersten Stunde spazieren und hing meinen Träumen nach, und wenn ich beim Abendessen gefragt wurde, wie ich die Schule fände, fand ich sie angenehm. Bis dann eines Tages die Lehrerin bei uns zu Hause auftauchte, um mit meinen Eltern ein schwieriges Problem meiner Erziehung zu besprechen … Berlin, 1949, war ein aufregendes Pflaster, und natürlich bilde ich mir heute ein, mehr über »das Leben« erfahren zu haben als meine Mitschüler, die brav in der Bank sitzen geblieben waren.
Mein erstes Gedicht
»Ich weiß zwar viel, doch möcht ich alles wissen«, dieses Zitat aus dem »Faust« hatte mein Vater ständig auf den Lippen. Wie oft haben wir, besonders nach der Zeugnisverteilung, am sonntäglichen Mittagstisch darüber nachgedacht, was man unbedingt wissen sollte und auf was man – wenn auch notgedrungen – verzichten konnte. Der Besuch von Paris, Moskau und New York, den Städten der Avantgarde, war für meinen ältesten Bruder unverzichtbar, während mein Vater eher an Athen, Rom und die Pyramiden dachte; und während meine Mutter die bizarre Ansicht vertrat, jemand, der nichts von Musik versteht, habe auch nichts in einem Parlament verloren, weil er keinen Sinn hätte für komplizierte Tonlagen und den richtigen Rhythmus, hing meine Schwester der Überlegung an, die Kenntnis der Alpen und ihrer Flora und Fauna sei unabdingbar für das Verständnis der Welt. An ihnen zeige sich, woher wir und alles andere kommen. Was meinen zweiten Bruder zu der geknurrten Bemerkung veranlasste, sie dürfe ruhig Tiere und Pflanzen statt Flora und Fauna sagen, weil kein Mensch wisse, ob Flora mehr zu den Tieren und Fauna zu den Pflanzen gehöre oder umgekehrt. Er kritisierte indirekt meine Mutter, wenn er ihr vorhielt, nichts, aber auch gar nichts von Jazz zu verstehen, also auch nichts von Rhythmus, eine Wissenslücke, die nach seiner Meinung unbedingt gestopft werden müsse, denn wenn man nur Beethoven und Mozart im Kopf habe, verstehe man nichts von der ganzen Musik. Du kannst doch nicht erwarten, dass Adenauer sich deinen Jazz anhört, sagte meine Schwester, er hat wirklich Besseres zu tun, wenn er uns ordentlich regieren will. Es schloss sich eine lange Diskussion an über die Intelligenz des Senats von Berlin, die von der Familie, wenn ich die Erörterungen zusammenfassen darf, als ungenügend eingestuft wurde. Es war wie in der Schule: ungenügend, setzen, Musik hören und die Fauna und Flora der Alpen studieren. Wie man nach diesen extremen Vorstellungen überhaupt Menschen für ein Parlament finden sollte, war mir ein Rätsel, wie es für mich überhaupt ein Rätsel war, dass einer nach der Nazi-Zeit Politiker werden wollte. Wenn sich die Diskussionen in diese delikaten Gebiete bewegten, schwieg mein Vater. Wollte er selber einmal Politiker werden? Er kannte viele von ihnen persönlich, mit manchen telefonierte er am Abend, mit anderen hatte er beruflich zu tun. Immer sprach er lobend von dem Senator für Volksbildung, Joachim Tiburtius, der eine Art Vorbild für ihn war. Den konnte man nachts wecken, sagte mein Vater, wenn am nächsten Morgen im Senat über Lebensmittelknappheit gesprochen werden musste. Dann hätte er aus dem Stegreif eine flammende Rede über die Kartoffel an sich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehalten, die sich gewaschen und den Hunger vertrieben hätte, und alle hatten eingesehen, dass man den Gürtel enger schnallen müsse. Außerdem hatte er eine Doktorarbeit über den »Begriff des Bedürfnisses« geschrieben, die mein Vater gelegentlich lobend zitierte, war für den Neubau der Akademie der Künste verantwortlich und für das Schiller-Theater, dessen Aufführungen meine Eltern liebten, und über allem wölbte sich – was meinen ältesten Bruder zur Verzweiflung trieb – die Verehrung von Wilhelm Furtwängler, den auch mein Vater über alles stellte. Ja, auch wenn er in der Nazi-Zeit … Solche Politiker brauchte das Land, vor allem aber die Stadt Berlin. Meine Mutter war von vornherein dagegen, dass mein Vater mit einem Amt in der Politik liebäugelte: Dann kann euer Vater ja gleich im Büro übernachten, sagte sie spitz, dann hat er es nicht so weit vom Bett in den Plenarsaal, um einen weltbewegenden Vortrag über die Kartoffel anzuhören.
Was die Kenntnisse über die Welt betrifft, so fügte ich noch etwas anpasserisch hinzu, so könne es nichts schaden, auch ein wenig von Chemie und Physik zu verstehen – wo meine Noten in diesen Fächern doch miserabel waren. Davon verstand nämlich keiner was in der Familie, und ich wurde aufgefordert, mich »an die eigene Nase zu fassen«. Ich besaß zwar den »kleinen Chemiebaukasten«, mit dem ich allerhand Unheil anrichtete, aber natürlich war mir nicht klar, wie die Zukunft von meinen Experimenten abhängen sollte, die bislang nur Löcher in die Möbel gebrannt hatten. Wenn du eine Formel gefunden hast, wie man Gold gewinnt, dann kannst du dich wieder melden, sagte mein Bruder, der damals schon behauptete, das wahre Gold eines Landes sei seine Philosophie und Literatur. Und seine Musik natürlich. Und was ist mit Einstein, fragte ich, mit Max Planck? Das sind Ausnahmen, Spezialisten. Es ist gut, sie zu haben, auch wenn sie natürlich keiner versteht.
Zur Herstellung von Gold ist es aus verschiedenen Gründen nicht gekommen, unter anderem deshalb, weil ich immer an das Strandbad Wannsee denken musste, das wie eine verheißene Goldküste vor meinen Augen lag: ein endlos langer weißer Strand, an dem jetzt, während ich mit Fragen nach dem Frontverlauf des Dreißigjährigen Krieges unter besonderer Berücksichtigung von Wallensteins Truppenbewegungen traktiert wurde, meine Freunde Rudi und Thomas im feinen, warmen Sand lagen und den Mädchen hinterherschauten, die in so unglaublichen Mengen auf den Tribünen flanierten, dass einem angst und bange wurde. Was war der verdammte Dreißigjährige Krieg im Vergleich zu dem Gefühl, mit nackten Füßen über die sandigen Fliesen des Strandbads zu schlurfen? Timbuktu war in roten Sandstürmen untergegangen, Peking wurde von den gelben Sandstürmen aus der chinesischen Steppe bedroht, nur im Strandbad Wannsee war der Sand in erträglichem Maße verfügbar. Dieser helle Sand war eines der großen Rätsel der an großen Rätseln arm gewordenen Stadt, die unter prekären politischen und wirtschaftlichen Bedingungen mehr schlecht als recht dahinvegetierte. Denn der gesamte übrige Sand in Berlin und der Mark war grau, eine unendliche graue, manchmal grauschwarze Masse an Sandkörnern, die laut Befehl der preußischen Könige in diesem beklagenswerten Teil in der Mitte Deutschlands ausgestreut worden waren. Die Ufer des Nikolassees: grauschwarz verschlammtes, manchmal von öligen Schlieren durchzogenes Gelände, das erstklassige Verstecke bot, modriges Wasser, im Schlick brütende Enten und andere, aus der Zone eingeflogene Watvögel, Wasserratten, Schilfrohr, dessen Rohrkolben uns als Zigarrenersatz dienten – das war unsere alltägliche Welt! Die Ufer des Schlachtensees: grauschwarze Erde, etwas höher nur noch grau, dunkles, manchmal brackig riechendes Wasser, weil es keine wirklichen Zuflüsse gab. Die Krumme Lanke: eingefasst von einem bröckligen Rahmen aus grauem Sand. Steinige Ufer, wie ich sie jetzt von den Seen des Voralpenlandes kenne, die man, mit beiden Armen rudernd, mit städtisch geprägten Fußsohlen nur tänzelnd betreten kann, gab es überhaupt nicht. Steine waren in Berlin Mangelware. In Berlin gab es – das war auch beim Ausheben von Gräbern auf dem Waldfriedhof zu sehen, wo ich mir gelegentlich ein Taschengeld verdiente – keine Muttererde, sondern bestenfalls einen grauen Muttersand.
Am Schlachtensee
Auch der Wannsee hatte Seiten, die nicht gerade koscher waren, wie meine Mutter sich ausdrückte, vor allem der Kleine Wannsee mitsamt der Havel, aber er war den anderen Seen natürlich haushoch überlegen. Den Nikolassee suchte man auf, wenn man etwas zu verbergen hatte, es war mein Lieblingssee, an den Schlachtensee ging man täglich zum Schwimmen, der Wannsee war den großen Stunden der Existenz vorbehalten: Im geteilten Berlin war er der See des gehobenen Bürgertums, das seine kleinen Jollen und die ersten Motorboote der Nachkriegszeit zur Schau stellte, und es dauerte nicht lange, bis – »wie aus dem Nichts« – luxuriöse Privatboote auftauchten, die dann »In Flagranti«, »Paloma« oder »Lollipop« hießen. Besitzer waren, wenn man meiner Mutter glauben wollte, die Geschäftsinhaber, die den wohlanständigen Beamtenfamilien das Geld aus der Tasche zogen. Wie oft wurde beim Mittagessen am Sonntag darüber gesprochen, wie es kam, dass in dem sogenannten armen Berlin – arm im Vergleich zu Westdeutschland, nicht zur DDR – plötzlich reiche Leute auftauchten – oder, wieder meine Mutter, Leute, die so taten als ob. Denn natürlich mussten diese feinen Pinkel erstens nicht vier Kinder großziehen, und zweitens – so mein Vater – standen neunzig Prozent von denen bereits mit einem Bein im Gefängnis: »Das sind doch alles waschechte Betrüger!« Tatsächlich berichteten die Zeitungen immer wieder von einer ominösen Hand, die bei den lukrativen Wiederaufbaugeschäften gesehen wurde, um Vermittlungsgebühren einzustreichen, die ihr von der öffentlichen Hand auch gewährt wurden, bis man darauf kam, dass beide Hände zu einer Person gehörten. In »unseren Kreisen« jedenfalls hatte man kein Boot, das »Lollipop« hieß und von einem Motor bewegt wurde, wir paddelten selbstverständlich unsere zusammenklappbaren Klepperboote selber, wie es sich gehörte. Wir sind auch nicht bestechlich, sagte mein Vater oft, und manchmal wünschten wir uns, dass er ein klein wenig anfällig sein möge für eine saftige Bestechung, auch wenn wir uns nicht wirklich vorstellen konnten, wie so etwas vonstattengehen sollte. Unser Vater im Regenmantel unter einer Brücke, um wie Heinz Drache in den Edgar-Wallace-Filmen einen Umschlag entgegenzunehmen? Unmöglich.
An Sonntagen im Sommer fuhr man, wenn man etwas auf sich hielt, ins Strandbad Wannsee. Das Strandbad war unser Meer. Viele von meinen Freunden, wie ich in den letzten Jahren des Krieges geboren, in Berlin oder in Schlesien, im Sudetenland oder dem Banat auf die Welt gekommen, hatten noch nie in ihrem Leben ein Meer gesehen! Geschweige denn salziges Meerwasser getrunken! Der Wannsee war also Ersatz, aber was für einer! An Ersatz hatten wir uns gewöhnt, Kaffeeersatz und Butterersatz, und in gewisser Weise auch an einen Lebensersatz.
Das Strandbad war Ostsee und Nordsee in einem. Aber während an unseren nördlichen Meeren das Wasser alle paar Stunden zurückging und eine endlose, farblich nicht besonders reizvolle, blasige, von bösen lauernden Krebsen bewohnte Fläche aus Schlamm zurückließ, hatte im Strandbad alles seine feste Ordnung: Das Wasser schwappte ohne große Ambitionen ans helle Ufer, wenn irgendwo ein Ruderboot vorbeiglitt. Ganz weit hinten blinkten gelegentlich Segelboote wie entfernte Träume, und manchmal zog einer der Dampfer der sogenannten Wannsee-Flotte mit qualmendem Schornstein vorüber. Wenn vom Dampfer aus gewinkt wurde, musste man in größter Ruhe auch einen Arm bewegen. Aber nie als Erster winken! Das ist spießig. Und wenn sich ein Ruder- oder sogar ein Paddelboot an das gleißende Gestade des Strandbads verirrte, wurde es augenblicklich von der weiß livrierten Wasserwacht umzingelt, belehrt und wieder auf See geschickt. Der Feind, der schon von weitem gesehen wurde, hatte keine Chance bei uns. Saß eine Frau mit im Boot, bildete sich augenblicklich ein großer Kreis von Experten, der sie, unter Missachtung jeglicher Zurückhaltung, mit Kennermiene unter die Lupe nahm: Aussehen insgesamt (eher Mutti oder eher Schnecke), Gesicht, Busen, Oberschenkel, Badeanzug oder Bikini. Da es damals noch nicht die farblich widerwärtigen Anzüge der Surfboardfahrer gab, sah man nur klare Farben: den preußisch blauen Himmel, den weißen Sand, den gelben, glasierten Stein des Strandbads und die vier oder fünf Farben, die damals das Sortiment der Bademoden ausmachten. Alles Schreckliche, Chaotische, Zwanghafte, was unser Leben bestimmte, von der Schule bis zur turbulenten Vier-Mächte-Politik, von den sozialen Unterschieden bis zu den Kleiderordnungen, schnurrte hier zusammen zu einer einzigen bewegten sozialen Plastik, in der Langnese-Eis am Stiel geschleckt und Fassbrause getrunken wurde, und wer wenig Geld hatte, brachte seinen Brausepulverwürfel mit und warf ihn wie die Oma ihre Zähne in ein Glas Wasser – das kostenlos abgegeben wurde: Wenn man gar nichts hatte, musste man den Kopf über ein Becken beugen und einen vernickelten Knopf drücken, dann sprang einem für drei Sekunden ein dünner Strahl Chlorwasser in den Mund.
So etwa musste, wenn es denn überhaupt eines gab, das Paradies aussehen. Das Wort kannten wir nicht, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, es damals im Mund gehabt zu haben. Paradiese gab es in Berlin nicht. Als ich, aus Sachsen-Anhalt kommend, in Berlin eintraf, um zur Schule zu gehen, wurde die Schulspeisung mit dem Flugzeug eingeflogen; und gleich nebenan war das Lager Düppel mit all dem Elend, das sich denken lässt. Die Nachrichten fingen immer mit dem Satz an, dass die vier Mächte, unbeschadet ihrer Rechtsposition, sich wieder einmal nicht einigen konnten. Es war schwierig, in Berlin zu leben. Was mein Vater beruflich genau machte, war nur schwer zu verstehen. Er kam jeden Abend hundemüde nach Hause, gefolgt von dem Chauffeur, der einen dicken Packen Akten nach oben tragen musste. Am nächsten Morgen holte der Chauffeur ihn wieder ab, nachdem er bei uns in der Küche seinen Kaffee getrunken hatte. Mir wurde aufgetragen, dem Chauffeur in einem »günstigen Moment« mitzuteilen, er solle beim Kaffee nicht seine Uniformmütze auf den Küchentisch legen. Ja, wohin denn dann, fragte mich der Chauffeur, der zur Familie gehörte, und weil er sie ja nicht auf den Spülstein legen konnte, blieb sie bis zu seiner Pensionierung auf dem Küchentisch liegen.
Nur einmal in diesen frühen fünfziger Jahren erlebte ich meinen Vater morgens sehr fröhlich beim Rasieren, es war der 5. März 1953, ich war neun Jahre alt. Als ich müde und missgelaunt das Bad betrat, sah ich in seinem schaumumrandeten Gesicht eine diebische Freude und war darüber so erschrocken, dass ich ihn fragte, ob etwas Schlimmes passiert sei. Wie man’s nimmt, sagte er, Stalin ist gestorben. Natürlich wusste ich, wer Stalin war, jeder kannte Stalin, besonders in Berlin war sein Gesicht bekannt wie ein bunter Hund, sein Schnauzbart, der enge Kragen seiner Uniform, seine stechenden Augen (meine Mutter), die immer akkurat geschnittenen Haare, und wenn in privater Runde von ihm die Rede war, dann nur als von einem Massenmörder, der den Rest seines Volkes hatte verhungern lassen. Warum ihn dieses Volk trotzdem liebte und zärtlich Väterchen Stalin nannte, war nicht herauszufinden. In Wirklichkeit lieben sie ihn gar nicht, sagte meine Großmutter, die in der DDR gewissermaßen unter Stalin lebte und ihn natürlich besser kannte als wir, sie tun nur so, als ob sie ihn lieben, weil sie Angst vor ihm haben. Das war schwer zu verstehen. Keiner verlangte von uns, dass wir Adenauer oder den Regierenden Bürgermeister Ernst Reuter liebten, wir liebten sie einfach oder eben nicht, aber keiner wäre auf die Idee gekommen, Angst vor ihnen zu haben. Als ob. Was heißt das, wenn jemand so tut, als ob … Liebten und verehrten wir Adenauer oder taten wir nur so als ob? Auf keinen Fall hätte jemand in unserer Familie Adenauer ein Väterchen genannt, das gehörte sich nicht. Wenig später gab es auf den S-Bahnhöfen in Berlin Aushänge einer Zeitung, die seltsamerweise »Die Wahrheit« hieß, aber nach Einschätzung meiner Eltern und der Großmutter eigentlich »Die Unwahrheit« hätte heißen müssen, auf der in der Kopfzeile gelegentlich die hintereinander gestaffelten Profile von vier verdienten Kämpfern für den Sozialismus abgebildet waren: Marx, Engels, Lenin und Stalin. Und dann verschwand Stalin ein paar Jahre in der Versenkung, um mit seinem Schnauzbart und den stechenden Augen in bestimmten Zirkeln der Studentenrevolte plötzlich wieder aufzutauchen. In einigen Parteien gehörte er wieder dazu. In meiner Zeit als Besucher des Strandbads Wannsee war er jedenfalls kein besonders beliebter Name, mit dem man sich brüsten konnte.
Vier Wochen vor Väterchen Stalins Tod war die Situation zum Verzweifeln, das bekam mein armer Vater natürlich hautnah mit. Zufällig liegt neben mir eine Ausgabe der »Neuen Zeitung« vom 12. Februar 1953, die ich aus der Kiste mit dem Nachlass meines Vaters gefischt habe. Darin steht auf der ersten Seite, dass am Vortag 1200 Flüchtlinge in West-Berlin gemeldet worden waren, allein im Februar etwa 13