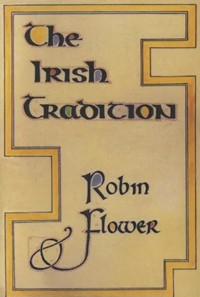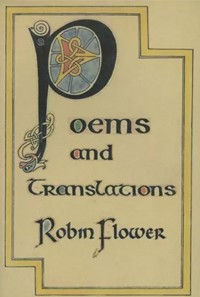Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hineingenommen in eine Fahrt mit dem damals noch existenten Bummelzug bis Dingle, an der äußersten Westküste Irlands, fahren wir unter Anleitung Robin Fowers in eine gälischsprachige Welt und landen schließlich in Dunquin, dem letzten Festlandsort vor der Insel Great Blasket. Mit dem Leinentuchkanu geht es dann auf die Insel und Flower trifft den Dichter Tomás Ó Crohan, den er von früheren Aufenthalten kennt, dessen Inselbuch Annemarie und Heinrich Böll unter dem Titel "Die Boote fahren nicht mehr aus" ins Deutsche übersetzt haben. Nun ist er zu Hause und kann uns seine Insel zeigen: Die Topographie, die Spuren vorzeitlicher Bewohner, die Bewohner selbst in ihrem Gemeinschaftsleben, die Kärglichkeit ihrer Häuser, der dem Boden abgetrotzte Ackerbau, die Fährnisse der Fischerei; dazwischen immer wieder eingestreut: Geschichten, Sagen und Legenden - dem Geschichtenerzähler selbst abgelauscht; ebenso Flowers eigene Poesie, mit Gedichten, deren ursprüngliches Empfinden bezaubert. Höhepunkt dieser Reise ist ein Besuch auf der abgelegensten und geheimnisvollsten Insel des Blasket-Archipels: Inishvickillane - wo einst die weltberühmte "Fairies Music" entstand, von Seamus Heaney im Gedicht "The Given Note" gewürdigt. Die Reise endet mit einer klaren Sternennacht, in der Flower sich Gedanken über das Existenzrecht von "Fairies" macht, inmitten einer nur noch rationalistisch denkenden Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
DIE STRAßE ZUR INSEL
DIE ÜBERFAHRT
Überfahrt bei Nacht
Tomás
TOMÁS
EIN PARLAMENT DES BERGABHANGS
Einsamkeit
Brendan
DIE HELLEN WOHNUNGEN
DAS DORF
Der Tanz
PEIG
GOBNAIT
DER LEIDVOLLE BERGABHANG
»UNSERE LIEBE FRAU VOM ROSENKRANZ «
PIERCE FERRITER
SEÁN Ó DUÍNNLÉ
Dichter
DIE ARMEN GELEHRTEN
NACH WESTEN GEHEN
INISICÍLEÁIN
DER SEEHUND
Der Seehund
DIE ELFEN
Nachwort des Übersetzers – mit einem Lebensbild von Robin Flower
Liste der Illustrationen von Ida M. Flower
Fotos mit Robin Flower
Vorwort
Dieses Buch gibt Rechenschaft über meine Erfahrungen während einer Reihe von periodischen Urlaubsbesuchen auf Great Blasket, im Zeitraum von ungefähr 20 Jahren. Zum ersten Male fuhr ich 1910 auf die Insel und meine Frau begleitete mich dann im darauf folgenden Jahr, als sie die Radierungen zeichnete, die als Illustrationen in diesem Buch reproduziert wurden. Der Text wurde zu verschiedenen Zeiten verfasst im Laufe der zwanzig Jahre, die folgten. Er war veranlasst durch eine Serie von Vorlesungen über irische Literatur, die 1935 am Lowell-Institut abgehalten wurden. Ich sollte hier die Gelegenheit ergreifen (allerdings zu spät!) dem verstorbenen Laurence Lowell Dank abzustatten für die Einladung zu diesen Vorlesungen und für seine Freundlichkeit mir und meiner Tochter gegenüber, während wir in Boston waren. Die dazwischen eingestreuten Gedichte wurden zur selben Zeit wie das Buch geschrieben und sind somit Ergebnis derselben Erfahrung. Sie wurden zuerst bei Constable in meinem Buch »Poems and Translations« im Jahre 1931 veröffentlicht und ich danke für die Erlaubnis, sie in ihrer Originalfassung reproduzieren zu dürfen.
Für jeden Leser muss es sofort einsichtig sein, wie sehr ich den drei Insulanern verpflichtet bin – Tomás Ó Crithin, Peig Sayers und Gobnait Ní Chinéide. Die ersten beiden sind dem irischsprachigen Leser schon wohlbekannt. Die Autobiografie des Tomás, »An t-Oileánach«, wurde 1929 veröffentlicht und von mir aus dem irischen Original ins Englische übersetzt unter dem Titel »The Islandman« im Jahre 1934. Peigs Buch »Peig a sgéal féin«, »Peig, her own story«, kam 1936 auf Irisch heraus und erfuhr sofortigen Erfolg. Es wurde nicht ins Englische übersetzt. Aber zusätzlich zu diesen dreien gilt meine Dankbarkeit allen Bewohnern der Insel zum Zeitpunkt meiner Besuche. Die Bevölkerungszahl betrug damals etwas mehr als 150 Seelen, nun allerdings sind es durch Emigration aufs Festland bedeutend weniger, so dass das Leben auf der Insel, so wie ich es noch kannte, bedroht ist.1 An einem meiner Besuche nach einem langen Zeitraum erinnere ich mich, wie am Abend meiner Wiederkehr zahlreiche Freunde in einem Haus zusammenkamen, um mich willkommen zu heißen. Im Laufe unseres Gesprächs begannen wir, die Toten seit meinem letzten Besuch aufzuzählen. Das Gespräch nahm unvermeidlich die Form eines Vortrags aus dem reichen Schatz von Sprichwörtern an, die sich innerhalb der Volkskultur angehäuft hatten, über die Notwendigkeit des Todes und die Tröstungen des religiösen Glaubens. Nach und nach, fast als rezitiere man eine Liturgie, produzierten die Männer und Frauen ihren Beitrag aus dem offensichtlich unerschöpflichen Vorrat. Zuletzt allerdings fiel Schweigen über sie, als sie auf frische Eingebungen warteten. Plötzlich lehnte sich eine alte Frau aus der Ecke hervor und sagte mit dem Anflug von Endgültigkeit:
»Cá il an sneachta bhí comh geal anuirig?« (Wo ist der Schnee geblieben, der letztes Jahr so hell glänzte?)
Aufgeregt sprang ich auf und rief: »Ou sont les neiges d´antan?« »
Wer sagte das?« fragte der »König«, ein Experte auf diesem Gebiet.
»François Villon hat es gesagt«, antwortete ich.
»Und wer war das?« entgegnete er. »War das ein Mann aus Connaught?«
»Nein, er lebte vor hunderten von Jahren und sagte es auf Französisch und es war ein Sprichwort seines Volkes«.
»Gut«, fiel Tomás ein. »Besser kann man ein Sprichwort nicht formulieren. Ich habe immer schon gehört, dass die Franzosen ein kluges Volk sind und ich würde es ihnen nicht übel nehmen, wenn sie es vor uns gesagt haben sollten«.
Der König ist tot und Tomás auch, wie der größere Teil der klagenden Gesellschaft. Und alles, was daraus folgte, war das Lied, das wir zusammen gemacht haben über den Schnee vom vorigen Jahr.
15. Oktober 1944
R. F.
1 Es blieb nicht bei der Bedrohung: Am 17.November 1953 – bald acht Jahre nach Flowers Tod – wurden die letzten sechs Bewohner evakuiert. Nach diversen »Hilferufen« wurde vom irischen Regierungskabinett eine Verordnung erlassen, die alles regelte und u.a. den Restbewohnern neue Häuser in Dunquin zuwies.
Seitdem traf endgültig zu, was Heinrich und Annemarie Böll titelten, als sie Thomas Ó Crohans Buch (bei Flower: Tomás) »The Islandman« übersetzten, das wiederum Robin Flower aus dem Irischen übertragen hatte (An t-Oileánach): »Die Boote fahren nicht mehr aus« (Göttingen: Lamuv, 92001). – Die Vor- und Nachgeschichte der Evakuierung beschreibt Cole Moreton in »Abschied von Great Blasket« (München: Piper, 2005).
DIE STRAßE ZUR INSEL
Als der Zug die Grafschaft Cork verlässt, in die Grafschaft Kerry einbiegt und immer weiter und weiter nach Westen rollt, verändert sich die Landschaft und bekommt einen immer unfruchtbareren Charakter. Die Wälder, Felder und das üppige Grün der Wasserwiesen, die sich um den großen Blackwater-Fluß versammeln, sind bald nur noch schwache Erinnerung. Die Hügel fangen an, sich an den Horizont zu drängen und lange melancholische Abschnitte von Sumpfland sind zuletzt Vorder- und Mittelgrund zugleich. Wir verlassen Killarney, welches seine Seen und Wälder vor dem Reisenden verbirgt wie ein reicher Mann seine Kostbarkeiten vor dem zufälligen Wandersmann und kommen schließlich nach Tralee, die letzte Station auf der Bahnlinie nach Westen und das Tor zum wilden Hochland der Halbinsel Dingle. Ich habe alte Leute auf Blasket über einen Besuch in Tralee sprechen hören wie ein Mann der Highlands über Glasgow oder ein Bauer aus Warwickshire über London spricht. Dingle ist ihre vertraute Heimatstadt, aber Tralee ist jenseits des Horizontes, ein Platz von selten gesehenen Wundern – das Gerichtsgebäude mit seinen nun herrenlosen Gewehren aus alten Kriegen, Donovans Mühlen, und der große Marktplatz, wo man immer noch die Ballettsänger hören kann, mit dem Tremolo ihrer nicht enden wollenden Lieder, in rauer Begleitung der Herde.2
Zum kleinen Bahnhof der Bahnlinie nach Dingle kommen die Leute vom Lande am Ende eines Markttages mit seinen kunterbunten Einkäufen. Man vergisst London und Dublin, alle Städte der Erde, und mit gälischen Gesichtern und gälischen Stimmen um einen herum steht man am Eingangstor einer älteren und einfacheren Welt. Und wenn die letzte alte Frau mit ihrem letzten Bündel sicher aufgestiegen ist, dann fährt der Zug langsam aus dem winzigen Bahnhof heraus und trödelt zwischen Bergen und Meer zur Abzweigung nach Castlegregory. Dort schüttet er ein Zehntel seiner Passagiere aus und nimmt Richtung auf die Berge.
Nach und nach, vorbei an sich ausstreckenden Tälern, über Brücken, die sich über reißende Bergströme spannen, an der steilen Seite von Heidehügeln, vollbringt der Zug den Aufstieg zum Pass und lässt den langen Bogen der Bucht von Tralee hinter sich und die schattigen Höhen jenseits davon. Man fährt an Gleann na nGealt vorbei, wo Suibhne Geilt und all das verrückte Volk von Irland hinkamen, auf den leichten Schwingen ihres zerstörten Verstandes fliegend. Und vorbei geht es an dem Gleann an Scáil, wo Cúchulainn und der Riese sich gegenseitig mit großen Felsen bewarfen, welche, sich in der Mitte treffend, in zahllose Stücke zerbarsten im darunter liegenden Tal. Die Bucht von Dingle kommt in Sicht und der Platz, wo Aogán Ó Rathaille schlaflos der schlaflosen Welle von Duibhneacha lauschte.3 In diesem Gebiet ist er immer noch ein Dichter, dessen man sich erinnert. Es gibt eine Geschichte über ihn, erzählt auf den Inseln, der ich nirgendwo sonst begegnet bin. Mit einem Freund wurde er von der Dunkelheit überrascht, erzählt die Sage, an einer einsamen Stelle in den Bergen. Und als sie ein Haus sahen, sagte er, sie wollten die Nacht hier verbringen.
»Hier können wir nicht bleiben«, sagte der Freund.
»Und warum nicht?« sagte Aogán.
»Weil«, sagte der andere, »der Mann des Hauses ein Geizhals ist und keinen Mann jemals dort übernachten ließ.«
»Wir werden reingehen«, sagte Aogán, »nichtsdestotrotz.«
Sie gingen hinein und der sagte noch nicht so viel wie »Setzt euch« oder »Hinaus mit euch«.
Aogán setzte sich zum Feuer und sein Freund neben ihn.
»Nun, war es nicht eine merkwürdige Sache, die die Krähe zu mir gesagt hat?« sagte Aogán.
»Sicher ist: die Krähe hat bisher noch gar nichts gesagt«, sagte der Mann des Hauses.
»Aber ja, das hat sie getan«, sagte Aogán. »Hat sie nicht gesagt: Aogán, Aogán, Aogán Ó Rathaille!«
»Bist du Aogán Ó Rathaille?« sagte der Mann und sprang aus seiner Ecke auf. »Hunderttausend Willkommensgrüße an Dich und bleibe hier drinnen, bis es Tag wird.«
Zuletzt fährt der Zug mit seiner immer kleiner gewordenen Besetzung in den Bahnhof von Dingle ein. Und wenn man ein Auto nimmt, holpert man die schmutzige Straße entlang, die vom Kai über die Brücke und hinaus in das offene Land führt. Es ist eine 10-Meilen-Fahrt nach Dunquin, ob man den Rundweg über Slea Head nimmt oder über den Bergpass zwischen Sliabh an Iolair und Cruach Mhárthain fährt, und im Fahren nimmt die Unfruchtbarkeit des Landes zu. In Baile an Ghóilín ist ein Gehölz, rund um das Haus, das einst Lord Ventry gehörte. Sieh es dir gut an, denn du wirst keine Bäume mehr sehen, außer einigen allein stehenden Eschen und Stechapfelbäumen, bis du den Weg wieder zurück fährst. Alles andere ist nacktes Feld und dunkler Morast, gestirnt hier und da mit schneeweichem Wollgras oder in Glanz getaucht durch das verschwenderische Gold des Ragwurzes. An den Bergabhängen breiten sich verkümmerte Ginsterbüsche in gelben Massen zwischen dem Violett der Heide aus. Und hier und da hängen am Rande der Straße die Fuchsien ihre wächsernen Leuchter aus, merkwürdig künstlich anzusehen in dieser wilden Landschaft, wie der unangemessene Staat eines Landmädchens, den sie am Festtage angezogen hat. Möwen fliegen und schreien über den Sümpfen und hier und da gleitet träge ein Reiher oder einfüßige Barsche schwimmen in einem seichten Bach.
Über die Bucht hinweg ziehen die Hügel von Íbh Ráthach eine zerklüftete Linie in den Himmel und auf der anderen Seite erhebt sich das Land bis zum riesigen Umriss des Mount Brandon, mit nichts hinter sich als Wolken und blauer Luft. Das Auto rattert durch Ventry, einer Reihe von Häusern, die hinter dem Long Strand liegen, wo jetzt Pferderennen abgehalten werden, wo aber in alten Sagen der ländlichen Überlieferung Fionn und die Fenier immer noch ihre ungleichen Schlachten gegen Dáire Donn und die Heere der Welt schlagen.
Außerhalb von Ventry beginnt der Anstieg und die Straße klettert zwischen dem flachen Tafelland von Sliabh an Iolair und dem spitzen Bergkamm von Cruach Mhártain, der auf seinem Gipfel einen druidischen Steinkreis hat – a leaba Dhiarmada agus Gráinne – wo nichts desto weniger die fliegenden Liebenden niemals ruhten, nur Diarmaid, sagt die Legende, hielt hier Wacht für Fionn über den Hafen von Dingle. An der Seite der Straße verläuft eine tiefe und breite Rinne, in welche, wie man erzählt, einst ein Trunkenbold mit seinem Eselskarren fiel und dort, Mann und Esel, eine Woche tot lagen, bis man sie fand. Mit dieser Sage im Sinn fuhr ich einst über diesen Pass bei einbrechender Dunkelheit mit einem betrunkenen Fahrer und einem Mädchen, das Gebete stammelte, und ich dachte, der arme Trunkenbold bewege sich unruhig in seinem Schlaf, in Erwartung von Gesellschaft für seine Einsamkeit.
Von der Spitze des Passes schaut man zurück und sieht, wie sich weit hinter einem eine Welt aus Sumpf, Gebirge und Meer erstreckt. Über diesen Pass erzählen die Insulaner eine Sage, so auch in ganz Irland bekannt, von der Frau, die noch nie von zu Hause fort gekommen war und bei ihrer ersten Unternehmung dieser Art zum Pass kam und in die sich ausbreitende Landschaft hinein rief: »Was für ein weiter und beschwerlicher Ort ist doch dieses Irland!« Und erschrocken über die Weite der enthüllten Welt, kehrte sie für immer um auf ihre gemütliche und vertraute Insel.
Ein bisschen weiter die Straße entlang wird man von der gegenüberliegenden Aussicht überwältigt – das Meer und die Inseln und der weite Horizont des Atlantiks. Unten ist Dunquin, weiße verblasste Häuser hier und da und das Muster der Felder am Rande der Hügel. Dann bricht die Klippe zum Meer hin ab und drei Meilen draußen liegen die Inseln. Sie sind die Hügelspitzen, die von ihren Festlandsbrüdern abgesondert wurden und wenn man sie so von oben sieht, könnte man sie für Seeungeheuer aus einer altertümlichen Welt halten, die lustlos ihre von der Zeit zerfressenen Rücken erheben, über den ruhelosen und flüchtigen Wellen. Am nächsten zu uns steht Beiginis, eine kleine flache Insel mit gutem Gras, mit einer Tochterinsel, Oileán na nÓg, die unterhalb ihrer Flanke liegt. Dahinter Great Blasket, An t-Oileán Mór, die große Insel, die sich zu ihrem hohen zentralen Hügel erhebt und die Ansicht der kleineren Inseln Inis na Bró und Inisicíleáin abschirmt. Rechts ist die Nordinsel, Inis Tuaisceart, die in einer eigenartigen zackigen Klippe ausläuft, welche die Insulaner lebhaft an einen Hahnenkamm erinnert. Weit draußen im Meer steigt die von Möwen heimgesuchte Pyramide der Insel Tiaracht auf, die das letzte Licht trägt, das irische Emigranten sehen, wenn sie sich auf ihre lange Reise nach Amerika machen. So ist dies der letzte Strand der Alten Welt, die Inseln sind die westlichsten aller bewohnten Gebiete Europas und bis zu der Zeit von Kolumbus war nichts dahinter als das weite Meer. »War es nicht ein großer Gedanke, den Kolumbus da hatte«, sagte einst ein Mann zu mir, als wir lagen und auf den Atlantik hinausschauten, »dass er Amerika entdeckt hat? Denn wenn da nicht Amerika wäre, würde es die Insel keine Woche mehr aushalten.« Und das ist wahr, denn die wachsende Unfruchtbarkeit hat hier ihr Ziel gefunden und vielleicht nur in solchen Teilen Irlands, wo erst Erde auf die Felsen gehäuft werden muss, bevor die spärliche Frucht gesät werden kann, wird man eine geizigere Erde finden als hier. Und nur die Ernte des Meeres und die Beiträge der amerikanischen Exilanten erhalten das Leben auf der Insel.
Wenn man in Dunquin die Klippe hinuntersteigt, um das Boot zu nehmen, sieht man die zerklüfteten Ecken der Felsen sich ins Meer hinauslehnen, als seien sie in immerwährender Verteidigung gegen den wilden Ansturm der Wellen. Ein rauer Pfad die steile Klippe hinunter führt dich zum Helling, wo das Boot, leicht auf dem Wasser wippend, auf dich wartet. Diese Boote, die Curraghs des Westens, werden hier naomhoga genannt. Sie haben die übliche Struktur aus einem Lattengerüst und geteerter Leinwand und es gibt kein Fahrzeug der Welt, das so leicht auf dem Wasser liegt oder so bereitwillig der schwächsten Anregung des Ruders antwortet. Es gibt keine größere Freude auf Erden als im Heck des naomhog zu liegen, fast vom Wasser umarmt, während die starken Ruderer das Boot über die Wellen reißen. Das Boot arbeitet sich aus dem kleinen Hafen heraus und nimmt Kurs am Strand entlang unter den Klippen. Hier zieht sich die Insel von der Meeresoberfläche, die vom Klippengipfel aus noch so nahe erschienen war, zurück in die Ferne, hinter der tanzenden Gesellschaft der Wellen. »Sag Irland ade«, ruft einer der Ruderer und ich kehre mich um und nehme Abschied, nicht nur von Irland, sondern auch von England und Europa und der ganzen verwirrten Welt von heute.
2 Nicht nur Vieh wurde auf diesen Märkten verkauft, obwohl der Geräuschpegel der »Herden« dafür typisch war. Mícheál de Mórdha, Direktor des Great Blasket Heritage Centre in Dunquin, schrieb mir dazu: »Verkauft wurden auch die Texte verschiedener Balladen in gedruckter Form, meistens auf kolorierten DIN A5-Papierbögen. Die Verkäufer pflegten die Balladen auch selbst zu singen, damit die Leute die gedruckten Texte kauften. Nach einigen Gläsern Guinness wurden damit gute Geschäfte gemacht…«
3 Hier wird auf die Gattung der irischen »aisling«-Gedichte angespielt, für die Aogán Ó Rathaille (1675-1729) einer der ersten und bedeutendsten Vertreter war. In diesen Visionsgedichten geht der Dichter draußen in der Natur spazieren und erlebt die Vision einer Frau aus einer anderen Welt. Typischerweise ist diese Frau Irland und das Gedicht klagt über ihre Geschicke oder ruft ihre »Söhne« dazu auf, gegen die Fremdherrschaft zu rebellieren. – Robin Flower hat sich selbst in diesem Buch an der Gattung versucht: In seinem Gedicht »Überfahrt bei Nacht«. Vgl. auch das Kapitel »The aisling« in »Island Home – The Blasket Heritage« von George Thomson.
DIE ÜBERFAHRT
Das Boot läuft schnell über die Wellen im hastigen Rhythmus der sechs kurzen, fast blattlosen Ruder; oder, wenn der Wind gut weht, folgt es dem Zug des winzigen geflickten Segels. Man sieht die Küste vorüberziehen und das derbe Hauptland von Dún Mór, einst das Zuhause einer legendären Göttin, mit einem Felsen am Ende, An Seanduine, der »Alte Mann«, ein für die Insulaner vertrautes Seezeichen. Dann wendet sich das Boot mit sich aufrichtendem Bug der Insel zu, und nach kurzer Zeit ist es vorbei an Beiginis und die hohe Front der Insel fängt an, sich über einem zu erheben. Zur Rechten ist ein langer Sandstrand, An Traigh Bhan, der Weiße Strand, und vor einem flachen Felsenriff, mit dem Umriss eines Ankers, findet er Abschluss im winzigen Hafen. Das Boot läuft ein, dreht sich um die eigene Achse und man gleitet mühelos auf den Landeplatz unter einer großen Klippe, die mit Kindern besetzt ist, die gefährlich an ihrem Schwindel erregenden Rand herumlaufen. Die Überfahrt ist vorüber und es ist eine der leichteren Art gewesen. Aber es gibt Tage, manchmal sogar Wochen, da die Insel durch den Zorn des Meeres von der außerhalb existierenden Welt abgeschlossen ist. Es gibt eine seltsame Geschichte über eine solche Isolation im Winter der alten Zeiten, die sehr wohl hier erzählt werden mag. So habe ich sie vom Geschichtenerzähler gehört:
»In jenen Tagen gab es keinen Priester näher an der Insel als Paroiste Murach. Eine Familie auf der Insel hatte ein Baby und sie warteten darauf, hinüber zu segeln, Tag für Tag. Aber es gab schweres Wetter in der Tiefe des Winters und vielleicht waren sie ja auch nicht allzu sehr darauf erpicht loszufahren, wie auch immer. So blieb das Kind ein Jahr und einen Tag ungetauft. Da schließlich machten sie sich auf und es gab ein Boot, das über das Meer nach Dingle fuhr. Es stiegen ein: Vater, Mutter und Kind – und das Baby war gerade im Begriff das Laufen zu lernen. Als sie das Haus des Priesters erreichten, war der irgendwo unterwegs, so dass die Haushälterin der Ehefrau einen Platz anbot. Da begann das Baby zu brüllen. Die Haushälterin meinte, irgend etwas würde ihm wohl wehtun.
›Keineswegs‹, sagte die Ehefrau. ›Er ist immer so, wenn er kein Ei in seiner Hand hält.‹
›Wieso‹, sagt die Haushälterin, ›du musst selbst ein bisschen kindisch sein, wenn du glaubst ein empfindliches Baby könne ein Ei in der Hand behalten.‹
›In der Tat und bei meinem Mantel!‹ sagt die Mutter, ›er könnte das und er könnte es auch essen.‹
›Willst du mir sagen‹, sagt die Frau, ›dass ein ungetauftes Kind ein Ei essen kann?‹
›So ist es‹, sagt die Ehefrau.
›Er ist wohl ziemlich schnell gewachsen?‹ fragt die Andere.
›Nun, er ist wohl schon nahezu einen Monat alt‹, sagt sie.
›Ist denn ein noch keinen Monat altes Kind in der Lage, ein Ei in der Hand zu halten und es auch noch zu essen?‹ fragt die Frau.
›Er würde schon‹, sagt die Mutter, ›wenn da auch etwas drin wäre.‹
›Wo kommst du her?‹
›Von der Insel, meine Freundin.‹
›Dann ist das ja kein Wunder, denn die Leute dort sind wild‹, sagt die Frau, ›sie sind schon wild in der Mutter Leib. Hast du genug Muttermilch für ihn in deinen Brüsten?‹
›Keinen Tropfen‹, sagt die Mutter, ›aber ich brauche das auch nicht.‹
›Was gibst du ihm denn zu Essen und zu Trinken?‹
›Ein frisches Ei, ein bisschen frischen Fisch, ein Stück frisches Kaninchen und jeden Mundvoll teile ich mit ihm.‹
›O Ehre sei Gott!‹ sagt die Haushälterin.
Es hat dann nicht mehr lange gedauert bis der Priester eintrat und die Haushälterin sagte ihm, dass sie ein Baby zur Taufe gebracht hätten.
›Wo ist es her?‹ sagt der Priester.
›Von der Westinsel‹, sagt sie.
›Wie sind sie hierher gekommen?‹ fragt er.
›Sie sind geradewegs durch die Bucht gekommen‹, sagt sie.
›Es ist ein Wunder, dass sie das Kind nicht verloren haben, bei so langer Fahrt auf dem Meer‹, sagt er.
›Wie lange auch immer‹, sagt sie, ›es hat ihm nichts ausgemacht, denn jedes Baby dort kann nach einem Monat laufen.‹
›Was sagst du?‹ sagt er.
›Was ich sage ist dies‹, sagt sie, ›dieses hier läuft und ist noch keinen Monat alt.‹
›Sage der Mutter, dass ich sie sehen will.‹
Die Mutter kam.
›Wo bist du her?‹
›Von der Insel, Vater.‹
›Willst du das Kind da taufen lassen?‹
›So ist es, Vater.‹
›Wie alt ist er?‹
›Kaum einen Monat.‹
›Erzählte mir nicht die Haushälterin, er könne laufen?‹
›Er beginnt gerade damit, Vater.‹
›Noch keinen Monat alt?‹
›Ja, in der Tat, Vater‹, sagt sie.
›Hast du noch weitere Kinder?‹
›Ja, Vater: Noch sechs.‹
›Hat eins von ihnen auch schon so früh wie dieser angefangen?‹
›Ja, Vater: Allesamt. Dieser hier macht noch die schlechteste Figur dabei.‹
Der Priester, als er dies hörte, war wie vom Donner gerührt und er stand eine Weile nachdenklich da.
›Fängt jedes Baby auf der Insel an so früh zu laufen?‹ sagt er.
›Ja, und einige sogar schon früher.‹
Wieder hielt er für eine Weile inne.
›Ist das ein Ei in seiner Hand?‹ sagt er.
›Ja‹, sagt sie, ›Ich hab schon lange der Haushälterin gesagt, sie solle es kochen, denn der arme Kerl ist hungrig.‹
›Willst du mir sagen, er würde es essen, wenn es gekocht wäre?‹
›Bei meinem Mantel: Er würde!‹ sagt sie, ›denn zu Hause hätte er schon drei davon verdrückt.‹
›Nun‹, sagt der Priester, ›eine ähnliche Geschichte habe ich noch nie zuvor gehört. Wir können ihn auch gleich taufen‹, sagt er, ›vielleicht bist du ja genauso hungrig wie das Baby.‹
Er bedeutete der Frau, ihm das Ei für eine Weile wegzunehmen, was sie auch tat, woraufhin man das Kind über ganz Dingle hinweg brüllen hörte. Sie mussten es ihm wiedergeben, und er hielt es während der ganzen Zeit der Taufe fest. Als er getauft war, sagte der Priester: ›Wenn er am Leben bleibt, wird er werden wie einer von Irlands Feniern. – Holt euch ordentlich zu Essen von der Haushälterin für euch selbst und das Baby.‹
›Ihre Gesundheit, Vater‹, sagt sie.
Das Baby lebt immer noch, seine Knochen waren stark genug, aber, glaub mir, er war weit davon entfernt, die Kraft der Fenier zu bekommen. Ich gebe dir mein Wort: Die Inselfrau war keine Närrin. Sie dachten sie könnten sie verlachen, doch es war sie, die zuletzt lachte.«
Man könnte schon glauben, wenn man die »Babys« auf der Klippe über dem Hafen laufen sieht, sie alle hätten das Laufen vor dem Ende des ersten Monats gelernt. Sie schreien, wenn das Boot auf den Landeplatz gleitet und stehen eifrig gaffend, während die Männer ausladen und dann das Boot aus dem Wasser heben und darunter hergehend den Weg emporsteigen wie ein sechsfüßiger Mistkäfer. Sie verstauen es auf einen Spreizbock und dann klettern wir alle zur Spitze der Klippe hinauf. Wir haben die Insel erreicht.
Wir sind mit einem Postboot hereingekommen. Der große, schwere Mann, mit dem breiten, gütigen Gesicht und mit der leichten gebieterischen Pose eines Kapitäns eines Küstenschoners, der den Weg den Pfad hinauf anführt, trägt eine Tasche über seine Schulter geschlungen. Er ist der »König« der Insel, Pádraig Ó Catháin, der Diplomat, der Chef und die Autorität im Dorf, der sein Amt durch das schiere Gewicht seines Charakters trägt. Er hält an auf der breiten Fläche an der Spitze der Klippe, löst die Schlinge und öffnet seine Tasche, und die Kinder sind aufgeregt um ihn herum, während er ein paar Brillengläser auf seine Nase setzt, die Briefe nach und nach herausholt und die Adressen laut vorliest. Als jede Adresse gelesen ist, streckt ein Kind nach dem anderen eifrig die Hand aus und rennt mit dem Brief an seinen Bestimmungsort. Als alle Briefe verschwunden sind und die Menge sich zerstreut hat, gehen wir zum Dorf hinauf.
So kommen die äußeren Nachrichten zur Insel; vom Festland, von der nächsten Gemeinde, welche Amerika ist und von England, das im Geiste viel weiter entfernt ist. Ich erinnere mich, wie ich – in einem schicksalhaften Jahr – dastand, und das Segel des über den Sund dahinfliegenden Postbootes beobachtete und mit den Kindern hochging, um seine Ankunft zu erwarten. Der König kam mit der Tasche den Abhang langsam hoch, setzte ihn auf den Boden und sagte, sich zu mir wendend, mit ernster Haltung: »Es gibt Nachrichten heute. Sie haben in der östlichen Welt einen Erzherzog getötet.« Für uns bedeutete das wenig in dieser zurückgezogenen Isolation am Meer. Aber nach einem Monat war ich zurück in London und die vertraute Fabrik des Lebens war für uns alle wie ein Spinnweb im Wind zerrissen – und für die Insel auch, obwohl die Aufklärung erst später kam. Innerhalb weniger Jahre war die Bucht voll von Anti-U-Boot-Schiffen und die Fluten brachten Wracks von Schiffen und die stillen Gestalten der Toten an den Stränden zu Tage. Aber dies war noch in der Zukunft, als ich diese Insel zuerst kennen lernte und dies sind nicht die Erinnerungen, die ich besonders erfreulich finde.
Als wir den Pfad, der unter dem steilen Antlitz des Hügels das Dorf unter uns entfaltet, hinauflaufen, sehen wir einen unregelmäßigen Haufen von Häusern, die aus dem Wind heraus kriechen, wo immer sie einen Schutzwall finden können; die, wenn man zum Himmel blickt, schwarz geteerte Dächer haben, auf denen die Stockfische trocknen. Ganz oben im Dorf ist der Brunnen, wo Frauen und Kinder mit Eimern und Kannen warten, bis die Erde langsam ihr geschätztes Wasser hergibt. Ein Esel steht mit gesenktem Kopf, der geduldig wartet unter der Last seiner Tragkörbe, vollgefüllt mit braunem Torf. Und ein ständiges Schwatzen hebt an, als die Wasserträger spielerisch um den Vortritt zanken oder von Mund zu Mund den beständig aufgeregten Klatsch einsamer Landgegenden weiter-geben. Sie rufen uns an, als wir vorbeikommen und wir tauschen Grüße mit ihnen, erkennen alte Freunde und erneuern eine alte Bekanntschaft. Dann betreten wir die Küche des Königs, er legt seine Tasche ab und heißt uns in förmlichen und beredsamen Worten willkommen zurück auf der Insel. Wir sind froh, wieder hier zu sein und, als ein Freund nach dem anderen nach vorne kommt, um uns zu begrüßen, da ist es, als seien wir trotz langer Abwesenheit endlich wieder zu Hause.
In Dingle haben wir uns mit einer großen Blechdose voll verschiedener Süßigkeiten versorgt und, als die Nachricht sich in den Häusern ausbreitet, führt das zur augenblicklichen Mobilisierung der Infanterie. Die Küche füllt sich auf einen Schlag mit wildhaarigen Kindern. Die ganze Menge schaukelt mit einer seltsamen Bewegung, einer eigenartigen Mischung aus Vorwärtsbewegung und Rückzug, Tapfermut und Bescheidenheit, gutem Benehmen und Ehrgeiz. Die Tochter des Königs ordnet die irregulären Truppen und, nach und nach, schlurfen sie nach vorne und ziehen sich wieder zurück, jeder glücklich mit einer Hand voll Süßigkeiten. Allmählich leert sich die Küche, nachdem sie heraus auf den Hügel gelaufen sind, um ihren Preis verzückt zu betrachten. Aber dann kommt über dich das plötzliche Gefühl von neuer Präsenz im Raum.
Du blickst auf und siehst eine schmächtige aber selbstsichere Figur, die an der Wand lehnt mit der Aura eines Wesens, das sich magisch aus dem Nichts heraus materialisiert hat. Das Gesicht nimmt deine Aufmerksamkeit sofort für sich ein und hält sie fest. Das Gesicht ist dunkel und dünn und aus ihm schauen zwei schnelle und lebendige Augen heraus, lebhafte Zeugnisse einer feinen und selbstgenügsamen Intelligenz. Er kommt auf dich zu und heißt dich willkommen, mit ernster und liebenswürdiger Intonation und gewählter und fließender Sprache. Du bist tatsächlich nach Hause gekommen, denn dies ist Tomás Ó Crithin, der Poet und Geschichtenerzähler der Insel.
Überfahrt bei Nacht
Die dunkle Klippe türmte sich hoch zu flackernden Sternen
Die nichts anderes zu sein schienen als Lichter auf ihrer Kuppe,
Und auf dem schlüpfrigen Kai
Sprachen Männer – ein Schwall aus nicht endendem Gälisch.
Ich stieg hinunter zum Boot,
Eine zerbrechliche Haut, auf unruhigem Wasser schaukelnd,
Und auf Berührung hin zitternd
Und glitt hinaus leise auf den mondhellen Meerweg.
Ich lag im Heck
Spürte jedes Beben des unter uns schlingernden Wassers,
Als Welle um Welle uns hob und senkte.
Funkelnd tropfte Wasser von den Rudern; brennend
Folgten mit mattem Glühen große gespiegelte Kugeln des Mondes
Den fahrenden Ruderblättern. Eine Stimme erhob sich singend
Zur Melodie des verlaufenden Wassers und den Lauten der Ruder:
»Ich traf ein Mädchen an einem nebligen Morgen
Und sie war barfuss unter sich kräuselnden Locken.
Ich fragte sie, ob sie Helena sei oder Deirdre?
Sie erwiderte: ›Niemand von diesen, sondern Irland.
Männer sind für mich gestorben und werden es weiterhin tun.‹«
Dann erstarb die Stimme, und, wachsend im Dunklen
Der Umriss der großen Insel
Erhob sich aus dem Wasser gewaltig verdüsternd,
Und trug Lichter wie Sterne auf seiner Bergkuppe.
Tomás
Ich stand herum, und er
Baute den Torfschober auf mit so sorgfältiger Hand;
Tausend Schober hatten die Hände gebaut, um nun
Zierlich zu arbeiten, geschickt und wie von selbst.
Unter uns die Große Insel
Fiel ab mit weiß glänzenden Gräsern hin zu den Klippen,
Und da tauchten plötzlich hinunter
Einfache Felsenmöwen in murmelnde Wellen.
Weit draußen in der Bucht die Tölpel
Stoppten, wendeten und schossen pfeilgleich hinab,
Und jenseits von Insel, Bucht und fallenden Tölpeln,
Irland, eine nackte Felsenwoge, erhob es sich und fiel.
Er hatte sechzig Jahre auf der Insel gelebt
Und diese Jahre und die Insel lebten in ihm,
Eingraviert in sein Fleisch, in seinem Auge wohnend,
Und all seine Rede formend,
Diese Rede so witzig und wunderschön
Und beladen mit dem Gedächtnis so vieler Toten.
Seine Pfeife anzündend wandte er sich um,
Blickte auf die Bucht und beugte sich zu mir und sagte:
»Wenn du um alle Küsten Irlands herumgehen würdest,
Wäre es schwer für dich zu finden
Etwas so Wunderschönes irgendwo sonst;
Und oft bin ich einsam,
Wenn ich die Insel anschaue und die fallenden Tölpel
Und höre die Fluten einsam in den Höhlen.
Aber, klar: Welch ein merkwürdig Herz, das nie einsam wär.«
TOMÁS
Am Tag meiner Ankunft auf der Insel hatte Tomás den ganzen Morgen über bei Beiginis gefischt und kommt am frühen Nachmittag in die Küche mit einem großen Brassen.
»Das ist ein feiner Fisch, den du da hast,« sage ich.
»Er ist für dich, denn ich dachte du solltest am ersten Tag deiner Rückkehr zur Insel einen guten Fisch zum Abendessen haben.«
Ich nehme den Fisch und lege ihn auf den Tisch herunter und beginne, ihm in meinem holperigen Irisch zu danken.
»Danke mir nicht, bevor du meine ganze Geschichte gehört hast«, sagt er.
»Nun«, sage ich, »keine Geschichte könnte meinem Dank abträglich sein.«
»Dann höre. Als ich heute Morgen vom Fischen zurückkehrte, hatte ich zwei Brassen, eine größer, eine kleiner. Die da ist nicht die Größere der beiden.«