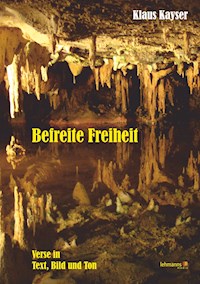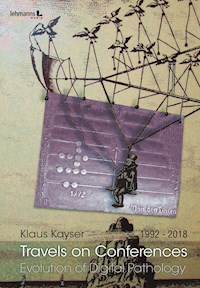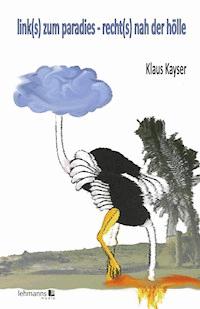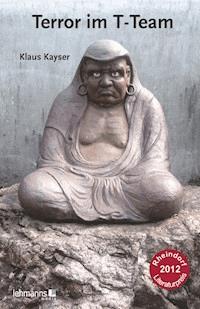Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lehmanns
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der forsche Wandergesell Jupp Kiepenlad verlässt nach Beendigung seiner Lehre das Elternhaus, schultert seine Kiepe und berichtet von den Erlebnissen seiner Wanderschaft in fünfzehn farbenfrohen, humorvollen Erzählungen. Als seine Kiepe ausgelesen ist, kehrt er in sein Elternhaus zurück und richtet sich dort ein neues Leben ein. Seine Berichte schildern unter anderem die Bemühungen eines vierbeinigen Fremdenführers, der ihn in die Welt der hellenistischen Antike einführt, die Auferstehung des Christopher Columbus in den südamerikanischen Anden, das Schicksal eines Kokosnussdiebes auf einer Südseeinsel, Gespräche mit einem kolumbianischen Philosophen in Heidelberg, die gefährlichen Seefahrten des Geheimagenten Joe Sindbad, den Tod der Gartenzwerge nach der deutschen Wiedervereinigung, oder auch die sexuellen Auswirkungen der Abraham Omega Theorie in der unendlichen Unsterblichkeit. Die eigenständigen Erzählungen sind durch kurze Übergangskapitel mit einander verbunden. Reales Erleben, allgemeine Lebenserfahrungen, neue Technologien sowie Märchen und Religion führen zu überraschenden, wundersamen Ereignissen. Ein Roman mit unwirklich realen Geschichten oder eine romanhafte, tiefreichende Sammlung eigenständiger lebensfroher Erzählungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die wunderlichen Erzählungendes Jupp Kiepenlad
Klaus Kayser
Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© 2016 Lehmanns Media Verlag
Helmholtzstraße 2-9 • 10587 Berlin
www.lehmanns.de
Korrektorat: Marianne Günther
Umschlagbild: PD Dr. Gian Kayser
ISBN 978-3-86541-894-4
Für Charlotte, Christina, Johannes, Julia, Theresa,
sowie Corinna, Gian, Claudia, Maria-Consuelo und Martin
Der Autor
Klaus Kayser, Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult.
Professor für Pathologie und Epidemiologie an den Universitäten Heidelberg und Berlin. 1940 in Berlin geboren, Studium der Physik und Medizin in Göttingen und Heidelberg, lebt seit 1970 in Heidelberg
Neben mehreren Fachbüchern schrieb der Autor humorvolle und kritische Bücher:
Zeitgedanken und Spiegeldenken, Rendezvous, Baden-Baden, 2000;
Der Tod eines Körperspenders, Lehmanns Media, Berlin, 2005;
Terror im T-Team, Lehmanns Media, Berlin, 2012, Rheindorf Literaturpreis;
Restrisiko oder die heiligen Kühe der Nation, Lehmanns Media, Berlin, 2013;
Erlebtes Erleben, Ein Gedichtporträt, Lehmanns Media, Berlin, 2016;
Zu der ersten Erzählung
Ja, wir treffen uns hier zum ersten Mal. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Wenn Sie mit mir zusammen an einem Bier-tisch sitzen und auf anregende Gespräche hoffen, dann sollten Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. So wird später alles leichter. Vielleicht entwickelt sich zwischen uns auch so etwas wie Freundschaft oder zumindest ein vergnügliches Mit-einander und Auskommen.
Also, wissen Sie, ich bin Jupp Kiepenlad. Wirklich, ich heiße Jupp Kiepenlad. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört. Nein? Sie kennen mich nicht? Nun, da kann ich Ihnen gern nachhelfen:
Ich komme aus Norderpfuhlbad, einem zugegebenermaßen kleinen Fischer- und Kuhnest, da oben an der Nordseeküste. Es ist ein Zweihundert–Seelen-Nest, strohbedeckte Häuser, Kopfsteinpflaster, ein Tante-Emma-Laden, eine Fischräuche-rei, ein kleiner Hafen. Ach, was sage ich da, der Hafen ist nur eine kurze Mole in einer winzigen Meeresbucht.
In diesem Nest wurde ich geboren, bin im Nachbarort, Süder-pfuhlbad, ungefähr vier Kilometer von Norderpfuhlbad ent-fernt, zur Schule gegangen. Bin schon als Sechsjähriger immer mit dem Fahrrad gefahren, zur Schule und zurück, jeden Tag, auch Samstags, denn wir hatten auch am Sonnabend Schule, bei jedem Wetter.
In dieser Gegend, da, wo der gelbe Ginster blüht, die Hecken-rosen die Sanddünen bedecken und kleine Mulden für Lieben-de beschützen, dort bin ich – wie man so sagt – aufgewachsen. Mit vierzehn Jahren beendete ich meine Volksschule, auf der ich so mit Ach und Krach als kräftiger, forscher Junge meinen Abschluss schaffte.
Danach schickte mich mein Vater in die Zimmermannslehre.
Das Arbeiten fiel mir schwer. Ich wollte frei sein, so frei wie das Meer, wenn es versucht, an den Dünen hochzuklettern, und gar nicht bemerkt, dass es nur ein Sklave des Sturms ist, der es wütend vor sich her peitscht.
Freiheit war mein Lebensziel. Ein Zimmermeister, der sich stets nach den Plänen des Architekten und, schlimmer noch, nach denen des Bauherrn, der immer in letzter Sekunde noch kaum zu verwirklichende Änderungen am Bauwerk oder am Dachsims verlangt, richtet, so ein geknechteter Zimmermeister wollte ich nicht werden. Da stand mir schon mein Bart, den ich mir im Alter von sechzehn Jahren, kurz vor dem Ende meiner Gesellenzeit, anlegte, im Wege.
Die Gesellenzeit hielt ich noch durch. Auch mein Meister-stück, ein frei erfundener Stuhl mit ausziehbarer Schublade an der Lehne, fand die allgemeine Anerkennung meiner fachmän-nisch prüfenden Lehrmeister.
Nebenbei aber, im Geheimen, unbemerkt von meinem Meis-ter, in den Freizeitstunden und manchmal auch in der Mittags-pause, wenn es sich so ergab, fertigte ich mir meine Kiepe, ei-ne große, meinem kräftigen Rücken angepasste Kiepe, mit Geheimfach und Abdeckplane, mit kräftigen Lederriemen und dicht geflochtenen Weidenrinden.
Diese Kiepe wurde mir mein ständiger Begleiter auf meinen Reisen und Erlebnissen, von denen ich Ihnen – ich muss noch Sie sagen, wir kennen uns ja noch nicht so lange und Duzbrü-derschaft haben wir auch noch nicht getrunken, dazu wäre es nach diesen wenigen Minuten, in denen Sie mir zuhören und mich mustern, auch viel zu früh, also, von denen ich Ihnen in Kürze berichten werde.
Meine Kiepe hat mindestens ebenso viel gesehen, wie meine Augen geschaut, meine Ohren vernommen und meine Haut in fremder Luft gespürt haben. Sie war mein ständiger Begleiter.
Neben der täglich notwendigen Wäsche, einem Handtuch, ei-nem außen aufgebundenen Schlafsack, Brot für den Notfall, notwendigem Werkzeug zur Ausübung meines Handwerks, ei-nem Kompass und einer Wasserflasche waren in ihr auch ein Tagebuch sowie Schreibzeug sicher in einem kleinen Seiten-fach verstaut.
Sie meinen, so ein rauer und freiheitssüchtiger Geselle, der sich mühsam seinen Unterhalt auf seinen Freiheitswegen verdienen müsse, könne gar nicht schreiben und schon gar nicht ein Ta-gebuch führen? Wie sollte er denn das tun, wenn er müde und völlig erschöpft sich ein Strohnachtlager bei einem armseligen Ökobauern ausbittet und sofort in einen tiefen Schlaf nahe der Ohnmacht fällt?
Nun, da müssen Sie noch viel lernen! Denn ich bin der Kie-penlad, der Jupp Kiepenlad! Und der kann lesen und schrei-ben!
Schon als kleines Kind, kaum dem Begreifen der Schrift und des Lesens entwachsen, griff ich zum Bleistift und schrieb mir meine Freiheit von der Seele. Meine Freiheit, die mir das Meer an rotwarmen Sonnenuntergängen romantisch vorgaukelte, obwohl – und hier liegt der bemerkenswerte Widerspruch – obwohl das Meer ja nur ein Sklave des immer unruhigen, im-mer auf seine Opfer lauernden Windes und seiner Artgenos-sen, des Sturmes und der Orkane, ist.
Aber das ist gar kein Widerspruch: Es ist nur die Sehnsucht des getriebenen, manchmal in Ruhe gelassenen, manchmal sich Erfolg versprechend versteckenden Sklaven. Es sind seine Träume, seine Sehnsucht, sein Verlangen und seine Gier nach Freiheit, die das Meer erschöpft und traurig mir zuflüsterte. Leise und sanft, so wie die Wellen zart den flach ansteigenden Strand anlaufen, um sich am Ende ihrer Reise erschöpft, aber zufrieden in sich selbst zurückzuziehen. So gibt sich die Nord-see dem, der sie versteht und der sie liebt.
Ich habe sie scharf beobachtet, ihr genau zugehört. Ich habe mich nicht – wie es die fremden Besucher, die Touristen tun – von den farbenfrohen Verlockungen des Sonnenunterganges und den dem Meer aufgezwungenen Spiegelungen ablenken lassen.
Nein, hören Sie mir genau zu: Diese Dinge sind Ablenkungs-manöver der Beherrscher des Meeres, Ankündigungen ihrer kommenden Strafe für die See, wenn sie ihren treuen Jüngern von den Wünschen erzählt, die seit Menschheitsgedenken alle Sklaven verspüren.
So bin ich zu Jupp Kiepenlad geworden.
Ich erinnere mich noch genau, als meine Gesellenzeit mit dem Abschlusszeugnis vergangen, mein letztes Gehalt mir ausge-zahlt, meine weitbeinigen Hosen angelegt, meine Kiepe wohl verschnürt waren und ich mich auf meine Wanderschaft in die – wie ich damals noch meinte – grenzenlose Freiheit begab. Ich habe vergessen, dass ich auch eine kleine Mundharmonika einsteckte, die mir mein Vater mit den Worten „Na Jupp, nu mal los, moi, moi und alzeits goode Fahrt“ beim Abschied schenkte und mir zurief: „Machs good, Jupp, speel auf der Mundsaag! Den Speel, das werde wir immer hören und dann werden wir an dich denken!“
Sehen Sie, so war das damals bei meinem Abschied aus dem Elternhaus. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mir meine Kiepe auf den Rücken schwang, meine Mutter mich noch einmal fest umarmte und auf die rechte Wange küsste, wie ich ruhig und voller Zuversicht das Elternhaus verließ, mein Vater langsam die Haustür hinter mir zudrückte und ich, ohne mich noch einmal umzusehen, die Kopfsteinpflasterstra-ße in Richtung Süderpfuhlbad entlangschritt.
Die Sonne schien. Es war ein schon recht warmer Frühlings-tag. Die Sonne zog mich nach Süden, immer nach Süden. Die Traurigkeit, die ich in meinem Elternhaus zurückließ und die mich in den ersten Tagen meines neuen Weges an die wär-menden Sonnenuntergänge an der Mole von Norderpfuhlbad denken ließ, verschwand langsam in den aufregenden Tagen meiner Wanderung. Ich war mit mir und meiner Freiheit allein.
Da war kein Haus, das mir den freien blauen Himmel verdeck-te. Da war kein drängelnder Wecker, der mir den Sonnenauf-gang raubte. Da war kein oberflächliches Geschwätz mit den Arbeitskollegen, keine Aufregung über unnötig vergossene Zeit. Ruhig und fest schritt ich meine Wege entlang, deren grobe Richtung mich nach Süden wies, deren Einzelheiten ich aber nach Zufall oder meinem Gefühl wählte.
Sie meinen, dass ich friedlich meines Weges ging? Ich glaube, hier irren Sie!
Ich war frei in meinen kleinen aber langfristig so wichtigen Entscheidungen, ja genau, ich war frei.
Aber friedlich war ich nicht. Kam mir ein Käfer unter meine Wanderschuhe, dann zerdrückte ich ihn mit einer Freude, die aus meinem Wissen um meine Freiheit und meiner einmaligen Existenz als freier Mensch sowie der hieraus abzuleitenden Überlegenheit über alles Krabbelgetier entsprang.
Hörte ich eine Amsel im nahen Gebüsch, die mich freudig mit ihrem Gesang begrüßte, dann warf ich einen Stein nach ihr. Ich freute mich, wenn er direkt neben ihr einschlug und sie über alle Maßen erschreckte. Mein Mundharmonikaspiel war zwar in der Perfektion der Durchführung ihrem Gesang unter-legen, aber ich spielte auf einem Musikinstrument, während sie nur ihren Schnabel bemühte. Ich war der freie Mensch, der sich allen Geschöpfen überlegen fühlte.
Sie bemerken sicherlich, dass ich in der Vergangenheit spreche. Habe ich noch heute, nachdem ich so viele Wanderstiefel durchgelaufen und, wie Sie noch hören werden, so viele Län-der erkundigt, fremde Menschen und Tiere getroffen habe, dieselben Vorstellungen von meiner Überlegenheit?
Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ja, vielleicht nur nicht unbe-dingt, vielleicht auch nur noch ein wenig.
Wissen Sie, da war ein Erlebnis in Griechenland, das mir zu denken gab.
Ja, ich erreichte unter einigen Mühen und nach vielen Monaten der Wanderschaft Griechenland. In diesen Monaten musste ich bei meiner Entwicklung zu einem freien Mann mehrere Unterbrechungen zum Geldverdienen einlegen. Denn auch ich kann nicht nur von freier Luft und Lebenslust leben.
Es war oben in Griechenlands Norden bei Meteora auf dem Weg nach Joannina. Auf meinem steinigen Weg entlang der asphaltierten Straße sprangen drei wildernde Hunde vor meine Füße und bellten mich, wie ich meinte, durchaus böse an.
Da brannte meine Friedlosigkeit so richtig mit mir durch. Ich ergriff den nächsten kräftigen Stock und drosch mit aller Kraft auf die kläffenden Köter ein. Die waren offensichtlich über-rascht und liefen heulend davon.
Während die zwei größeren Hunde jaulend verschwanden, blieb der kleinere der drei in einem achtbaren, aber doch recht nahen Abstand vor mir sitzen und schaute mich mit traurigen Augen an, so als wollte er sagen: „Wir wollten doch nur mit dir spielen, dich freudig begrüßen. Du bist doch ein Fremder und Fremde sind in unserem Griechenland gern gesehen!
Bist du als gebietender Mensch so dumm, dass du nicht einmal unsere Gebärden deuten, geschweige denn unsere Sprache verstehen kannst? Schränkt deine Freiheit die dir gegebene Klugheit so ein, dass du dich nicht einmal mit uns einfachen, ungelernten und verwilderten Hunden verständigen kannst?
Vielleicht suchst du dir einen klugen Gedanken, wie du deine Freiheit mit deiner Klugheit in Einklang bringen wirst?“
Damit sprang er unter leisem Gejaule davon und eilte seinen Gefährten nach.
Mir blieb seine Hundemiene noch lange im Gedächtnis und damit aber auch die verteufelte Hundefrage: Wie viel soll ich denn von meiner Freiheit abgeben, damit ich nicht vollständig verblöde und vielleicht einmal den Verstand eines Hundes er-reiche?
Das frage ich Sie. Bitte warten Sie mit Ihrer Antwort. Denn zuvor ich möchte Ihnen erzählen, wie klug Hunde sind. Wie viel an Hunde- und Menschenverstand sie besitzen. Wie sie ihn zum Nutzen von uns Menschen einsetzen können, ja, seit vielen tausend Jahren einsetzen. Diese kleine Geschichte hat mir ein älteres Ehepaar bei Wein an einem warmen Sommer-abend berichtet. Ich erzähle wortgetreu.
Der vierbeinige Fremdenführer
In Europa, in unserem Europa, zeigen manche Länder Eigen-schaften, die nicht von dieser Welt sind. Diese Länder schei-nen dem Himmel nah, von Geistern besetzt und von Teufeln getrieben zu sein.
Nein, ich spreche nicht von den Elfen und Trollen, die in hel-len Sommernächten verspätete Wanderer in regennassen nor-dischen Wäldern erschrecken.
Nein, ich spreche nicht von Alberich, der immer noch entlang des Rheins nach seinem von ihm sorgsam versteckten und dann im Rahmen seiner Alzheimer-Krankheit nicht wiederzu-findenden Nibelungenschatz sucht.
Nein, auch nicht von den Tolkienschen Elben, die aus altengli-schen Schlössern in die Londoner Innenstadt fliegen und dort in biertrunkenen Pubs ihren Zauber ausüben; nein, von all die-sen wohl bekannten und genau untersuchten Mittlern zwi-schen Geist und Geistern, Träumen und Gedanken spreche ich nicht.
Auch nicht von Italien, das mit seiner bezaubernden, zitro-nenblühenden Landschaft, dem immer reinlichen und allen Umweltbedingungen genügenden, weil sorgsam erhöhten und genau angepassten, sonnigen Meer, seinen feinen, täglich von Plastikresten gesäuberten Sandstränden, seinen unendlichen Zeugnissen aus der ruhmreichen Vergangenheit und seinen liebestollen Paparazzi bei jedem Wetter eine unübertreffliche Touristenattraktion darstellt. Auch Italien ist in diesem Zu-sammenhang zwar bedeutungsvoll, aber nicht federführend.
Bleiben noch Frankreich und Spanien, die beiden kulturbela-denen Länder mit den uralten kunstvollen Darstellungen grau-samer Quälereien in gebetsreichen Kirchen, die als ehemalige Erntedankfestlichkeiten noch in Stierkämpfen überlebt haben.
Auch diese beiden sonnenbeladenen, gastfreundlichen Länder sind mir in diesem Zusammenhang zwar denkwürdig, aber durchaus nur am Rand erwähnenswert.
Was bleibt? Österreich oder die Schweiz? Mein Gott, in sol-chen Höhen kommt der Geist nicht zum Tragen, er fliegt da-von in das allzu nahe Himmelsgewölbe.
Dann also der Balkan, Kroatien, Serbien, Rumänien, oder gar Ungarn? Leider reden wir hier nicht von Paprika, Knoblauch, Geigengewirr oder Zigeunern, die uns jetzt mit staatlicher Hil-fe unsere alt gedienten deutschen Eigenschaften wie Arbeits-wut, Pünktlichkeit und treu gestaltete Leidensfähigkeit abbet-teln wollen. Nein, auch von diesen Ländern kann hier nur un-ter „ferner liefen“ die Rede sein.
Was bleibt? Griechenland! Natürlich, unser Griechenland!
Griechenland mit all seinem Licht, seinem von antiken Helden verunstalteten Land, seiner kaum tragfähigen und bis heute noch nicht vollendeten Demokratiegeburt, seinem überschäu-menden Gesang und Tanz, ja, hier ist von Griechenland zu er-zählen! Von Griechenland und seinen so gebildeten, weil Ho-mer zitierenden Touristen!
Als Touristen waren in dem hier zu berichtenden Ereignis auch meine Frau und ich unterwegs.
Wir beide sind schon eines älteren Jahrgangs und befanden uns auf Entdeckungsreise in der grünen, waldbewachsenen, götter- und heldenträchtigen und einst vom Englischen Kö-nigreich verwalteten Insel Korfu.
Nach einem ausgiebigen Frühstück und eindringlicher Bewun-derung des – leider bei mir nie vorhanden gewesenen und jetzt altersgeschrumpften – so eindrucksvollen und das weibliche Geschlecht so anziehenden, muskulös durchtrainierten Kör-pers des trojanischen Helden Achill begaben wir uns auf die Suche nach dem Heiligtum des donnernden und immer gewalttätig bösen Meergottes Neptun, der, da bereits von den al-ten Griechen errichtet, auch Poseidon genannt wird.
Wie in den alten Quellen überliefert, hatte Poseidon so seine Schwierigkeiten, seine Gläubigen zufrieden zu stellen oder gar zu verstehen. Er war immer enttäuscht. Hieraus wuchs sein Zorn auf seine Priester, die wiederum ihrer seefahrenden Ge-meinde zwar Schutz und sichere Heimkehr versprachen, diese Zusagen aber fast nie einhalten konnten. So mussten viele der gläubigen Seefahrer ertrinken. Das bewirkte unter anderem ei-ne im Laufe der Jahrhunderte sinkende Anzahl der Poseidon dienenden, an ihn glaubenden Priester und Jünger. Folgerichtig sind sie heute ausgestorben.
Nur träumend wandernde Touristen, fest auf dem Land ver-ankert und somit Poseidons Zorn nicht mehr oder nur bedingt ausgeliefert, pilgern noch zu seinem ehemals häufig besuchten und damals von Geld triefenden Heiligtum, das vor vielen hundert Jahren in einem lichten Kieferhain errichtet worden war.
So pilgerten auch wir beide, meine Frau und ich, auf dem leicht ansteigenden, auch heute noch durch einen lichten Kie-fernwald sich schlängelnden, sandigen Weg.
Wir hatten einen sorgsam in Plastik verpackten, vor einigen Tagen in einem winzigen Lebensmittelladen gekauften und noch nicht ausgepackten, in Scheiben geschnittenen Schinken in unserer Wandertasche, mit dem wir uns unter Poseidons sorgsamem Schutz oder, falls notwendig, auch unter seinen zornigen Blicken bei Erreichen und nach Bewunderung des al-ten Heiligtums stärken wollten.
Kaum hatten wir den Waldweg betreten und auf einer ausge-breiteten Wanderkarte die wahrscheinlichste Wegrichtung er-kundet, da gesellte sich aus dem rechtsseitig einmündenden
Nebenweg ein, wie es sich später herausstellen wird, ortskun-diger vierbeiniger Fremdenführer zu uns.
Es war ein mittelhoch gewachsener, gepflegter, schwarz-brauner, am ehesten einem Schäferhund zuzurechnender, aber durchaus mit zusätzlichen Merkmalen einer anderen Hunde-rasse wie Collie, Manchester Terrier oder Schipperke ausge-statteter und äußerlich sehr ansprechender Hund mit einer ausgesprochen intelligenten Maske.
Er kam in einem freudigen Trab auf uns zugelaufen, musterte uns eingehend, umkreiste uns in einem achtungsgebietenden, ungefähr zwei Meter breiten Abstand und trabte unter leisen auffordernden Lauten vor uns her. Offensichtlich war er mit allen örtlichen Gegebenheiten wie Wegkreuzungen oder auch unserem Zielort, dem Poseidon Tempel, vertraut. Wir hatten es ihm zwar nicht mitgeteilt, aber er wusste genau, wohin wir gehen wollten.
Immer wieder schaute er sich nach uns um, besonders dann, wenn der Weg sich aufgabelte und wir zögerten, ob wir nun die rechte oder die linke Abzweigung nehmen sollten.
Zu Beginn unserer Führung begrüßten wir ihn freundlich, spä-ter unterhielten wir uns mit ihm wie mit einem alt vertrauten Freund: „Nun, lieber Freund, jetzt sind wir bereits eine knappe Viertelstunde zusammen. Bisher hast du uns gut geführt. Wie aber heißt du eigentlich? Wie sollen wir dich nennen?“
Er schaute uns an, wedelte freudig mit dem Schwanz, blieb aber still und lautlos.
„Nun, dann nennen wir dich einfach Hermes, Hermes den Götterboten. Du wirst uns doch sicherlich zu einem deiner Herrn und Götter, Poseidon, führen?“
Er wedelte wieder, diesmal aufgeregt mit seinem ganzen Hin-terteil. Es schien mir auch, als nickte er mehrmals mit seinem Kopf.
An einer Kreuzung bogen wir nach rechts ab, er aber lief gera-deaus. Als er bemerkte, dass wir ihm nicht folgten, machte er kehrt, bellte kurz und eindringlich. Dann nickte er mit dem Kopf, als wir unseren Fehler bemerkten, zur Kreuzung zu-rückkehrten, ihm freundlich zuwinkten und uns weiterhin sei-ner Führung anvertrauten.
So erreichten wir sicher und auf direktem, also kürzestem Weg Poseidons Heiligtum. Viel war von der ehemaligen Pracht des einst wichtigen und oft besuchten Tempels nicht mehr vor-handen. Die Zeit hatte das Dach verschlungen und die Mauern abgetragen. Nur das Fundament war von überwuchernden Pflanzen gesäubert. Die Außenmauern waren gegen den Zeit-verfall halbhoch neu aufgerichtet worden.
Unser vierbeiniger Führer zeigte Zufriedenheit und Freude, dass wir uns ihm anvertraut hatten, und wollte sich schon un-ter hellem Gebell verabschieden, als wir darüber nachdachten, wie wir uns bei ihm bedanken sollten. Streicheln kam nicht in-frage, er wich jeder diesbezüglich angedeuteten Berührung aus. Freundliches Zureden erschien uns nicht ausreichend.
Da dachten wir an die eingepackten Schinkenscheiben. Meine Frau ergriff die Plastikpackung, ließ sie aber schreckensbleich sofort fallen: Der an sich leblose Schinken bewegte sich unter einem Gewimmel von Schaben, die sich, völlig ahnungslos des nahenden Schicksals, an dem Fleisch gütlich taten.
Ich muss zugeben, auch ich war nicht vollständig über den Ekel erhaben, ergriff aber mutig die Packung, riss sie an einer Stelle auf und bot sie unserem vierbeinigen Führer als Ver-dienst für seine so erfreuende Begleitung und Leitung an.
Er zögerte keinen Augenblick, zerbiss die noch intakten Teile der Hülle und verschlang unter wohlgefälligem Knurren und immer wieder dankbar zu uns gerichteten Blicken das ihm
überreichte und offenbar wohlschmeckende Gericht. Wir wa-ren es zufrieden.
Nur für die Schaben, die sich wohl auf ein weiteres Wohlerge-hen und eine weit in die Zukunft reichende Konstanz ihrer Nahrungsquelle eingerichtet hatten, war das Schicksal in Form der Hundeschnauze hart und unerbittlich: Sie wurden ebenfalls mit Genuss verspeist.
Die Glücklichen unter ihnen, genauer beschrieben als die dem Tod Entronnenen, flüchteten in das angrenzende Gemäuer, in dem sie neuen Gefahren und Unwägbarkeiten ausgesetzt wa-ren. Denn Eidechsen, die letzten der noch lebenden Posei-dongläubigen, erwarteten sie hungrig und gierig.
Sichtlich gesättigt, verließ uns der vierbeinige Führer, winkte uns noch einmal wedelnd mit dem Schwanz unter sichtbar dankbaren Augen zu und trottelte davon. Nicht zurück zum Ausgangspunkt unserer Wanderung, nein, weiter in die entge-gengesetzte Richtung, so, als wolle er, zufrieden über seine er-brachte Leistung, neue Welten erkunden.
So, als wolle er Poseidon sagen: „Ich habe dir deine neuen Jünger unversehrt und mit klaren Gedanken überreicht. Nun zeig du mir, wo ich mich weiterhin nützlich machen soll.“
In Gedanken folgte ich ihm, bis ich ihn hinter der nächstgele-genen Wegbiegung aus den Augen verlor. Was wird ihn auf seinem Weg erwarten? Kehrt er zurück zu seiner Jugendfreun-din? Wird er ihr von uns, den ahnungslosen Touristen, die ihn mit Schaben und von Schaben angefressenen Schinkenschei-ben belohnt haben, erzählen?
Ich wandte mich an Poseidon: „Hei, du alter Gott Poseidon! Gar viele deiner an dich Glaubenden haben hier zu dir um Gnade und Erfolg, Überleben und Gesundheit, Sieg und glor-reiche Heimkehr gebetet.
Ihr alten Gemäuer, nur unwesentlich von uns heute Lebenden erneuert und halbherzig am Leben erhalten, was habt ihr zu berichten? Was war denn nun wichtig in all euren und deinen, Poseidon, unabwendbaren und unveränderbar vergangenen Zeiten?
Was war von überragender Bedeutung für die einst hier Le-benden und für euch, die ihr als Götter Hoffnung und Glück versprochen, und doch so oft nur Tod und Verderben verteilt habt?“
Ich hatte mich auf eine hölzerne Bank mit Blick auf den von Grasbewuchs befreiten, noch vorn von zwei hohen Säulen be-grenzten Tempel gesetzt. Meine Frau saß neben mir und an mich gelehnt.
Ob sie wohl dasselbe dachte wie ich?
Stellen Frauen und Männer dieselben, an die Ewigkeit gerich-teten Fragen? Denken die Weiber, wie von manchen herausra-gend intelligenten Denkern genannt, nur an den irdischen Fortbestand der Gene in Form ihrer Kinder und Enkelkinder? Oder an die Ankunft im himmlischen Paradies, das ihnen hier auf Erden verwehrt ist in einem Leben, das von schmerzhaften Geburten begleitet ist, während die Männer nur Freude und Verlangen in der notwendigen Vorbereitung des späteren Nachwuchses empfinden?
Noch während ich so grübelte und mich an freudige und an weniger glückliche Umstände in meiner Kindheit und Jugend zu erinnern versuchte, erblickte ich schemenhaft und in auf-steigenden Meeresnebel gehüllt Poseidon in all seiner bärtigen Größe und mannhaften Gestalt. Drohend schwang er seinen Dreistab:
„Du da, du auf der Bank! Was grübelst du über mich und mei-ne verwesten Gläubigen. Ich habe sie beschützt, ja! Ich habe sie in tobender See ertrinken lassen, ja! Ich habe keinen Unterschied zwischen denen gemacht, die mir treu dienten, und de-nen, die mich argwöhnisch verachteten, oder sich später sogar von mir lossagten und bekämpften! Ja! Da ist kein Unterschied für mich!
Der Unterschied liegt allein in den Lebenden! Du hast die Schaben vernichtet, die an deinem Schinken knabberten. Mein Bote, dein vierbeiniger Führer, hat sie gefressen und sich daran erfreut. Er hat dich unter meiner Aufsicht gut geführt.
Die hungrigen Eidechsen in meinen Gemäuern erfreuen sich der neuen Nahrung, der entflohenen Schaben. Ich werde auch sie weder beschützen noch vernichten, selbst wenn sie in mei-nen Mauern Schutz und Geborgenheit suchen.
Ich stehe über den Dingen. So, wie du über deiner Zukunft und zugleich über deiner Vergangenheit stehst. Du beschützt diese beiden und bist ihr einziger Besitzer. Aber du stehst über ihnen, über beiden!
Was gehen dich meine Vergangenheit und meine, selbst wenn für euch Nachgeborene nicht mehr ersichtlich, meine Zukunft an? Meine Gegenwart ist Stein, hier, nur Stein! In deinen Ge-danken bin ich nicht Poseidon, da bist du Poseidon!
Denn nur du bist Gegenwart, und nur Gegenwart bist du!
Also suche nicht nach dem Sinn des Lebens, der Welt oder ir-gendwelchen anderen törichten Dingen in Vergangenheit oder Zukunft. Da sind diese Fragen sinnlos. Und auf sinnlose Fra-gen ist jede Antwort richtig, genau, jede Antwort!
Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums oder meiner jetzt steinernen Gestalt in der Gegenwart!
Nur die Gegenwart zählt! Nur in der Gegenwart haben Götter, also auch ich, der unsterbliche, der machtvoll böse, selten hilf-reiche Poseidon Macht und Einfluss. Nur hier liegt ihr Sinn. Nur hier kannst du ihn erkennen!
Suchst du in der Vergangenheit, die stets nach deiner Gegen-wart erscheinen wird, ist ihr Sinn verloren. In der Zukunft, die du, wenn auch nie, zu erleben meinst, ist er noch nicht vor-handen. Das ist meine Botschaft an euch Menschen, ob ihr nun meine Jünger seid, ich euch gleichgültig bin oder ihr mich hasst! Nur die Gegenwart zählt!
Nimm meinen Dank für deinen Besuch. Aber hüte dich! Ich bin wie du, unberechenbar, hilfreich und Unheil bringend zu-gleich.
Ich schicke dir noch meinen Boten, den vierbeinigen Führer, den du Hermes genannt hast. Sieh dort, mein Bote Hermes kommt zu dir zurück. Er wird dir deinen Heimweg weisen.“
Wirklich, unser vierbeiniger Führer, der von uns Hermes ge-nannte, gepflegte Hund, kam zurückgetrottet, langsam, aber mit erhobenem Kopf und freudigen Augen. Sie leuchteten.
Meine Frau und ich erhoben uns nachdenklich von der Bank. Wir folgten unserem vierbeinigen Führer. Er wies uns, wie zu Beginn unserer Wanderung, wieder den Weg. Den Weg zurück in unsere Zeit, zu dem Hotel, später nach Haus und sicher zu uns selbst.
Zu der zweiten Erzählung
Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Wie kann ein solcher Hundeverstand entstehen? Warum führte dieser so gebildete Hund Hermes das ältere Ehepaar zu Poseidons Tempel?
Erwartete er eine Belohnung? Oder wollte er gar die Freiheit der Entscheidung für die ältlichen Leute, die vielleicht schon altersbedingt in ihren Wahrnehmungen beschränkt sind, be-schneiden?
Mir hat diese Geschichte zu denken gegeben, mich aber nicht zu einem Hundefreund gemacht, wie Sie vielleicht annehmen könnten. Nein, ein Hundefreund bin ich deshalb noch lange nicht geworden!
Aber kommen wir zurück zu mir, zu Jupp Kiepenlad. Mit schwer beladener Kiepe, in die sich so mancher historische Stein – ich weiß nicht, wie und wann – hineingefunden oder verirrt hatte, suchte ich nach meiner Freiheit.
Ich dachte mir, dass in Griechenland die uralten Zeugen, die verkrustet und versteinert aus ihrer Zeit der Freiheitskämpfe gegen das übermächtige Perserreich und gegen die nicht min-der herrschsüchtigen Türken über Sieg und Niederlage, Ver-stand und Unverstand, Hinterlist und Heldenmut berichten, auch für mich kleinen, friedlosen und freiheitsliebenden Jupp Kiepenlad unverrückbare Wahrheiten bereithielten.
Waren die alten Griechen, die vor mehr als zweitausend Jahren lebten, frei?
Waren sie derart freiheitsliebend, dass sie dafür bereit waren zu sterben, wie die alten Dokumente bezeugen?
Woher kam dieser Freiheitsdrang, wenn es ihn überhaupt ge-geben hat?
Wer hat ihnen diesen Freiheitsdrang eingehaucht?
Waren es ihre heiligen Götter? Waren es ihre mit dem über-mächtigen Meergott Poseidon verbundenen Hellseher, die zwar nie genau, aber immer zutreffend die Zukunft voraussa-gen konnten?
Unsere schlauen Wissenschaftler sagen, dass sich die griechi-schen Hellseher betäubenden Dämpfen aussetzten, dann Ver-bindung zu ihren Göttern aufnahmen, geistreich allgemein gül-tige Sprüche verfassten, dafür viel Geld verlangten und auch bekamen.
Ich meine, auch wenn Sie mir nicht unbedingt zustimmen werden, dass bereits die Priester der alten Griechen eine Inter-netverbindung zu ihren Göttern benutzten. Gewissermaßen ein göttliches Priester-Internet mit einem für alle Götter gleich angelegten Standard, wie bei einem iPad oder e-Phone.
Dieser Standard ermöglichte es ihnen, ihre Sehermethoden zu-fällig und überaus einfach und schnell mit der zu erwartenden Zukunft zu verknüpfen. So teilten sie die möglichen Zufälle den jeweils zuständigen Göttern mit.
Die ebenfalls zufällig von den Göttern mitgeteilten Antworten wurden von den Priestern zu Überschriften zusammengefasst, entsprechend geordnet und später je nach eingetretenem Er-eignis sorgsam wieder in das entsprechende Detail ausgewi-ckelt oder übertragen.
So gelang es ihnen, zukünftige Ereignisse im Nachhinein tref-fend vorauszusagen. Denn im Nachhinein konnte und kann niemand mehr den Verlauf der Geschehnisse ändern.
Sehen Sie, mit dem Zufall ist es wie mit der Freiheit: Beide sind nur in der Zukunft denkbar, in der Gegenwart nur noch ein Traum, in der Vergangenheit bereits festgezurrt und unab-änderlich, also nicht mehr existent.
Das war meine erste Lehrstunde auf meiner langen Wande-rung. Es war meine erste Begegnung mit Göttern, Priestern und Heiligen.
Ich traf sie nicht nur in Griechenland und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch mit Handy und Smartphone.
Hier ist eine solche Erzählung, die mir ein knorriger, bärtiger Mann mit langen, weit in den Nacken reichenden Haaren und einem die Damen erregenden Parfümduft in einem Café direkt unter der linken Seite der Karlsbrücke in Prag zuflüsterte.
Auf der Karlsbrücke
„Es ist ein Geheimnis um die Heiligen. Es waren Menschen, die sich aus dem Gedränge des Lebens erhoben und ihre Ge-genwart auf Erden für ihre Zukunft im Jenseits und für die geistigen Welten der Menschheit opferten.
Wie soll es nur weitergehen auf Erden und auch im Himmel, wenn schon so viele Erdenbürger auf Reisen anzutreffen sind, auf Reisen, die sie aus reinem Vergnügen oder vielleicht sogar noch schlimmer, aus Herdenneugier, ja, ich sage Herdenneu-gier, und nicht aus Gründen einer Not oder des Überlebens unternehmen. Ich kann mich da nicht vollständig ausschließen.
Sehen Sie sich doch nur die Menschenmassen an, die sich auf unserer weltbekannten Brücke jetzt, im Herbst, hier in unserer berühmten Stadt drängeln und eigentlich nicht wissen, warum sie über diese Brücke sich schieben lassen sollen oder gar müs-sen.
Wissen Sie darauf eine Antwort, Sie, der Sie ja auch nicht zu uns, den Prager Bürgern, gehören? Sie halten sich doch auch nur für einige Tage bei uns auf, oder?“, fragte mich mein Nachbar an unserem gemeinsamen Cafétisch, an den mich ei-ne freundliche Bedienung auf Nachfrage hin hatte setzen las-sen.
Er war von kräftiger Statur, im Gesicht, im Nacken und an den Armen braungebrannt, und trug lange, in den Nacken ge-kämmte Haare. Ein regelrechter Wildbärenschnurrbart be-deckte die untere Hälfte seines mit tiefen Furchen gezeichne-ten Gesichtes. Frisch getrunkener Kaffee tropfte von den En-den seines grau-bräunlichen Bartes. Sie erinnerten mich an Wassertropfen, die nach dem Trinken eines Hundes aus den Schnauzfalten herausfallen, gewissermaßen das Zeugnis eines schmackhaften Tranks. Ein Straßenhund, so eine Mischung aus Terrier und Schäferhund, saß friedlich und dösend zu sei-nen Füßen.
Ich war nicht in einer sonderlich guten oder aufgemunterten Stimmung. Die Menschenmassen, die in wenigen Metern Ab-stand von unserem halb tief und seitlich unter der Brücke ge-legenen Café herumwoben, waren mir unheimlich. Dazu die grauen Zeugen aus der Vergangenheit, die Heiligenstatuen, die sich unberührt und steinern das sich über die Brücke quälende Leben ansahen.
Aufgrund der so entgegenkommenden Bereitschaft, mit mir, einem Fremden und Ausländer, seinen Tisch in dem dicht be-setzten Café zu teilen, fühlte ich mich verpflichtet, dem von ihm gewünschten Beginn einer Konservation zuzustimmen und auf seine freundliche, der allgemeinen Stimmung der Stadt entsprechende und gedrängt tief reichende Frage zu antwor-ten.
Bevor ich aber etwas sagen konnte, hörte ich aus dem Ge-dränge die junge Stimme einer Frau, die offensichtlich mit ih-rem Handy, genauer gesagt, ihrem Smartphone gespielt und nun ihren Freund in dem Gedränge verloren hatte: „Stephan, wo bist du? Ich bin schon auf der Brücke, in Richtung auf die Burg. Soll ich weitergehen oder auf dich warten? Melde dich bitte. Ich warte.“
Immer wieder von vorbeigleitenden Menschen verdeckt, er-spähte ich am Geländer eine nervös und unsicher um sich bli-ckende, mit blauen Jeanshosen und einer einfarbigen hellgel-ben Bluse bekleidete Frau, mit langen blonden, weit zurückge-kämmten, im Wind leicht flatternden Haaren.
Was sollte ich meinem zukünftigen Gesprächspartner, er hatte ja gerade erst kurz zuvor mit seiner Frage eine vielleicht tief reichende und Sinn gebende Diskussion eröffnet, in Zusam-menhang mit dem jetzigen, die Gegenwart ausfüllenden Gedränge und der verunsichert gestellten Frage einer wahrschein-lich zufällig in den Menschenmassen treibenden jungen Frau antworten?
Ich sah ihn nachdenklich, sprunghaft über seine Kleidung glei-tend einige Sekunden an, die mir wie eine von den steinernen Heiligen gewährte Zuflucht erschienen.
„Tage sind wie Sekunden und Sekunden können wie ein langes Leben sein, wenn man im schiebenden Gedränge auf einer Brücke wartet. Wartet auf den vertrauten Partner, der sich ver-loren hat, der nicht kommen will oder kann, dem die Brücke zu heilig oder zu steinern, zu rau oder zu glatt, zu lang oder zu eng, zu bewegt oder zu leblos ist.“
„Ich sehe, Sie sind ein Fremder. Nicht geboren und nicht auf-gewachsen in dieser Stadt.“
„Ja, das stimmt“, antwortete ich schon schneller. „Aber in der Stadt, in der ich lebe, gibt es auch eine steinerne, alte Brücke. Vielleicht sogar älter als die Karlsbrücke.“
„Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, eine Ge-schichte von, nein nicht von, eine Geschichte über die, nein, nicht über die, sondern über der Brücke.
Sie hat sich, wie alles hier in dieser goldenen Stadt, niemals zu-getragen. Sie ist aber dennoch wahr.
All das liegt über unserer Brücke: Die Gegenwart mag lustig oder grausam, voll von Gedanken oder sinnlos, voller Men-schen oder ausgeblutet, fragend oder wissend sein.
Die Zukunft aber wird durch die steinernen Vermittler der Vorfahren, die von ihren Mitmenschen grausam misshandelt wurden und deren Gedanken in unserer Gegenwart nur ver-stümmelt bekannt sind, sicher morgen gerichtet werden.
Gestern noch sahen wir uns den Teufeln ausgesetzt und heute, jetzt, zu dieser Zeit, denken wir darüber nach, ob wir es noch sind.“
„Das sind mir nicht ganz verständliche Aussagen: Was meinen Sie mit gerichtet? Gerichtet wie alles im Jenseits, wenn wir für unsere bösen oder guten Taten beurteilt werden?
Oder meinen Sie, dass hier, über der Brücke, durch die stei-nernen Vermittler zum Glauben und zu dem christlichen Gott eine Richtung vorgegeben wird?
Eine Richtung nach oben, der Sonne, den Wolken zu? In den Himmel, den wir als Christ aus der heiligen Schrift kennen, der aber bei vielen von uns gar nicht existiert?“, fragte ich verunsi-chert.
„Ich habe beides gemeint“, sagte mein Cafétischpartner sanft lächelnd.
„Sie beginnen, die Brücke da oben zu verstehen. Aber lassen Sie mich bitte eine vergangene, noch in unsere Gegenwart hin-einreichende Geschichte erzählen.“
Er trank einen kleinen Schluck von seinem schwarzen, mit Zucker veredelten Kaffee, wischte sich mit seiner linken Hand die an seinem wildbärenhaften Bart hängen gebliebenen Trop-fen ab, lehnte sich sorgsam zurück, legte beide Hände mit den Handflächen nach unten auf den Tisch, schaute noch einmal kurz auf seinen friedlich vor sich hindösenden Hund und be-gann feierlich wie bei einer Predigt:
„Also, ich berichte aus der Gegenwart, aus dem Jetzt, aus dem Eben, das wir vor wenigen Minuten erlebt haben. Sie haben si-cher auch die rufende Frage der jungen Frau auf der Brücke nach ihrem Freund gehört. Ich kenne sie. Sie ist eine Schülerin von mir. Sie hat sich mit der Geschichte dieser Brücke wissen-schaftlich auseinandergesetzt.“
Ich schaute ihn verwundert an und unterbrach: „Sie kennen diese suchende und rufende Frau? Als Schülerin? Verzeihung, aber ich glaube Ihnen kein Wort. Mit einem wildbärenhaften Bart wie dem Ihrigen hat man keine suchende und in ihr Handy fragende Schülerin: Man hat eine Geliebte oder der Bart ist völlig nutzlos!“
„Sie haben Recht, aber unterbrechen Sie mich bitte nicht! Was verstehen Sie, der Sie überhaupt keinen Bart zur Schau stellen, von einem Wildbärenbart tragenden Mann? Wenn Sie denn nun überhaupt ein Mann sind …“
„Nun, ich denke, dass ich da über genügend Erfahrungen ver-füge …“, versuchte ich mich zu rechtfertigen.
„Quatsch! Ob Sie irgendwelche Erfahrungen bei Frauen haben oder gar Kinder gezeugt haben, das ist noch lange kein Man-neszeichen! Dazu gehört eben mehr, zum Beispiel ein wildbä-renhafter Bart, der an den geeigneten Stellen kitzelt, aus Ab-scheu Interesse und Begehrlichkeiten erweckt und zu allem Möglichen geeignet ist.
Aber bitte, unterbrechen Sie mich nicht, sonst bleibt Ihnen der Sinn meiner Geschichte für immer verborgen und unerklärlich, obwohl ich Ihnen alles in einem einfachen Zusammenhang darstellen werde.“
„Wie bei Kafka“, dachte ich, wagte es aber nicht, meine Be-denken laut zu äußern.
„Also, da Sie mich nicht mehr unterbrochen haben, obwohl es Ihnen unter der Nase juckte, mir Kafka in meinen wildbären-haften Bart zu flechten, werde ich jetzt fortfahren“, meinte er gönnerhaft.
„Bevor wir uns den Statuen, insbesondere der des heiligen Jan Nepomuk zuwenden, sehen wir uns die Statuen genauer an. Am besten, wir beginnen unsere Geschichte mit dem geheim-nisvollen Sterndeuter, auf dessen Rat der Brückenbau in der höllischen Zeit um fünf Uhr früh am neunten oder dem fünf-zehnten Tag des Monats Juli im Jahre des Herrn 1357 begann.
Und das kam so: Der Kaiser Karl der vierte, der Wenzel, war ein gläubiger Christ. Er ließ diese Brücke bauen. Nicht weil er ein Christ war, sondern weil ihn zeit seines Lebens die Pest schockierte, die er wiederum fürchtete wie die Pest.
Schon seine Krönung in Aachen musste er wegen der Pest um einige Tage verschieben. Das war nicht nur ärgerlich, das be-deutete auch einen Verlust an Macht und Ansehen. Nicht so sehr bei seinen Untertanen und Fürsten, sondern vielmehr, und davon war er überzeugt, bei seinem Herrn Jesus Christus im Himmel.
Er brauchte dringend Vermittler und Diplomaten, die sein Verhalten den himmlischen Machthabern erklären und sicher-stellen konnten, dass alles in einer von ihm persönlich gestalte-ten Sichtweise angehört und gebilligt werden würde.
Die Zeit drängte, denn die alte Brücke war durch ein Hoch-wasser zerstört worden. Er schickte Suchtrupps in die von ihm beherrschten Ländereien mit dem Auftrag, nach geeigneten Vermittlern zu den himmlischen Gefilden zu suchen. Leider vergeblich, denn die bekannten Heiligen waren alle als Märty-rer umgebracht worden und auch die neu herandrängende Heiligengeneration war dem schwarzen Tod entweder schon geweiht oder bereits erlegen.
Denn diese hatten aufopferungsvoll und voller Vertrauen auf die Güte des Himmels die Schwerkranken gepflegt und waren für ihre uneigennützige Hilfe mit einem sehr kurzen Leben be-lohnt worden. Eine derartig himmlische Belohnung wollte Kaiser Karl aber auf jeden Fall vermeiden.“
Ich hörte gespannt zu: „Also entschied er sich für den Teufel oder zumindest für einen teuflischen Rat?“, unterbrach ich den wildbärenbärtigen Erzähler.
„Ja, so ist, nein, genau, so war es! Aber bitte, bei aller Aufre-gung, unterbrechen Sie mich nicht! Jetzt nämlich kommt es!“, sagte er streng.
„Wie gesagt, Kaiser Karl war in Zeitnot; eine neue Brücke musste gebaut werden und teuflischer Rat war nötig.
Er wollte es sich aber auch nicht mit den himmlischen Heer-scharen verderben. Denn er wusste genau, auf die Dauer hat der Teufel gegen den Himmel keine Chance: Das wissen Sie genau so gut wie jeder Kinobesucher: Am Ende gewinnt im-mer das Gute. Das nur so nebenbei.
Um ihm aus seiner Not zu helfen, und es war ja der Kaiser, der mächtigste Mann im damaligen tschechischen, zugegeben tschechisch-deutschen Reich, der gläubig um himmlischen Rat ersuchte, also zu diesem aufopferungsvollen, weil auch den Teufel um Rat bittenden, mächtigsten Mann der Christenheit schickte der himmlische Herrscher, oder auch der Teufel, oder es schickten ihm beide in einer geheimen Absprache den in Italien lebenden, berühmten Astrologen Tempovido.