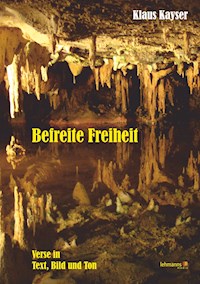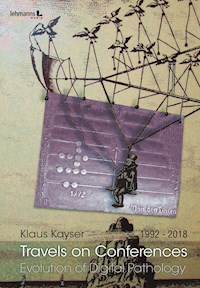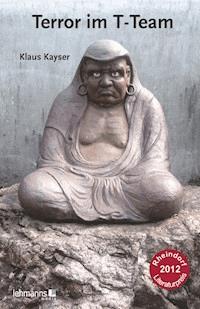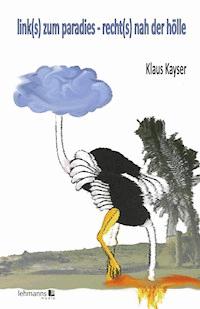
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lehmanns
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwanzig farbenfrohe und humorvolle Erzählungen, von denen einige durch Literaturpreise ausgezeichnet wurden, sind formal aneinander gekettet durch kurze Überleitungen, die das geschilderte Farbspektrum erläutern und beleuchten. Sie führen in eine Lesewelt, die je nach Betrachtung als Roman oder eine Sammlung separater, individueller Kurzgeschichten interpretiert werden kann. Sie behandeln Fragen nach Wissen und Glauben, Mitleid und Folter ebenso wie aktuelle Veränderungen bei uns Menschen in Gesellschaft und Umwelt, Vergangenheit und Zukunft, Moral und Politik in fröhlicher, spannender oder tragischer Darstellung. Hierbei werden historische brutale und unmenschliche Vertreibungen (Gedächtnis der Steine, Das Geheimnis des Sevansees) ebenso geschildert wie aktuelle Flüchtlingsfragen (Ein Strandurlaub, Die Vertreibung des Oso radicular, Das Verbrechen der Existenz), soziale Verhaltensweisen (Die Demut des Siegers, Mohammad Kohlhaas, Der Sitzplatz der Emma Friedberg) oder technologische Entwicklungen und deren Folgen (Noahs Testament, Der Drohnenflüsterer, Die unüberbrückbare Brücke zum Paradies). Dieses Buch erweckt Freude am Lesen, verbindet humorvolle Geschichten mit Nachdenken über Zufall und Verantwortung, vermittelt Verständnis für menschliche Verhaltensweisen bei Sieg und Niederlage, Recht und Unrecht, Pech und Glück, Isolation und Kommunikation. So wird erzählt: „In unserem Innersten sind wir zu allem fähig. Davon kann die Natur, unser aller Schöpfer, noch lernen. Er muss nur die richtige Verbindung einrichten“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
link(s) zum paradies-recht(s) zur hölle
Klaus Kayser
Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek: Die deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© 2016 Lehmanns Media Verlag
Helmholtzstraße 2-9 • 10587 Berlin
www.lehmanns.de
Korrektorat: Marianne Günther
Umschlagbild: PD Dr. Gian Kayser
ISBN 978-3-86541-894-4
Für Charlotte, Christina, Johannes, Julia, Theresa,
sowie Corinna, Gian, Claudia, Maria-Consuelo und Martin
Der Autor
Klaus Kayser, Dr. med. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult.
Professor für Pathologie und Epidemiologie an den Universitäten Heidelberg und Berlin. 1940 in Berlin geboren, Studium der Physik und Medizin in Göttingen und Heidelberg, lebt seit 1970 in Heidelberg
Neben mehreren Fachbüchern schrieb der Autor humorvolle und kritische Bücher:
Zeitgedanken und Spiegeldenken, Rendezvous, Baden-Baden, 2000;
Der Tod eines Körperspenders, Lehmanns Media, Berlin, 2005;
Terror im T-Team, Lehmanns Media, Berlin, 2012, Rheindorf Literaturpreis;
Restrisiko oder die heiligen Kühe der Nation, Lehmanns Media, Berlin, 2013;
Erlebtes Erleben, Ein Gedichtporträt, Lehmanns Media, Berlin, 2016;
Zu der ersten Erzählung
„Tief ist der Brunnen des Gedächtnisses. Wir schöpfen aus ihm und füllen ihn tagtäglich wieder auf.“
So sprach vor einigen Jahren, als ich mich nach einer längeren Wanderung auf eine weit in das vor uns gelegene Tal, den Ambergau, schauende Bank am Hainberg, im Vorharzgebirge, zu einem ergrauten, mit einem Wanderstock bewaffneten knorrigen Mann gesetzt hatte, dieser zu mir. Freundlich hatte ich um seine Zustimmung gebeten, mich neben ihm ausruhen zu dürfen. Er nickte leicht, schien dann aus einer von seiner Wanderung getragenen inneren Einsamkeit zu erwachen. „‚Tief ist der Brunnen der Vergangenheit„, so sagt Thomas Mann“, ergänzte ich. „Und: ‚Steinig ist der Weg in das Licht„.“
Er schaute mich kurz mit seinen tiefblauen Augen an und
meinte: „Ja, ja. Steine sind die Erinnerung an uns Menschen,
an längst von der Ewigkeit verschluckte Lebewesen, an wütende, jetzt in Frieden geglättete Naturkatastrophen, an das Feuer in der Erde. Sie überleben das Leben und weisen dem, der ihre
Sprache versteht, den Weg in die Zukunft.“ „Steine sind grausam. Sie töten und lassen Menschen verhungern. Sie schmiegen sich nicht, wie die sanfte Erde, um die Tritte der Bauern. Sie verbergen sich unter schäumenden Wellen und lassen Schiffe zerbrechen. Sie täuschen freie Sicht und ein himmlisches Gefühl der Freiheit, der Brüderlichkeit in das Auge des Wanderers und stürzen ihn, wenn er auch nur einen Augenblick unvorsichtig ihrer Verführung folgt, tief hinab in den Abgrund. Sie speichern alles in ihrem Gedächtnis“, versuchte ich, meine zugegeben skeptische Vorstellung über Steine, ihr Wesen und ihre Beziehung zu uns Menschen darzulegen.
„Dort, wo die Steine übermächtig sind, wo sie Himmel und Erde beherrschen, dort erzählen sie auch von dem Leid der Menschen, die über ihnen ihr kärgliches Leben gefristet haben“, fuhr ich fort.
„So? Ich habe mich bei meinen Wanderungen immer an den Steinen erfreut, immer in ihnen Brüder und treue Freunde gesehen. Viele farbige Steine habe ich entdecken können, so manchen aufgehoben und gesammelt. Sie sind mein Gedächtnis. Aber, wo ist denn das Land der Steine?“, fragte er interessiert.
„Es liegt, wohl kein Zufall, in dem uralten Christenland, Armenien. Dort hat mir ein Freund auf seiner Reise berichtet:
‚Im Land der Steine,
der Steine Land, gesegnet ich meine,
meine Seele ich fand“, sagte ich zu ihm.
„Hm, um meine Seele zu finden, brauche ich nicht in das Land der Steine zu reisen. Ich habe sie hier, auf meiner Wanderung durch den Hainberg vor Jahren, als es noch keine Autobahn und Wilderer gab, nach Kräften behütet und nach ihrem Gedächtnis geforscht“, erklärte er mir gutmütig.
Ich sah ihn, den alten, knorrigen Wanderer in seinen Erinnerungen kramen. Ein flüchtiges Lächeln strich über seine Lippen. Sicher dachte er an seine Familie, seine Kinder, seine Jagdhunde, an Pirschen durch sein jetzt von Autobahn und Wilderern verunstaltetes Revier, an seine nur ihm eigene glückliche Vergangenheit.
‚Steine sind die Brüder unserer Vergangenheit', dachte ich. ‚Sie liegen schwer im Herzen, glänzen im Mondlicht einer lieblichen Nacht, tanzen auf dem Wasser der Gegenwart, wie man sie als Kind mit Schwung und Eleganz auf den leichten Wellen eines Flusses oder Sees hüpfen ließ. Sie sind die Anker von Verstorbenen in das Leben, sichtbar und fest verzurrt auf jedem Friedhof.„
Ich räusperte mich.
„Hm, Steine sind Brüder, ja, sie sind wirklich Brüder, von uns Menschen. Sie lieben uns Menschen in ihrem Gedächtnis, begleiten uns auf unseren Wanderungen. Ich darf Ihnen sagen ..., ach, bitte, hören Sie einfach zu.“
Das Gedächtnis der Steine
„Steine sind Brüder, die sich gleichen und ein Gedächtnis besitzen. Erst der Mensch erzeugt ihre Unterschiede“, erklärte mir ein bartumwobener ergrauter Mann jenseits der Lebens-wende.
So sprach auch Großvater Yervand Tehliryan zu seinem Enkel Soghomon.
Auf meine und Soghomons Frage:
„Wie kann ein lebloses Ding, ein Stein, der weder hören noch sehen oder gar denken kann, ein Gedächtnis besitzen?“, erklärte Yervand seinem Enkel und mir schmunzelnd der bärtige Mann:
„Man muss stets Denken und Fühlen trennen von dem, was man zum Denken oder Fühlen benötigt, dann besitzt jedes Ding in und um uns herum ein Gedächtnis.“
„Alles um mich herum hat ein Gedächtnis? Auch mein Glas Bier hier auf dem Tisch oder der Schnaps in Ihrem Glas?“, schmunzelte ich zurück, und Soghomon fragte: „Großvater, du und ich haben ein Gedächtnis, aber Steine können doch gar kein Gedächtnis haben?!“
„Soghomon, bitte schenk mir Cognac ein. Was spielen wir? Pachisi oder armenische Mühle?“
Yervand trank einen gewaltigen Schluck von dem Cognac, nahm den Pachisistein in die rechte und einen Mühlestein in die linke Hand.
„Welche Hand wählst du? Dann erkläre ich dir, wie das Gedächtnis der Steine funktioniert.“
„Ich berichte Ihnen eine wahre und dokumentierte Geschichte, wenn Sie mir noch einen Schnaps spendieren. Sie ist der unbestreitbare Beweis, dass und wie ein Steingedächtnis im Prinzip funktioniert. Wenn etwas funktioniert, dann muss es im Prinzip auch existieren, nicht wahr?“
Ich nickte interessiert und, ganz gegen meine sonstige Gepflogenheit, spendabel.
„Am besten erzähle ich Ihnen die Geschichte der drei Brüdersteine, die durch ihr verwandtes Schicksal und ihr Gedächtnis gewiss als Brüder zu bezeichnen sind. Ihre gleichförmig verlaufende Gedächtnisspur ist gewissermaßen der genetische Fingerabdruck, der sie trotz aller zeitlichen und räumlichen Unterschiede als Verwandte, als Brüder zuordnet.
Die drei Brüdersteine sind von Meisterhand aus unterschiedlichem Gestein geformt worden.
Der erste Bruder, genannt Mühlestein, ist ein münzenartig geschnitzter Obsidian, schwarz, wie er zu Brettspielen, Mühle, Backgammon oder zum Ritterspiel bei den Armeniern benutzt wird.
Der zweite Bruder ist aus Malachit, dunkelgrün mit schwarzen Adern und in Form eines abstrakten Soldaten gestaltet. Er heißt Pachisistein.
Der dritte Stein ist der größte, zeigt in weißem Marmor ein springendes Pferd und entstammt einem persischen Schachspiel.“
„Wir spielen Mühle, einverstanden? Du nimmst die schwarzen Obsidiansteine. Den grünen Pachisistein behalte ich in meiner Hand. Das spielen wir, zur Entspannung, danach“, bestimmte Yervand.
„Hören Sie mir genau zu und formen Sie Ihr Gehirn. Ich werde Ihnen die Geschichte von dem Gedächtnis der Steine nur einmal erzählen“, erklärte mir der Alte, und dann folgte seine Geschichte:
Zu dem Spiel kam es nicht.
Denn an diesem ruhigen Sonntag im Mai des Jahres 1915, an dem Großvater Yervand Tehliryan mit seinem Enkel Soghomon in dem kleinen armenischen Dorf Pakaritsch, wenige Kilometer von Erzincan entfernt, armenische Mühle spielen wollte, wütete ein bitteres, die Familie vernichtendes Unglück.
Die Mutter kochte in der Küche, der ältere Bruder wollte zu Besuch kommen, um mit dem Vater, der ein wohlhabender Kaufmann war, die unheilvollen drohenden Wolken von Vertreibung und Tod zu besprechen.
Soghomon hatte einen Mühlestein ergriffen, um seinen Großvater mit einem Geniestreich zu bedrängen, als ein hochgewachsener türkischer Offizier seine Soldaten vor dem Haus in Stellung brachte, die Haustür aufriss und mit harter Stimme den Tehliryans befahl, das Haus auf der Stelle zu verlassen und ihnen zu folgen.
Großvater meinte noch: „Soghomon, behalte und verstecke den Pachisi-und den Mühlestein. Sie werden dir dein Gedächtnis sein.“
Dann erhob er sich würdevoll und trat vor die Tür. Soghomon versteckte sich hinter dem schweren Sessel, auf dem der Großvater gesessen hatte. Die Soldaten übersahen ihn. Die Ankunft des Bruders, der ebenfalls abgeführt wurde, hatte sie abgelenkt.
Soghomon stahl sich aus dem Haus, suchte in den Bergen Schutz bei Kurden und floh nach Tiflis in Georgien.
Vater, Mutter, Großvater und die weiteren Familienmitglieder wurden gequält, vergewaltigt, ermordet. Ihre Leichen vermoderten ausgedörrt wie Kamelkot im Wüstensand.
Die beiden Steine, der schwarze Mühlestein und der grüne Pachisistein waren Soghomons Zeugen der furchtbaren Ereignisse in seiner Kindheit, waren Grundlage und Gedächtnis seiner Erinnerung.
Später, im Jahr 1943, fanden sie ihren Bruder, den Springerstein.
Und das geschah so:
Fern von Tiflis, in Berlin, in der Albrechtstraße, lebte die junge Jüdin Esther Weinstein. Sie war ausgesprochen attraktiv, oder, wie man heute sagt, sexy, und verlobt mit dem angehenden, zum Militär eingezogenen, an die Ostfront abkommandierten rein arischen Juristen und Ritterkreuzträger Werner Lüchow.
Ihre Eltern waren von der Gestapo verhaftet und in Buchenwald ermordet worden; sie selbst blieb bisher wegen der militärischen Verdienste ihres Verlobten und dessen Beziehungen verschont.
Sie und ihre bereits verwitwete Freundin Lucie Ritter waren begeisterte Schachspielerinnen. Sie trafen sich regelmäßig in Esthers Wohnung zu Spiel und Muckefuck, dem Kaffeeersatz.
Esther hatte soeben ihren weißen Springer ergriffen, um dem schwarzen König Schach zu bieten, als es heftig an der Wohnungstür klopfte. Zwei Männer in schwarzen Ledermänteln forderten barsch: „Wir müssen Frau Esther Weinstein festnehmen und auf die Wache bringen.“
Lucie sagte zu Esther: „Ich gehe. Mir werden Sie nichts tun. Versteck dich im Bad und lauf sofort zu meiner Wohnung, wenn die Luft rein ist.“
Sie stand auf, gab Esther ihren Wohnungsschlüssel, rief kurz: „Ich komme!“, zog ihren Mantel an und folgte den Männern.
Nach stundenlangen Verhören, bei denen Lucie einwandfrei beweisen konnte, dass sie rein arischen Blutes, dass ihr ebenfalls arischer Ehemann an der Westfront gefallen war, wurde sie in ihre Wohnung entlassen, die sie mit ihrer ebenfalls verwitweten Schwester Gertrud Krüger teilte.
Dorthin war Esther überhastet mit einigen in der Eile zusammengerafften Kleidungsstücken, dem wichtigsten Schmuck und dem Schachstein, den sie unbewusst in ihre Handtasche gesteckt hatte, geflüchtet.
Es gelang den beiden Schwestern, Esther versteckt zu halten und durchzufüttern, bis die braunen Ungeheuer aus Berlin vertrieben wurden und ein russischer Offizier in die Wohnung der beiden Schwestern Einlass begehrte.
Der Offizier hieß Soghomon Tehliryan. Er war mit zahlreichen Orden dekoriert und gehörte einer Spezialeinheit zur Fahndung nach Fahnenflüchtigen und Kriegsverbrechern an
…
„Bei dieser Begehung fanden die drei Brüdersteine zusammen, und ich kann somit die Behauptung über das Gedächtnis der Steine und seine Vergänglichkeit beweisen“, unterbrach der alte Mann seine Erzählung
Die beiden Schwestern hatten ein uraltes, dem Pachisi-Spiel nachempfundenes „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel auf dem Jahrmarkt erworben. Sie spielten es oft, auch zu dem Zeitpunkt, als Soghomon Tehliryan die Wohnung betrat. Es beruhigte sie und war Grundlage ausführlicher Diskussionen über die ungewisse Zukunft.
Angstvoll standen die Frauen vor Soghomon, der über die kunstvoll geschnitzten Biedermeier Möbel und die mit grünem Samt überzogenen Stühle staunte. Dann fiel sein Blick auf das „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel.
„Woher du haben Pachisi-Spiel?“, fragte er barsch.
„Wir haben es gekauft. Auf dem Basar. Vor ungefähr einem Jahr“, sagte Lucie.
„Du zeigen Steine. Wieviel grün?“
„Nur drei. Ein Stein fehlt. Wir haben ihn durch diesen Knopf ersetzt“, erklärte Lucie und zeigte dem Offizier die drei Steine.
Soghomon, das bedeutet übersetzt Salomon, nahm die drei Steine in seine Hand, legte sie erregt auf den Tisch, griff in die Innentasche seiner Uniform und legte die zwei Brüdersteine, den Mühlestein und seinen Pachisistein zu den drei Steinen.
„Du sehen, jetzt vier Pachisisteine und zwei Brüdersteine, Mühle und Pachisi. Steine immer sein gleich. Menschen machen Unterschied zwischen Stein: großer Stein, teurer Stein, schöner Stein, wichtiger Stein, lustiger Stein. Mein Pachisistein sein trauriger Stein.“
Lucie und ihre Schwester hörten erstaunt zu. Sie verstanden kein Wort. Esther aber nahm sich ein Herz und fragte: „Sie sagen, Ihr Pachisistein sei ein trauriger Stein? Warum?“
„Weil er haben ansehen müssen und haben im Gedächtnis Vertreibung und Tod meiner Familie“, sagte Soghomon bitter.
In einem Anflug von Mitleid und Trauer ging Esther einen Schritt auf Soghomon zu, der verunsichert nach seiner Pistole griff.
Sie tröstete: „Du und deine Brüdersteine sind nicht allein. Hier, sieh, ich habe einen dritten Bruderstein, den Springerstein. Er gedenkt der Ermordung meiner Familie.“
Sie griff zu ihrer Handtasche und legte den marmornen Springerstein zu den übrigen Steinen.
Lucie, die fröhliche und lebensfrohe Schwester, sah Soghomons Betroffenheit, so, als habe er ein Fehlurteil gesprochen.
„Kommt, Kinder, wir feiern das Zusammentreffen der Brüdersteine! Ich habe da noch einen guten Cognac aus der Vorkriegszeit.“ Sie griff nach den Steinen, vorsichtig, aber kraftvoll, und legte sie auf die eckständige Schreibtischkommode.
Dann ging sie beherzt zu Soghomon, nahm seinen Arm und sagte: „Willkommen. Jetzt vergessen wir das Gedächtnis der Steine, feiern und freuen uns auf das Morgen.“
„Ich werden besorgen Kaviar und Wodka“, versprach Soghomon
...„Da war viel Freude unter diesen Menschen. Das Gedächtnis der Steine verdunstete bei Cognac und Wodka in der anrückenden Zukunft. Es wurde Vergangenheit. Wie das Leben der Menschen“, sagte der ergraute Mann jenseits der Lebenswende zu mir, und abschließend:
„Ich muss noch richtigstellen: Soghomon Tehliryan ist nicht zu verwechseln mit Salomon Tehlirian, der seine gesamte Familie durch den Genozid verlor und der am 15. März 1921 in Berlin den für diese Ereignisse mitverantwortlichen ehemaligen türkischen Minister Talat Pascha erschoss.“
Zu der zweiten Erzählung
Südtirol sei ebenfalls ein Land der Steine?
Nein, sicher nicht! Wäre dem so, dann hätten sich die zahlreichen Rentnertouristen, die im Herbst die noch im Verglühen wärmende Sonne genießen, die sich mit Höckerschuhen auf leichten Wanderwegen zum nächstgelegenen Café hinabtapsen und am Abend den lieblichen Kalterersee Wein zum Begrünen ihrer verdämmernden Gemütsstimmung trinken, schon längst in andere liebliche Urlaubsregionen verzogen.
Nein, Südtirol ist ein Land der Berggipfel, Steilfelsen, grünen Almen und breiten Täler, an deren Hängen Wein und gepflegte Apfelbäume ihre Früchte reifen lassen. Es ist ein Land am Ende des Nordens und am Anfang des Südens. Hier vermählen sich Kälte und Wärme so wie der Mond und die Sonne: stets voneinander getrennt, aber immer vereint und auf sich wartend.
„Die Freiheit ist unser Reich, unser Begehren, unser Leben und unsere Kraft“, sagte mir ein junger Skifahrer, der mit einem Snowboard in teuflisch wilder Fahrt die Piste hinunterraste.
„Hier auf der Seiser Alm ist die Freiheit so groß wie ein stampfender, vor seinen Feinden fliehender Elefant in der Steppe: Er kann frei seine Wege wählen, nichts kann ihn aufhalten, niemand kann ihn sehen, aber das zertrampelte Gras auf seinem Weg ist wie eine Schlange um seinen Hals, die ihn umbringt.“
„Das verstehe ich nicht. Hier, auf euren Almen, in euren Tälern, von euren in den Himmel ragenden Berggipfeln haben eure Helden ihre Freiheit, ihre Sprache, ihre Frauen, Töchter und Söhne verteidigt, immer wieder und, na ja, nicht immer erfolgreich, aber immerhin mit eindrucksvollen Kompromissen“, sagte ich ihm und versuchte, meine Geschichtskenntnisse zu ordnen.
„Unsere Freiheit ist wie ein Elefant, der auf seinen Brettern die Piste hinunterrast, schnell und unaufhaltsam, völlig frei kann er nach links oder rechts wedeln. Aber immer muss er hinab zum endgültigen Ziel im Tal, dem Ende aller Pisten!
Wir wissen, die Freiheit zu verteidigen. Wir wissen, wohin sie führt! Das macht uns friedlich und kompromissbereit. Denn das Ziel liegt für alle gleich am Ende der Piste, wer immer sie gefahren ist.“
„Wieso? Die Freiheit ist doch die Fahrt hinab! Dass man sie überhaupt antreten kann! Dass niemand sagen kann: ‚Stopp, du da! Du hast hier nichts zu suchen! Lauf gefälligst zu Fuß!“, versuchte ich zu widersprechen.
Der junge Kerl lachte nur: „So einfach ist die Welt nun doch nicht! Um hinab zu fahren, muss man eine präparierte Piste haben. Die muss gegen alle Wetter der Natur geschaffen, gepflegt und erhalten werden. Erst dann kommt die Freiheit, sie benutzen zu können. Will sagen, die Bahnen der Freiheit müssen vor Chaos und Gewalt, auch vor den Mächten der Natur, gleich ob pflanzlicher, tierischer, menschlicher oder gar göttlicher Natur, geschützt und gesichert werden! Sonst ist es um die Freiheit geschehen. Sonst steigt das Ziel, das unausweichlich am Ende einer jeden Pistenfahrt erreicht werden muss, die Piste hinauf und sucht sich selbst den Elefanten, den hinabrasenden Snowboarder, den die Piste sichernden Freiheitshelden.“
„Der dann in Blut und Trümmer versinkt. Ein tapferer Soldat, erschossen auf dem befohlenen Vaterlandstrip, ein hirnverbrannter Gotteskrieger auf der rasenden Piste in sein ewiges Paradies. Ein Kindersoldat, geköpft auf der Dorfpiste seines Kameradenfeindes. Ein Söldner der antiken Hannibal-Armee auf der schmalen Elefantenpiste durch die Alpen. Die Mächtigen lassen nur selten ihre gleichzeitig aus der Ewigkeit entronnenen Untertanen bis an das naturbestimmte Ende ihrer Lebenspiste gelangen: Sie versprechen ihnen ein himmlisches Paradies unter der Bedingung, dass sie ihren Lebensweg hier auf Erden risikoreich verkürzen müssen.
Ach, ihr unerkennbar Verstorbenen, ihr mitleidsträchtigen Zeitkameraden, ihr vernunftlosen Nachgeborenen, wie wahr wird eure Lebenspiste berichtet oder geschrieben werden?“
Baragh, Hannibals Elefant
„Das Ereignis, das ich hier erzähle, ist wahr.“ Zumindest sprach so Seppl Meyer, der alte Wanderführer in den Dolomiten. Also ist es wahr.
Seppl Meyer, der sich von Herzen freute, wenn man ihn mit Seppl ansprach und nach den Namen der Berggipfel, nach zu entdeckenden Wildtieren oder nach der Bezeichnung seltener Pflanzen fragte, hatte eine ungefähr zwanzig Touristen umfassende Gruppe auf eine Berghütte zur Brotzeit geführt. Die Almgaststätte lag am Rand einer weit auslaufenden Alm und erlaubte einen freien Blick auf die angrenzende graue Bergkette und hinaufreichenden dichten Wälder.
Seppl Meyer war schon alt. Ich würde ihn auf siebzig Jahre schätzen. Er trug mit seinen grauweißen, kurz geschnittenen Haaren und seinem weißen Bergführervollbart eine grüne Lodenjacke, eine lederne braune Bundhose, bunt gestrickte Wollstrümpfe und feste Bergstiefel. Die meisten Wanderfreunde in seiner kleinen Gruppe waren in einem fortgeschrittenen Lebensalter und entsprechend gekleidet. Sie hatten sich auf bereitgestellte Bänke gesetzt und beim Hüttenwirt zumeist Bier, einige Buttermilch oder Mineralwasser bestellt.
Seppl war in der Führung von Touristen erfahren. Er wusste, dass sie neben dem ausruhenden Erlebnis der Brotzeit, der ergreifenden Aussicht auf die Gipfel der umliegenden Berge und den umherschweifenden Fernglasblicken neues, unbekanntes Wissen erwarteten.
„Seht ihr, da hinten, beim Wald, in der Schotterregion, nahe den steilen Felsen, dort stehen Gemsen. Sie beobachten uns. Sie halten die Verbindung zu den Gemsengöttern, früher, als hier noch Hannibals Elefanten durchzogen, mit lauten Pfiffen, heute, modern, mit Smartphone. Ihr wisst das nicht? Dann muss ich euch etwas wissen lassen, das ihr eigentlich nicht wissen dürft.“
Eine ältliche Wanderdame mit hell-geblondeten Haaren und nagelneuen Wanderschuhen regte sich auf: „Seppl, lassen Sie diese Märchen. Mein alter Mann benötigt kein Wissen mehr. Was er einst wusste, hat er vergessen, und was er bei mir wissen sollte, kann er nicht mehr anwenden!“
„Du, Walter“, wendete sie sich an ihren müde und gebückt vor seinem Bier sitzenden Mann, „du, Walter, geh schon auf die Toilette, dann musst du beim Abstieg nicht so häufig.“
Walter reagierte nicht.
Ein junges Paar, weniger elegant gekleidet, mischte sich ein: „Seppl, ja, wir können die Gamsböcke erkennen. Sieh mal, Felix“, wandte sich eine junge Frau in Jeanshosen an ihren Begleiter, „schau, wie die springen können!“
„Ja, das kann Ihr junger Freund von denen da oben, die Kontakt mit den Himmelengeln haben, wie uns der Seppl eben erzählt hat, noch lernen! Wenn nicht, dann sollte er zu mir kommen!“, reizte die ältliche Dame.
„Ach, zu diesem Springen gehören halt nicht Sie“, antwortete verächtlich die junge Schöne.
„Aber, Seppl, wir sind jung. Wir leben mit Smartphone. Wir wollen wissen. Wie war das mit dem Hannibal? Mit seinen Elefanten?“
Seppl Meyer fühlte sich geschmeichelt: „Das mit den Gemsen und dem Hannibal-Elefanten war nach alter Überlieferung der Bergführer und der Alpenengel so:
Hannibal besaß 37 Elefanten. Sie sollten nach der Überquerung der Alpen die Römer, nun ja, pieksen und so erschrecken, dass sich Hannibal in Italien umsehen und ihnen dort begehrtes Elefantenfutter wie Orangen, Bananen und natürlich Äpfel und Birnen besorgen konnte.
Hannibal bat den Oberelefanten seiner Elefantentruppe zum Rapport:
‚Wir müssen über die Alpen, im Winter, dort wird es kalt und auch für dicke Häute unangenehm. Wir können einen der drei Wege Col de Clapier, Col de Montgenèvre oder Mont Cenis wählen. Welchen der drei Alpenpässe schlägst du vor?
„ Der Oberelefant schüttelte den Rüssel: ‚Du, Hannibal, wenn ich an die Kälte und den Schnee denke, dann graut mir. Ich kann dir den besten Weg nicht sagen. Aber ich habe in der Höhe, dort oben, vierbeinige Geister gesehen, mit zwei Hörnern und pfeifenden Geräuschen. Ich werde die Höhengeister fragen.„
Der Oberelefant trompetete nach den Höhengeistern. Sie pfiffen zurück. Aber ein klarer Weg war für Hannibals Elefanten nicht erkennbar.“
„Da hat halt unser Seppl gefehlt“, scherzte der junge Mann.
„Oder der Gotthardtunnel oder eine asphaltierte Passstraße“, meinte der wissende Mann.
„Oder ein Satellitennavigationssystem“, erklärte die ältliche Frau: „Ich hätte ihn schon navigiert, den Hannibal, nicht wahr, mein Älterchen!“, fügte sie sinnreich hinzu.
„Die Zeiten haben sich geändert“, erklärte Seppl. „Aber, und das steht einwandfrei fest, Hannibals Oberelefant fand dank seiner überragenden Intelligenz den Weg über die Alpen.
Er trompete laut und furchterregend zu den Gemsen hinauf und ließ sie wissen, dass, wenn sie nicht sofort und auf der Stelle den bestgeeigneten Pass auf dem Weg zu dem elefantenliebreichen Italien ihn wissen ließen, auch die hilfreichsten Gemsengötter nichts gegen die Macht der Elefantengötter hier auf Erden, will sagen in den Hochalpen, ausrichten könnten.
Die Gemsen erschraken, schauten in die Tiefe der angedrohten Elefantenhölle und in die Wolken ihrer Gemsengötter.
Siehe da, die Götter zeigten sich gnädig und ließen ihre drohenden Vorboten den Himmel durchkreuzen. Ein Sturm zog auf. Ein fürchterlicher, schneereicher und heulender Sturm, der selbst das kräftigste Trompeten des Oberelefanten übertönte. Das Pfeifen der Gemsen vermischte sich mit schrillen Windgeräuschen.
Dem Oberelefanten dröhnte es in den Ohren. Er stellte seine Ohrlappen quer. Sie wirkten wie Segeltücher in den Sturmgewalten und trieben ihn den Berg und den Pass hinauf.
Trompetend und voller Angst rief er nach seinen Kameraden, die seine Signale in dem Sturmgewitter als ‚hier hinauf„ und ‚folgt mir, hier ist der richtige Pass„ deuteten. So zeigten die Gemsengötter dem Oberelefanten, der danach den Namen ‚Baragh', das heißt der Schnelle, erhielt, und Hannibal den Pass über die Alpen.“
„Das ist eine völlig unglaubliche Geschichte“, wandte die ältliche Dame ein. „So etwas ist erlogen, völlig irre! Aber, welchen Pass hat denn der Oberelefant Baragh vorgeschlagen?“
„Das weiß ich nicht. Ist nur bei den Gemsengöttern zu erfragen. Aber die schweigen. Wirklich so unglaublich?“, fragte Seppl und schaute zum Himmel. Dunkle Wolken zogen auf, schnell und drohend.
„Du, Jakob, was meinst du? Sieh da oben. Ein Wetter zieht auf, oder?“
Der Hüttenwirt war aus dem Haus ins Freie getreten. Er folgte Seppls Blick und meinte ernst: „Ich will euch nicht aus dem Haus weisen. Aber, wenn ihr noch trocken ins Tal kommen wollt, dann müsst ihr euch sputen. Zuvor, bitte, bezahlen.“
Seppl drängte zur Eile. Die Touristen bezahlten und brachen auf. Seppl meinte noch: „So, so. Unglaublich? Jetzt zürnen die Gemsengötter. Sie haben die Frechheit der ältlichen Dame vernommen. Lästerung vertragen sie nicht.“
Ob die Touristen noch trockenen Fußes das Tal erreichten, hat Seppl mir nicht erwähnt.
Zu der dritten Erzählung
Götter und Geheimnisse sind wie Lebewesen, die in Symbiose leben. Sie brauchen einander. Ohne Geheimnisse können Götter nicht überleben. Geheimnisse sind die Gewürze ihrer Speisen, die Wunder ihre wahren Nahrungsquellen.
„Kennen Sie ein Wunder ohne Geheimnis?“, fragte mich eine attraktive junge Frau im Zug von Hamburg nach Hannover. „Wie kann es ein Wunder ohne sein Geheimnis geben? Und, bleibt ein Geheimnis nicht solange ein Wunder, als es verborgen und unerkannt den Geist und das Gefühl der Menschen, besonders von jungen Frauen und Männern, in eine bestimmte Richtung drängt?“
Sie schaute mich auffordernd mit ihrer ausgeworfenen sexuellen Angel an: ein kaum zu verschmähender Leckerbissen, blondes, weit ausladendes Haar, kräftige Brüste, schlanke, zu den Fesseln schmal zulaufende Beine, sinnlich aufregende Körpersprache, besitzergreifend und, das wurde mir klar, erfahren und trainiert, um mit festem Schwung den Fisch am Haken aus seinem Element an Land zu schleudern. Was sollte ich tun?
„Ja, die Liebe ist ein Wunder, ein Geheimnis, ein Göttergeschenk“, war ich bereit, anzubeißen. „Sie ist ein Geheimnis, solange sie im Verborgenen, jung und abenteuerbereit in zwei aufeinander zugehende Herzen dringt, von allem Besitz ergreift, alles schluckt, um ihrem Höhepunkt zu zugleiten.“
„Genau, das haben Sie gut gesagt: dem Höhepunkt zu zugleiten.“ Sie leckte sich über die Lippen, lehnte sich zurück, strich sich sanft über ihre Oberschenkel.
Dann schaute sie, um die knisternde Spannung durch vorgespielte Langeweile zu erhöhen, aus dem Fenster, unterbrach sich aber sofort und rief in echter Überraschung aus: „Da, sehen Sie. Da ist ein Wunder, ein wirkliches Wunder!“
„Was meinen Sie?“ Ich stand von meinem Gangsitz auf und blickte aus dem Fenster.
Was ich da sah, das war in der Tat ein Wunder. Der Zug fuhr entlang einer langgestreckten, leicht ansteigenden, im saftigen Grün stehenden Wiese. Auf dieser Wiese rannten ein Hase und ein Fuchs dicht nebeneinander in Todesangst den Hang hinauf. Ich traute meinen Augen nicht. Sie schauten sich wiederholt kurz an, so, als wollten sie sich vergewissern, dass der Nachbar das Tempo mithalten kann, dann rasten sie weiter, in gleicher Entfernung nebeneinander. Ein keuchender Schäferhund verfolgte die beiden und begann zu jaulen, als sich der Abstand zwischen ihm und den Verfolgten langsam, aber stetig vergrößerte. Dann bog der Zug um eine leichte Kurve. Das Geschehen verschwand aus unserem Sichtbereich.
„Das ist wirklich ein Wunder! Die Tiere müssen ein Geheimnis haben. Sie sind Todfeinde. Kein Fuchs verschmäht einen Hasen, wenn er ihn fangen kann. Und hier? Haben Sie das gesehen? Da laufen die beiden Todfeinde, der Hase und der Fuchs, friedlich nebeneinander über eine Wiese, schauen sich sogar tief in die Augen, so wie Brüder und nicht wie Fressfeinde!“, rief die sexuell so attraktive Frau erregt aus.
„Das ist ein Wunder! Ja, ein göttliches Wunder! Und ein Geheimnis dazu! Ob sich die beiden, der Hase und der Fuchs, bereits kennengelernt hatten, zum Beispiel auf den Raubzügen des Fuchses durch sein Revier? Ob der Fuchs vielleicht einen Verwandten des Hasen bereits verspeist hat?
Sehen Sie“, sagte ich zu der jungen Frau, ich, der ich bereits gefährlich dicht an den Angelhaken des Wunders, der leidenschaftlichen Liebeslust geraten war, „sehen Sie, Angst ändert alles. Angst vor dem dicht heranrasenden Tod fordert den wundertätigen Gott heraus. Er bewirkt das Wunder, das wir eben beobachten konnten, wie aus natürlichen Feinden Brüder werden. Selbstverständlich nur für kurze Zeit und nicht gegen das weiterhin geltende Naturgesetz, aber verbunden mit Geheimnis und der Sehnsucht nach dem ewigen Glück, der immer währenden Liebe, dem Frieden. Leidenschaft verbunden mit ewigem Glück? Ist das nicht auch wider die Natur?“
Es blieb noch eine halbe Stunde Zeit bis zum Fahrtziel Hannover. Das Gespräch verlor sich in Ideal, Vorstellung, Erwartung und Hilfsbereitschaft, verließ die Sphären der körperlichen Liebe, der Leidenschaft, der aufflammenden Erregung, versuchte nur, kurz vor dem Reiseende noch einmal auf den Beginn des glücklichen Erwachens bei Mann und Frau zurückzukehren.
Es war aber kein frischer Beginn mehr. Es war nur ein Schatten früherer Erlebnisse. Ich hatte den Haken nicht geschluckt. Auch das war, so wie ich mich kannte, ein wirkliches Wunder. Es blieb für mich ein Geheimnis, vergleichbar mit den Geheimnissen alt-überlieferter Märchen, deren Geister sich dem Kenntnisreichen in vielen Landschaften zu erkennen geben.
Das Geheimnis der Rapunzelgeister
Es war einmal ein heiterer, wolkenaufgelockerter Sommertag. Das fordernde Aufbrausen des Frühlings war gewichen einer beruhigenden schwachen Brise der kommenden heißen Tage und dem sanften Übergang leuchtender Farben in das satte Grün der Wälder.
Sie kannten sich erst seit drei Tagen. Beide waren nicht mehr tau-grün hinter den Ohren und besaßen den bemerkbaren Umfang an Lebenserfahrung, der sich mit vierzig Jahren in Seele und Körper niederschlägt.
Nicht dass ihre Körperfülle und sein Bauchumfang das amerikanische Durchschnittsmaß übertrafen oder gar ihre Beweglichkeit beeinträchtigten, nein, nur einen kleinen, spitz zulaufenden Nabelberg hatte ihm das Alter eingetragen und ihr, gewissermaßen als Ausgleich zu ihm, einen, insbesondere bei der engen Jeanshose deutlich zutage tretenden, steiß-ähnlichen Po-Anteil.
Dabei waren sie kein fest verbundenes oder endgültig verheiratetes Paar, sondern nur ein durch das unvermutete oder schicksalhaft zufällige Kennenlernen aufeinander zugeleitetes Duett, dem durch unerkennbare, wahrscheinlich überirdische Kräfte aufgetragen war, es „einmal miteinander zu versuchen“.
Beiden war bisher, wie ich an dieser Stelle bemerken muss, ein nahezu gleicher, nur durch das unterschiedliche Geschlecht zu differenzierender Lebensablauf beschieden worden: Beide waren über zehn Jahre verheiratet gewesen und seit mehr als sechs Jahren geschieden. Beide besaßen eine Tochter im erkundungsreichen Teenager-Alter von fünfzehn Jahren, beide lebten in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung in der zwar studentenreichen, aber überaus spießigen Chaotenstadt Göttingen. Beide erwarben ihren Lebensunterhalt als Angestellte im „öffentlichen Dienst“, sie bei einem Bürgeramt und er bei der Müllabfuhr.
Sie meinen, trotz gleichem Lebenslauf würden Spießerin und Chaot nicht zusammenpassen, insbesondere nicht in einer von Studenten überlaufenen Stadt wie Göttingen? Nun, dann hören Sie einmal zu, was sie zu ihm und er zu ihr sagte.
Sie zu ihm: „Du fragst mich nach meiner Arbeit? Ich kann dir nur sagen, schrecklich eintönig, spießig. Da kommen Bürger und wissen nicht einmal, wie ein Pass in türkischer Sprache auszufüllen ist. Können mir nicht das Alter ihres vor wenigen Tagen geborenen Babys mitteilen. Sogar die alten einfältigen harmlosen Witwen verlangen stur und spießig nur das eine: ‚mehr Geld! Noch mehr Geld! Weil, das steht mir zu! Das hat mein Sozialbegleiter mir geraten!' Sozialbegleiter sind die neuen Propheten der etablierten und neuen Spießigkeit: Sie stumpfen alles zurecht auf ‚steht mir zu' und ‚Geld'. Sie töten Eigeninitiative und fördern Sturheit. Spießigkeit ist der schmale Grat des sturen ‚das steht mir zu'. Was meinst du?“
Er zu ihr: „Spießig gleicht ‚steht mir zu', sagst du? Kann ich verstehen. Bei mir wirbeln dieselben Mitbürger chaotisch alles durcheinander, Papier in Sondermüll, Batterien in die Biotonne, betäubte, noch lebende Katzen in den gelben Sack. Das ist wirklich Chaos! So rücksichtslos unmenschlich. So ohne Verstand! Meine Chaoten sind deine Spießer!“
Beide dachten: ‚So finden Chaos und Spießigkeit zueinander. Beide ergänzen sich vorteilhaft. Passen wir beide nicht gut zusammen?'
Bei diesen Gedanken verlangsamten sie ihren Spaziergang und blieben auf ihrem Wanderweg stehen. Er nahm sie zunächst leicht in seine Arme, drückte sie dann fest an sich und, da sie es sich hingebungsvoll gefallen ließ, küsste er sie lange und fordernd.
Danach setzten sie schweigend und versunken in ein inneres Glücksgefühl ihren Spaziergang durch den märchenhaft grünen und sonnig-heiteren Wald fort. Ihr Ziel war die auf einer leichten Anhöhe gelegene Sababurg. In dem dortigen Restaurant hatte er einen Tisch für das Mittagsbuffet reserviert.
Ihr Weg führte sie einen leichten Abhang hinab aus dem Wald an eine Wiese. Vom Waldrand konnten sie die trotzige Ruine der einst so mächtigen Burg mit ihrem wehrhaften Burgfried, dem grauen angehefteten Rundturm und dem Restaurant erblicken.
„Dornröschen soll hier geschlafen haben und verliebt aufgewacht sein“, meinte sie träumerisch zu ihm.
„Ja, ja, die Dornen und die Rosen, Chaoten und Spießer, das Verlangen und die Liebe, Träumen und Küssen, die Ekstase und die Heiterkeit, Dornröschen und Rapunzel. Hier hätte der Königssohn an Rapunzels langem Haar zu ihr hinaufklettern und sie lieben sollen, anstatt sich durch Dornen hindurch zu winden und Dornröschen zu küssen, oder? Leider, an deinen Haaren hätte der Königssohn nicht klettern können. Viel zu chaotisch und spießerisch. Kannst du es mir nicht ein bisschen leichter machen, an dir herumzuklettern?“, fragte er spöttisch.
„Meine Haare sind nicht zum Klettern gedacht. Sie dienen anderen, aufregenderen Dingen“, sagte sie aufreizend.
„Und das wäre?“, wollte er wissen. „Nun, für eine Aufgabe im Bett“, lachte sie spöttisch. „Das verrate ich dir vielleicht, aber auch nur vielleicht, später. Sieh, sie sind aufgerollt zu Strickchen. Zu richtigen kleinen Rapunzelstrickchen. Sie können springen, sich entrollen, sich festhalten, alles, was du willst. Aber gehorchen tun sie nicht. Auch ist es schwierig, sie in Ordnung zu halten. Einige wollen immer aus der Reihe tanzen. Darauf musst du achten, wenn du “
„Wenn ich was?“, wollte er lächelnd wissen.
„Ach, das kommt später. Aber eins sage ich dir: Sie können Geister rufen, die Rapunzelgeister“, sagte sie bestimmt.
„Sie können was? Die Rapunzelgeister rufen? Wie das denn?“, fragte er ungläubig und dachte: ‚Wie lange kenne ich sie? Drei Tage. Ist sie nicht ganz klar im Kopf? Ihre so wirr und stricknadelhaft zerfaserten Haare. Warum habe ich das nicht zuvor bemerkt? Habe ich meine klaren Gedanken verloren?' Er schaute bedenklich ernst nach ihr.
Sie bemerkte seinen Stimmungsumschwung nicht, war verloren in ihren Vorstellungen und träumte laut vor sich hin:
„Rapunzelgeister sind Kinder der Sonne, der Wolken, des Windes und der Träume. Sie entstammen dem Paradies und wurden dort geboren, als es noch nicht von Adam und Eva bewohnt war. Sie sind Träume des Petrus, der mit all seiner Wettergewalt das Paradies bewacht. Je nach der Stimmung des Petrus haben sie ein heiteres, man könnte auch sagen nachhaltig gutes, erfüllendes Gemüt. Aber sie treiben auch böse Dinge, bringen Traurigkeit oder gar Widerwillen, Enttäuschung, manchmal auch Hass und Mordgedanken zu den Frauen, die, wie ich, Strickchenhaare tragen und die Rapunzelgeister rufen können. Das geschieht zumeist nach einem erlebnisreichen Abend oder einer durchliebten Nacht.“
„Dann ist es also der Mann, der für die Stimmung der Rapunzelgeister verantwortlich ist?“, fragte er.
„Ja, zumindest sehr oft. Petrus ist ein Mann. Rapunzelgeister sind seine Träume. Träume, die sich nur bei Frauen einnisten. Männer träumen anders als Frauen, eben wie Männer. Natürlich, bei Frauen träumen Männer oft falsch und können das nicht begreifen. Selbst Petrus versteht das nicht.“
„Hm, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Und jetzt?“ Er wollte das Thema beenden und zurück in seine Heiterkeit finden.
Sie warf den Kopf in den Nacken, lief mit kräftigen Schritten vorwärts, hielt abrupt inne und zeigte ihm lachend, was sich an den Wänden des mächtigen Rundturms abspielte.
Bei aller Skepsis komme ich nicht umhin festzustellen: Petrus, der alte, das Paradies bewachende Petrus hatte zugeschlagen. Die Wolken spielten vor der Sonne. Ihre vorbeiflüchtenden Schatten suchten Ruhe und Rast auf Plätzen, die ihnen zumindest kurzfristig sicheren Halt versprachen. Das war die Aufgabe des Rundturms. Geistergleich glitten die Wolkenschatten vom spitz zulaufenden Dach des Turms, wie an Kletterfäden gezogen, an der Mauer hinunter. Sie suchten nach Königssöhnen, die in das weit oben offen stehende Fenster eindringen wollten.
Sie zu ihm: „Sieh die wunderbaren Rapunzelgeister, die Helfer von Dornröschen und Rapunzel, die Widersacher von den Königssöhnen. Sie schwingen sich um den alten Zauberturm, wild und chaotisch. Wie kann ein Königssohn durch diesen Wirrwarr sein Ziel erreichen? Hält er sich verborgen an einem Schattengeist, verbrennt ihn sofort der Sonnengeist. Klebt er im Sonnengeist, vernichtet ihn der Schattengeist. Ach, der arme Königssohn kommt nicht hinauf zum Fenster. Selbst ein heiterer Petrus kann ihm nicht helfen.“
Er nickte. Sah die flatternden chaotisch wirbelnden Rapunzelgeister. Sah das offene Fenster direkt unter dem Dach des Turms.
Er dachte: ‚Sind es die heiteren oder die bösen Rapunzelgeister? Wie schwierig ist es, über das Chaos der Gefühle hinauf in das Fenster der Liebe zu klettern, um was zu erreichen? Sind kurze Augenblicke des Glücks, das ‚Über-sich-Hinauswachsen', Bewunderung der Mitmenschen, befehlsgebende Macht über Untergebene, unermesslicher Reichtum, oder gar die Unsterblichkeit in der Menschheitsgeschichte das Ziel?'
Er wandte sich zu ihr. Sah, dass in ihren wunderbar heiteren Augen die Rapunzelgeister sich wie in einem Zauber spiegelten. Er wagte es. Stürzte nicht ab. Nahm entschlossen ihre Hand. Beide verließen eng aneinandergeschmiegt den zur Sababurg führenden Weg, glitten selig hinaus auf die entlegene Wiese, gemeinsam Schritt für Schritt.