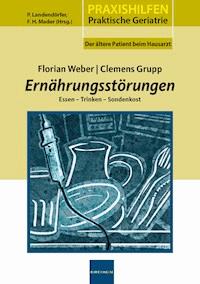17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
EIN LAMA, EIN CLOWN UND EIN HEINRICH POHL IM ATLANTISCHEN OZEAN.
VIELE MEILEN VON RETTENDEN UFERN ENTFERNT.
EIN SZENARIO, DAS NACH AUFKLÄRUNG SCHREIT.
Ein Mann treibt auf einer Kühlbox im Meer. Neben ihm ein ohnmächtiger Clown und ein Lama. Er kann sich an nichts erinnern. Durch aufblitzende Erinnerungen versucht er zu erforschen, wer er ist und was ihn in diese lebensbedrohliche Situation gebracht hat. Dabei spielen seine Kindheit, das Antiquitätengeschäft des Onkels in seiner Heimatstadt München, ein Klavier und eine Reise nach Amerika eine erhebliche Rolle. Ein sagenhafter Roadtrip und zugleich ein Roman voller origineller Ideen und einer so rührenden wie unterhaltsamen Familiengeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Ähnliche
DASBUCH
Heinrich Pohl treibt auf eine Kühlbox gestützt im Meer zwischen den Bahamas und Vero Beach in Begleitung eines Lamas und eines bewusstlosen Clowns. Er weiß weder, wer er ist, noch wie er in diese Situation geraten ist. Doch viel wichtiger ist gerade ohnehin sein Kampf gegen das Ertrinken. In kleinen Schüben erinnert er sich an seine Vergangenheit. An seine Kindheit, an das durchwachsene Verhältnis zu seinen Eltern, an das Antiquitätengeschäft seines Onkels, bei dem er jede freie Minute verbrachte. Zu jedem seiner Artefakte konnte Onkel Wendelin interessante Geschichten erzählen. Fünf dieser Artefakte werden im Laufe der Geschichte zusammen mit einem Klavier eine wichtige Rolle spielen. Spätestens, als Onkel Wendelin mit seinem Neffen zu einer gemeinsamen Reise nach Amerika aufbricht.
Erst ein Water-Book auf dem atlantischen Ozean, dann eine Road-Novel durch die Südstaaten Amerikas mit Zwischenstationen in Schweden und München, ist Florian Webers dritter Roman eine Geschichte über Selbstfindung und den Umgang mit Krankheit und Verlust. Denn für Entdeckungen, die das Herz in Aufruhr versetzen, ist es bekanntlich nie zu spät.
DERAUTOR
Florian Weber, 1974 in Schrobenhausen geboren und entwickelt, seit 1994 in München lebend und gereift zum Musiker (Sportfreunde Stiller, MS Flinte, Taskete!, Bolzplatz Heroes), Romanautor, Radiomoderator, Journalist, ausstellender Künstler und Diplomsportwissenschaftler (zumindest laut Abschluss).
FLORIANWEBER
Die wundersame Ästhetik
der Schonhaltung beim
Ertrinken
ROMAN
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten von Dritten enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Copyright © 2021 by Florian Weber
Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Joscha Faralisch
Lektorat: Markus Naegele
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel / punchdesign, München
Umschlagmotiv: Sasan Saidi / Sasan Pix
Karte und Illustrationen: Florian Weber
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28145-8V003
TEIL 1
Im Wasser
1
Das Meer und der Mensch
Wenn man im Meer treibt, schwankt das Universum.
Mit einem je nach Seegang unterschiedlich stark tanzenden Horizont. Ein Links, ein Rechts, ein Vor und Zurück.
Ein Auf und Ab im räumlichen Sinne. Aber auch im metaphorischen.
Im Falle von Heinrich Pohl ist es ein Tanz ohne Horizont. Ein einsames Treiben zwischen den Koordinaten 27.847 156 Grad Breite und -79.610 289 Grad Länge, was bedeutet: kein Land in Sicht! Sein makrokosmisches Universum, sein eigentliches, gewöhnliches Leben, viele Kilometer unerreichbar weit entfernt. Sein mikrokosmisches Universum, seine direkte Umgebung, grotesk gespickt mit Gegenständen, die man dort nicht vermuten würde.
Heinrich Pohl befindet sich in der lebensbedrohlichen Situation des Ertrinkens.
Grob geschätzt nördlich der Bahamas und westlich von Vero Beach. Der Ozean, der ihn noch trägt, hat eine Wassertemperatur von gut fünfundzwanzig Grad Celsius und schaukelt Pohls Körper plätschernd und gleichmäßig in mal elliptischen, mal azyklischen Bahnen. Dem träge schwingenden Taktstock eines Dirigenten gleich. Das Meer, ein dunkles klimperndes Grün, bewegt sich in diesem Moment gemach. Es könnte sich jedoch auch blitzschnell in ein aggressives, aufbrausendes Monster verwandeln. Das Meer ist, wie wir sowohl aus diversen Belletristik- und Sachbüchern als auch aus maritimer Cineastik wissen, ein naturgewaltiges Chamäleon. Ernest Hemingway oder George Clooney könnten unheilvolle Shantys davon singen.
Die Ozeane bestimmen über unser Los. Sie überleben jeden. Alles. Selbst wenn die Universen sterben, bleiben Ozeane voller Leichen.
Heinrich Pohl liegt mit dem Oberkörper auf einer stabilen, mit Styropor ausstaffierten Hartplastikbox. Seine Beine baumeln im Wasser, als würde er locker und leicht auf einer Luftmatratze vorm Timmendorfer Strand paddeln. Sein Kopf ruht wie einbetoniert in seiner rechten Armbeuge. In schwerer Ohnmacht.
Das Atmen klingt rasselnd. Aus seiner Nase marschiert ein kleines Rinnsal Blut wie eine Ameisenstraße Richtung Salzwasser. Die Blutstropfen lösen sich auf wie schmelzende Quallen.
Leere Büchsen einer mexikanischen Bierbrauerei tänzeln lustig um ihn herum und wirken wie ein Dutzend Schwimmer ausgeworfener Angelruten. Zwei haarige Kugeln tummeln sich dazwischen. Es sind Kokosnüsse.
Drei Grad backbord schwimmt ein brauner Gegenstand im Wasser, ein pelziger Körper voll Leben: ein Lama. Strampelt rhythmisch mit seinen vier Stelzen, um den nötigen Auftrieb zu erzeugen. Lamas sind gute Spucker, aber fast ebenso feine Schwimmer.
Heinrich Pohl war ein mittelmäßiger Schwimmer. Nun aber, im Meer, dem Unerbittlichen, zieht gerade sein Leidensgenosse, das Lama, schnellere Bahnen als er. Wenngleich auch im Kreise. Ein Tierkreisel ungewöhnlichster Art am unmöglichsten Ort. Die Bierbüchsen wackeln mit den Köpfen und zollen so Respekt ohne Beifall. Lichtreflexe des Alus treffen auf das glitzernde Wasser. Unzählige, sich verkeilende SOS-Signale. Sie sehen aus wie Millionen explodierende Kameralichter im Fußballstadion während eines entscheidenden Elfmeters. Aber Hand aufs Herz – entscheidende Elfmeter gibt es viele. Ein im Kreis schwimmendes Lama zwischen Bahamas und Vero Beach, zwischen Treibgut, das sich aus mexikanischen Bierbüchsen und einem sich an eine Kühlbox klammernden Heinrich Pohl zusammensetzt, ist einmalig. Unmöglich, im Grunde.
Heinrich Pohl schmeckt Salzwasser. Nicht so, als würde er genüsslich eine Auster schlürfen. Eher so, als bekäme er von der Großmutter einen nassen Küchenlappen ins Gesicht geschleudert, während er verbotenerweise von der Fischsuppe probiert. Unerwartet. Rabiat. Ein salzhaltiger Weckdienst aus dem Nichts.
Auf das Salz folgt der Schmerz. Noch bevor sich seine Augen in denen des Lamas spiegeln können, realisiert er das große Leid im Kopf. Wasser, Salz, Kopfweh, Lama, Kunststoff, mehr Wasser.
Folgerichtig kratzt sich aus Heinrich Pohls rauer Kehle folgender Satz: »Was zur Hölle mache ich hier?«
Es klingt, als hätte er hundert Jahre nicht mehr gesprochen.
Zerrissene, schüchterne Wolken schieben sich vor die Sonne. Als die Helligkeit an Kraft einbüßt, geht Heinrich Pohl ein Licht auf. Ein kleines.
»Ich bin, also denke ich.«
Genauer gesagt bemüht er sich zu denken. Schmerz und Wirrnis erschweren jeden klaren Gedanken. In etwa so, wie man im Zustand völliger Betrunkenheit den Hausschlüssel im Schlüsselloch unterbringt. Zu Beginn ist es eher ein Stochern.
Schließlich, nach einigem Stochern im Dunkeln, kriecht folgende Frage ans Licht:
»Wer bin ich?«
Nicht, dass Heinrich Pohl in höchster Seenot auf Sinnsuche wäre. Er vergaß – so schlicht und einfach wie niederschmetternd –, wer er ist, woher er kommt, was er tut oder bisher tat.
Heinrich Pohl ist von seinem Betrachtungswinkel aus niemand. Niemand auf einer Getränkebox im Meer treibend. Niemand ohne Aussicht auf Rettung. Niemand in bitterster Angst.
Niemand beginnt zu weinen.
Selbst in jeglicher Absenz seiner eigenen Persönlichkeit ist dem Menschen gewahr, dass er leben will. Was im Umkehrschluss nicht heißt, dass jeder Selbstmörder genau weiß, wer er ist. Heinrich Pohl hingegen, im Zustand einer retrograden Amnesie, ist sich sicher, er will sich, wer auch immer er sein mag, am Leben erhalten. Der Selbsterhaltungstrieb funktioniert, ebenso sein vegetatives Nervensystem, auch ohne Identität. So gesehen hat er nur seine Analogie verloren – etwas, wovon viele Menschen im Zeugenschutzprogramm träumen würden.
Schlimm genug, dass er um sein Leben kämpft, nun ringt er auch noch mit seiner Identität. Seine verzweifelten Tränen weichen einem natürlichen Verlangen.
»Aus Nächstenliebe«, kommt es dem Schwimmer, »rette ich mich. Wer auch immer ich bin.«
Er spürt einen tiefen Optimismus, der seinen schweren Körper gleich etwas leichter erscheinen lässt.
»Aus unbedingter Nächstenliebe, auch wenn ich meinen Namen nicht kenne.«
Die Erdoberfläche besteht zu knapp einundsiebzig Prozent aus Wasser, davon sind etwa drei Prozent Süßwasser. Das Wasser, das Heinrich Pohl umgibt, gehört zweifelsfrei nicht dazu. Die Wassertemperatur scheint nicht zu kalt, ist fast angenehm. Er verspürt keine Anzeichen von Unterkühlung, was wiederum dafür spricht, dass er sich auf der Südhalbkugel befindet und – falls das Schicksal nicht auf seiner Seite ist – auch dort sterben wird. Ob Raubfischattacke, Ertrinken, Blitzschlag oder letztlich doch Erfrieren. Das Ergebnis wird dasselbe sein. Wenn nicht ein regelrechtes Wunder am Horizont erscheint. Wunder sind rar, aber wir wissen: Das Unmögliche existiert. Seine Kiste ist ein brauchbares provisorisches Rettungsboot. Kein Vehikel, mit dem der Ärmelkanal überwunden werden könnte. Aber es schützt vorm Ertrinken. Das haben weit größere und technisch perfektere Gefährte nicht geschafft, wie der ein oder andere Schiffbrüchige leider nicht mehr erklären kann.
Lamas sind keine menschenfeindlichen Raubtiere. Heinrich Pohl wird von seinem Mitstreiter keinen Angriff befürchten müssen. Wohingegen er natürlich weiß, dass in der Tiefe das Unglück lauert. Haie. Barrakudas. Seewespen. Mantas. Ungeheuer der Tiefsee. Heinrich Pohl winkelt seine Beine an.
Seine Nase schmerzt. Ebenso sein Kopf. Gebrochen ist nichts. Vielleicht die Nase. Die Hände wirken nicht verkrampft. Der Griff ist fest und sicher.
Er hat keinen Durst, was sich bald ändern wird. Er hat keinen Hunger, was sich auch bald ändern wird. Wenn es sich nicht ändern wird, ist er bereits tot.
Ein verschleierter Rundumblick lässt kein Schiff oder Land erkennen. Er schwebt im Nichts. Zwischen Himmel und den Untiefen des Meeres. Ein verschwindend kleiner Punkt im großen Nass des Erdenballs. Seine Gefühlswelt gleicht einer Sinuskurve. Panik steigt auf. Heinrich Pohl beginnt zu bibbern. Er wagt nun doch einen aussichtslosen Versuch, der in Kraft und Ausdruck seinen Gesamtzustand widerspiegelt – hektisch, nervös, ängstlich, dabei jedoch matt, sehr matt – und ruft: »Hilfe!«
Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Diese Durchhalteparole ist Heinrich Pohl trotz Amnesie geläufig. Als Atheist hätte er da schlechte Karten. Ist er Atheist? Wenn nein, könnte dieser traumatische Aufenthalt inmitten eines Ozeans als göttliche Strafe gedeutet werden. Nein, Heinrich Pohl glaubt keineswegs an göttliche Vergeltungsmaßnahmen, das setzt er auf die Schnelle als gegeben voraus. Aber wer, oder – vielleicht wäre diese Frage hilfreicher – was ist er?
Ein Mann. Keine Frage. Ein Mann mittleren Alters. Die Haare auf seinen sommersprossigen Unterarmen lassen keinen anderen Schluss zu. Wird der Mann geliebt? Hat er Familie? Wird er vermisst oder ist er seinen Mitmenschen gleichgültig? Oder wird er gar gehasst? Ist dies der Grund für seine Katastrophe? Wird er gesucht – was für einen positiven Ausgang seiner Situation förderlich wäre? Oder ist er vergessen und verloren? Ist er ein Weltenbummler, quasi ein havarierter Weltumsegler? Ist er Teilnehmer einer Kreuzfahrt und bei zu viel Feierlichkeit samt den mexikanischen Bierdosen vom Sonnendeck gestürzt? Ein verstörendes Gefühl kommt auf. Heinrich Pohl entschließt sich, diese Fragen umzuwandeln. Er gaukelt sich selber vor, es handele sich um Tatsachen, deren Richtigkeit er an seinem Bauchgefühl prüfen könne. Die Logik eines Gewasserten sollte man nicht hinterfragen. Außer man ist Gott und will helfen.
»Ich bin ein Seemann.«
Heinrich horcht. Bringt ihm diese Annahme innere Zustimmung? Nichts.
»Ich bin ein verunglückter Fischer. Ich bin ein Langstreckenschwimmer … in Klamotten und mit Proviant.«
Heinrich Pohl greift nach einer Bierdose, überfliegt das Etikett.
»Ich bin mexikanischer Bierfahrer, also Bierlieferant auf See.«
Er lässt die Dose wieder ins Wasser gleiten. »Ich bin ein Kokosnusslieferant. Ich bin ein Survival-Experte und weiß, wie man mit bloßer Hand eine Kokosnuss öffnet. Ich bin ein … Arzt. Ein Meeresbiologe. Ich bin Lehrer. Sportlehrer. Trainiere für die Bundeslehrkraftspiele. Ich bin Taucher bei der Marine, und meine Kameraden haben Schabernack mit mir getrieben. Sie kommen gleich wieder. Sie kommen gleich wieder und …«
Heinrich blickt in die Ferne. Die Ferne verneint mit erhobenem, wackelndem Zeigefinger.
»Ich bin Pfarrer und habe mein Leben lang um Zuwendung gebetet, auch in schlechten Zeiten. Ich bin der Papst und werde sowieso gerettet. Ich bin der Papst, weil ich … weil ich Nächstenliebe gut finde. Ich bin Papst, und Gott gibt mir auf der Stelle einen Wink der verdammten Dreifaltigkeit. Der Papst würde das Wort verdammt nicht kennen.«
Pause.
»Ich bin ein Verbrecher. Ein Verbrecher, der nach einer schrecklichen Tat auf der Flucht einen unglücklichen Unfall hatte. Ich bin ein Mörder. Ich bin … ich bin ein zum Tode Verurteilter, der dem Vollzug des Urteils entkommen ist.«
Heinrich Pohl verstummt. Sein Bauchgefühl sprang bei keiner Aussage so richtig an, aber was heißt das schon? Er streicht sich durch die nassen Haare. Fummelt der Situation völlig unangemessen lange an seiner Frisur herum. Der Scheitel muss sitzen. Akkurat. Aber ist er überhaupt Scheitelträger?
»Disziplin und Ordnung sind des Bürgers erste Pflicht.«
Heinrich Pohls Augen weiten sich zu freudigen Sehschlitzen. Im Brustton absoluter Überzeugung sagt er: »Ich bin Deutscher!«
Treffer. Keine weltbewegende Erkenntnis, aber ein Treffer. Heinrich Pohl ist Deutscher und hat bestimmt einen sehr deutschen Namen wie Markus, Martin, Michael, Richard, Günther oder gar Werner.
»Ich bin Deutscher und werde gerettet.«
*
Das Wetter.
Es gibt Kaventsmänner, wie Riesenwellen in der Seemannssprache bezeichnet werden, in denen tonnenschwere Boote ihr Ende finden. Ein Kaventsmann würde natürlich einen nur kiloschweren Schwimmer einfach in Neptuns Tiefen ziehen. Kaventsmannwetter herrscht nicht. Heinrich Pohl muss sich um starken Seegang vorerst keine Gedanken machen. Gerade scheint die Sonne, als ob es kein Verbrechen, keinen Missstand, kein Unglück auf der Welt gäbe. Aber die Sonne lügt gelegentlich dermaßen, dass sich die Strahlen biegen.
Heinrich Pohl blinzelt gen Horizont. Ein trüber Schleier liegt auf der Welt, wie ein Blick durch ein grobmaschiges Häkeldeckchen. Salz in den Augen ist keine Delikatesse.
Er möchte irgendwo ein Schiff ausmachen. Eine Palme. Einen Delfin. Rettende Objekte. Er will festen Boden unter den Füßen spüren, nicht dieses stete Zerren im Hüftbereich. Ein leichtes Ziehen und Reiben, verdammt, dürstet ihn so stark? Oder sind das erste Hungerattacken?
Oder Hungerattacken der Meeresbewohner? Das erste Nagen eines Raubfisches an seinem Leib. Heinrich sieht sich panisch um. Wirft Blicke ins dunkle Wasser. Ruckelt mit dem ganzen Körper auf der Rettungsbox, stets versucht, den sicheren Halt nicht zu verlieren.
Kein Fisch. Ein Seil. Ein Tau, das nach einigen Zentimetern im Meer verschwindet. Doch wo kommt es her? Heinrich Pohl stellt fest, dass der Ursprung des Seils an seinem Körper, genauer an seiner Hüfte, auszumachen ist.
Um seine Taille ist ein Tau gebunden. Im Nu schießen ihm ein Dutzend weitere Fragen in den Kopf.
»Gefesselt? Gefangen? Entführt? Gesichert?«
Seilschaften im Gebirge sind logisch. Im Meer eher nicht. Es sei denn, eine gesamte Mannschaft bindet sich bei hohem Seegang an der Reling eines Schiffes fest.
Zu einer Seilschaft gehören mindestens zwei, und so zieht Heinrich Pohl eher aus Neugier als aus dem Wunsch heraus, jemanden anzutreffen, am Seil. Mit der linken Hand klammert er sich an seine Schwimminsel, mit der rechten versucht er das Seil einzuholen. Es gelingt, allerdings mit deutlich mehr Anstrengung, als ihm lieb ist.
»Da hängt doch was?«
Zweifelsfrei spürt er einen Widerstand am Seilende, den er einhändig, mühsam und nervös durch das Wasser zieht. Weil er selbst kein Fixpunkt ist, gleitet er dem anderen Ende ein wenig entgegen.
Dort befindet sich ein heller Gegenstand. Er streckt den Kopf wie eine Schildkröte nach dem Ding aus. Was kann das sein?
Auch das Lama strampelt aufgebracht in Richtung des Geschehens. Es hat schließlich ebenso ein Recht auf Auskunft.
Heinrich Pohl erkennt ein wollenes Gestrüpp. Farbig. Rötlich fast.
»Noch ein Tier?«
Nach weiteren Sekunden der Kraftanstrengung stoppt er den Vorgang. Sein Atem geht schnell. Aufregung steigt in ihm auf wie Rauch in einem Schornstein. Das gekräuselte, dunkelrötliche Ende des Seils ist auf einem gummierten orangen Gegenstand gebettet. Heinrich stoppt seine Bemühungen, strampelt in die entgegengesetzte Richtung.
»Hallo? Hallo!«
Heinrich Pohl dreht bei.
»Hallo? Können Sie mich hören?«
In wenigen Metern Entfernung treibt ein Körper im Wasser. Ein in grauer Kleidung gehüllter Mensch, Gesicht nach oben. Das regungslose, porzellanartige Antlitz eingehüllt von roten Locken. Der Kopf ruht auf dem aufgeblasenen Luftkissen einer großen Schwimmweste. Sie hält den ganzen Leib über Wasser. Auf der Brustseite des grauen Gewandes sind drei rote Wollbollen angebracht. Es müssen einmal vier gewesen sein, der dritte »Knopf« von oben scheint ausgerissen. Rote Rüschen zieren die Ärmel und den Hosensaum. Die Hände stecken in weißen Handschuhen. Beide Arme wie Jesus am Kreuz weit von sich gestreckt. An den Füßen zwei rote Lackstiefel.
Heinrich kann nicht erkennen, ob die Person noch lebt. Doch bezüglich ihres Berufsstands ist er sich ziemlich sicher.
»Ein Clown!«
Auf den Moment des Staunens folgt der Moment des Entsetzens.
»Um Himmels willen! Ein Clown!«
Er wagt es, den Clown ganz an sich heranzuziehen. Schwere, nasse Locken hängen über die Stirn in die geschlossenen Augen. Mit zwiespältigem Gefühl stellt Heinrich fest, dass der Brustkasten sich hebt und senkt. Der Clown lebt.
Vor- oder Nachteil? Segen oder Fluch?
Aus menschlichem Reflex tätschelt Heinrich ihm die Wangen und ruft, er solle doch die Augen öffnen. Der Clown atmet ruhig weiter. Keine sonstige Regung. Da sich Heinrich Pohl über sein Verhältnis zum Clown nicht im Klaren ist, möchte er den Leidensgenossen vorerst an der langen Leine halten. Das Seil zu kappen wagt er aber auch nicht. Womöglich würde er sich damit von einem guten Freund trennen. Er verpasst dem Clown lediglich einen leichten Stoß. Die beiden driften in entgegengesetzte Richtungen auseinander. Wie zwei Astronauten im All. Ein Sicherheitsabstand von einigen Wellen Entfernung.
Es ist das Los und der Antrieb eines jeden, die Aufgaben des Lebens zu meistern. Doch Obacht: Das Leben ist ein Täuscher und ein Dieb. Es schickt die Menschheit durch verschiedene Prüfungen, gaukelt Glück vor, hinter denen Niederlagen lauern. Klaut Liebe und die Liebsten. Und wenn es das Schicksal mit dem Geprüften richtig dreckig meint, dann muss die Annahme erlaubt sein, ob nicht gar das Leben selbst ein sadistischer Zyniker ist.
Ein Lama, ein Clown und ein Heinrich Pohl im Atlantischen Ozean. Viele Meilen von rettenden Ufern entfernt. Ein Szenario, das nach Aufklärung schreit.
Plötzlich ertönt ein Klang, der Heinrich Pohl aufhorchen lässt.
Kein Nebelhorn. Kein Flugzeugmotor. Kein baritonales »Heyja, wer da? Brauchen Sie Hilfe?« eines vollbärtigen Kapitäns. Es gellt ein Pfiff. Ein schrilles kurzes Kreischen. Dem Ton folgt ein sich gegen den hellen Himmel abzeichnender dunkler Fleck, der durch Heinrichs Blickfeld segelt wie eine herannahende Ohrfeige.
Ein Wasservogel. Ein weiteres Lebewesen.
Nun möge man annehmen, wo ein Vogel übers Meer flattert, ist das Land nicht weit. Das Flugtier liefert dem Gewasserten jedoch eine bittere Erkenntnis.
Das Land ist unerreichbar fern.
Klare Konturen steigen auf, umfassen Flächen in blassen Farben. Heinrich Pohl schließt seine Augen und erkennt …
2
Der Antiquitätenladen und die Aztekenmöwe
»… dass dies eine Aztekenmöwe ist. Ein in Amerika lebender Wasservogel, der weite Flugstrecken auf sich nimmt.«
»Woher willst du das wissen, du Schlauberger?«
Ein in eine graue Strickjacke gekleideter Herr Mitte vierzig grinst fast schon schelmisch auf den vor ihm sitzenden, in Sommersprossen gehüllten Jungen herab, der in einen dicken Wälzer vertieft ist.
»Na hier, Onkel Wendelin, hier, sieh doch. Schwarzer Kopf, möwenhafter weißer Körper, schwarzer, gespaltener Schwanz.«
Der Junge läuft triumphierend, das große Naturbuch unter den dünnen Ärmchen eingeklemmt, zu einem ausgestopften Tier. Seine Sommersprossen scheinen vor Aufregung zu tanzen. Leuchtende Tupfer von Stirn bis Kinn.
»Eine Aztekenmöwe! Man sieht es ganz deutlich, hier auf dem Bild.«
Er platziert das Buch neben den toten Wasservogel. Eine ausgestopfte Aztekenmöwe, auf einem viereckigen Holzsockel befestigt, welcher sich wiederum auf einer antiken Holztheke befindet, die wiederum in dem Antiquitätenladen steht, über dessen Eingang in großen, geschwungenen Lettern AntiquariatW. Pohlprangt.
»Heinrich«, Onkel Wendelin klatscht langsam in die Hände, einen sanften Applaus der Hochachtung spendend, »du bist für deine zehn Jahre ein eifriges, wissbegieriges Kerlchen. Nur, und da wiederhole ich mich, solltest du schon seit einer Stunde zu Hause sein.«
Ein Grinsen folgt und verformt das Gesicht des Onkels zu einer liebenswerten Dattel, was dem Jungen nicht den Eindruck vermittelt, dass die Zeit drängt oder er im Antiquariat unerwünscht wäre. Im Gegenteil. Der Bub lässt sich in einen alten Schaukelstuhl fallen und fragt im Wippen: »Aber, aber, Onkel Wendelin, wer schickt denn solche Gegenstände? Oder wer kauft so etwas?«
»Fest steht, mein Junge, verkauft wird es von mir. Aber ohne dich. Du solltest jetzt gehen, du weißt, dein Vater mag es gar nicht, wenn du spät nach Hause kommst.«
»Vater? Wer ist der schon?«, sagt Heinrich so enttäuscht wie aufmüpfig. Und dann schiebt er trotzig hinterher: »Ich wünschte, du wärst mein Vater.«
Aus Onkel Wendelins dünner Mundöffnung kommt ein leises gequältes Schnauben, gerade so leise, dass es Heinrich nicht hört, wohl aber das Universum.
»Komm schon, mein Junge …«
»Onkel Wendelin, spiel mir was zum Abschied.«
»Nein, heute nicht mehr.«
Onkel Wendelin schlurft dennoch in Richtung eines alten braunen, verschnörkelten Holzkastens. Seine sehnigen, langen Finger streichen träge, aber anmutig über die verkratzte Holzklappe eines antiken Klaviers.
»Los, Onkel Wendelin!« Heinrich stoppt das Vor und Zurück seines Schaukelstuhls und fordert mit auf die Knie gelehnten Ellbogen: »Bring uns weg von hier.«
Musik macht alles größer.
Dies ist kein Geheimnis, aber ein unausgesprochenes Lebensmotto von Heinrich und seinem Onkel Wendelin. Das alte Klavier steht seit Jahrhunderten, so scheint es, im Antiquariat Pohl. Sein Klang macht alles größer. Den Raum. Die Atmosphäre. Die Geduld. Die Liebe. Das Vertrauen. Zwischen Onkel Wendelin und seinem Neffen Heinrich. Das Klavier ist das Zentrum des Antiquariat Pohl. Das Herz, das schlägt und mit jedem Schlag Schall und Sanftmut durch die ausgestellten Waren schickt, diese umgarnt und in den Kosmos einschließt. Kein Kunde wird diese Klangwelt je entreißen: Unverkäuflich steht in markanten Lettern auf einem Kartonschild.
Zu den Verkaufsgegenständen im Laden gehören typische Antiquitäten wie Möbel, aber auch skurrile Objekte, zum Beispiel ein Designeraschenbecher von 1920. Billiger Schnickschnack, teure Wertgegenstände. Für die einen Sperrmüll, für andere Museumsstücke. Museale Objekte.
Dinge, die manchen Menschen nichts mehr, anderen hingegen umso mehr bedeuten. Dinge, die zunächst stumpf und matt erscheinen und doch tausend Geschichten erzählen könnten. Dinge, die vordergründig strahlen und glitzern und doch nichts erlebt haben.
Nippes. Altes. Tinnef. Gebrauchtes. Lebenswichtiges. Über Jahrzehnte behütet, geborgen und verteidigt von Liebhabern, bis zu deren Tod. Im nächsten Moment für Appel und Ei verkauft, weil unnütz für den neuen Besitzer. Güter, die durch ihre kunstvolle Gestaltung sowohl materiellen als auch ideellen Wert besitzen, lehnen an verstaubtem Krempel, der die Mühen eines Verkaufsvorgangs nicht wert wäre. Ein abgeschmackter Regenschirm steckt in einer Mingvase. Darf er das? Natürlich, der Regenschirm war einst im Besitz des Bühnenbildners Caspar Neher, der diesen Regenschutz benutzte, als er 1928 am Theater am Schiffbauerdamm in Berlin der Dreigroschenoper zu bühnenhafter Gestalt verhalf. Nur, und so bleiben diese Geschichten stille Zeugen der Verkaufsobjekte, steht dies nicht auf dem Regenschirm geschrieben. Die Vase hingegen, über die sich interessierte Käufer hochtrabende Geschichten über irgendwelche Dynastien erzählen, aufgrund derer sie hirnrissige Preise in Betracht ziehen – eine billige Attrappe.
Eine halbakustische Bluesgitarre, die einst im Londoner Hotel St. James in einer hinteren Ecke der berüchtigten Hotelbar an der Wand hing, birgt folgendes Geheimnis: Der Laiendarsteller Samuel T. Stoner zupfte eines Nachts im Jahre 1972 in seiner Sitzecke einige zufällige Akkordfolgen, dazu trällerte er eine einfache Melodie. Diese Klänge drangen zu zwei professionellen Musikern, welche sich inkognito an der Bar genüsslich taten. Einer davon war Pete Townshend, Gitarrist von The Who, dessen Hörfähigkeit zu diesem Zeitpunkt schon etwas angenagt war. Der andere war Elton John, dem diese Tonfolge die nächsten Wochen nicht mehr aus dem Gehör wanderte. Elton John produzierte aus dem von Samuel T. Stoner verabreichten Ohrwurm den erstmals 1973 veröffentlichten Song »Candle in the Wind«. Durch seine Neuauflage im Jahre 1997 und dessen Vortrag bei Lady Dis Beerdigung wurde das Lied zu einer der erfolgreichsten Singles aller Zeiten. Mit dem Erlös von siebenunddreißig Millionen verkauften Exemplaren leistete sich Elton John unter anderem den Fußballklub FC Watford, den er jahrelang als Präsident führte. Samuel T. Stoner wurde mit keinem Shilling bedacht. Wie auch? Nach einer lausigen Vorstellung als Nebendarsteller Cribs in der Schurkenkomödie Mighty Nothing, einem Theaterstück, das auf einer Londoner Kleinkunstbühne ganze eineinhalb Wochen zu beklagen war, driftete Stoner ins Rotlichtmilieu ab. Nach einer Schlägerei, bei der er drei Polizisten, einer Prostituierten und einem unbeteiligten Passanten mit einer neunschwänzigen Katze und einem abgebrochenen Besenstiel allerhand Verletzungen zufügte, ging er für zwei Jahre in den Knast. Nach drei Jahren wurde er – ein Jahr Bonusrunde wegen schlechter Führung – entlassen.
Immerhin verdiente er sich im Jahre 1985 ein paar Tausend Pfund im Pornostreifen Candlelight Swinger – wie schicksalhaft. Der Mann, der vermeintlich als eigentlicher Urheber von »Candle in the Wind« gelten müsste, verfolgte Lady Dis Beerdigung am Fernsehgerät als verarmter Mann und bedachte Elton Johns Gesangseinlage mit einem knappen »What a crap!«
Manche Antiquitäten können so etwas erzählen. Aber nicht hinter jedem Gegenstand lauert eine Chronik mit berühmt-berüchtigten Persönlichkeiten. Wie etwa bei dem akademischen Säbel aus dem Besitz des 2006 verstorbenen Universitätsprofessors Werner von Fuchs. Der 1894 gefertigte Säbel war weder im Einsatz bei einer berühmten Schlacht, noch könnte er von sich behaupten, eine Mordwaffe zu sein. Für den Veteranen einer Studentenverbindung und seine obligaten Mensuren erweist er sich aber insofern als interessant, weil er in all den Jahren keine einzige Ehrstreitigkeit verlor und an seiner Klinge das Blut unzähliger Schmisse klebte. Sozusagen ein Superhengst der akademischen Säbelgilde. Martialisch, natürlich, die Waffennarren definieren sich über dieses Adjektiv.
In dem mit Liebe geführten Laden von Wendelin Pohl lehnen Gegenstand an Gegenstand, Geschichten an Geschichten, Legenden an Legenden und somit auch Leben an Leben.
Und inmitten des Verkaufsraums existiert ein Ort, der sich selbst verwaltet. Ein autarker Platz für sonderbare Besonderheiten. Die Vitrine im großen alten Apothekenschrank hinter der Kasse beherbergt Wendelins eigentlichen Schatz. Dort befinden sich fünf Gegenstände, die, wie das Klavier, den Titel unverkäuflich tragen. Es sind Exponate einer persönlichen Ausstellung. Sie machen die Vitrine für Wendelin Pohl zum Schrein. Für die Kunden zu einem Schaukasten.
Heinrich fragte nur einmal nach ihrer Bedeutung und Herkunft.
Als ein junges Paar einmal vor dem Apothekerschrank verharrte, sie im Pelz, er in Loden, und sich nach dem silbernen Storch in der Vitrine erkundigte, erklärte Onkel Wendelin freundlich, aber bestimmt die Unverkäuflichkeit der sich darin befindlichen Stücke. Der junge Herr sagte in überheblichem Tonfall, alles habe seinen Preis, man müsse ihn nur bezahlen, nicht wahr? Die Frau quiekte, sie müsse dieses Tier justament haben, schließlich nehme ihre zu beschenkende Schwester nach der Verehelichung den Nachnamen ihres Dietmars an, nämlich Storch. Dieses Geschenk oder keines. Mit einem Bündel Geldscheine, das Heinrich an eine blau und braun gefärbte Papiertaschentuchpackung erinnerte, wartete der Lodenträger auf eine Preisansage. Sie blieb aus. »Sie hörten es doch«, lächelte der Lodenmann, »dieses oder keines.«
Onkel Wendelin sagte, dass es bei keinem bliebe, zumindest hier im Antiquariat Pohl. An der Münchner Freiheit befände sich ein Kaufhaus, in diesem würde es Glasschwäne oder goldene Kettenanhänger in reichlicher Zahl geben. Er behalte sich die Unverkäuflichkeit mancher Objekte vor und wünsche, dies zu akzeptieren. Danke. Auf Nimmerwiedersehen.
Heinrich beobachtete, wie sich das Paar gegenseitig zum Ausgang schob. Ihre Köpfe so rot wie die Uniformröcke der britischen Armee auf dem Gemälde über der Tür. Scotland Forever! – Schlacht bei Waterloo von Lady Elizabeth Butler.
Heinrich beäugte die fünf Gegenstände im Schrank. Er zeigte auf den Storch.
»Warum sind sie unverkäuflich, Onkel Wendelin? Und warum sind sie in dieser Vitrine aufgereiht? Woher stammen denn die Sachen, Onkel Wendelin?«
Onkel Wendelin ließ seinen Neffen aussprechen. Sah ihm eindringlich ins Gesicht. Die Augen so stechend und tief, wie Heinrich es später nie wieder erleben würde, und er sagte: »Das wirst du noch erfahren. Zur rechten Zeit, mein Sohn, zur rechten Zeit. Wichtig ist nur, sie gehören mir, und sie bleiben immer hier.«
Onkel Wendelin berührte das Glas des Vitrinenfensters mit zwei Fingerspitzen. Mit wehmütigem Lächeln fixierte er die Gegenstände. Die Gegenstände lächelten zurück.
*
Der zwölfjährige Heinrich Pohl saust die Gassen entlang. Er malt sich die Situation seiner Heimkunft aus. Klar, Vater, sofern zu Hause, wird ihm zwei, drei Saftige scheuern. Mama wird ihn anschließend in den Arm nehmen, Vater mit vorwurfsvollem Blick bedacht und Heinrich bitterlich angefleht, einfach zeitig nach Hause zu kommen. Heinrich wird dann rufend erwidern, sie brauche sich schon keine Sorgen machen, er war nur bei Onkel Wendelin, da wo er stets zu sein pflegt, wenn jeder und alles ihn nervt, so wie sie, so wie jetzt. Vater wird ihm erneut eine fegen. Sein drei Jahre älterer Bruder Rolf-Egbert wird lachen. Sein fünf Jahre älterer Bruder Frederick-Maria wird fragen, ob er auch mal darf. Mama wird alle fragen, ob sie verrückt sind, und ihn wieder in ihrem Busen ertränken.
Dann wird zu Abend gegessen. Heinrich würgt das Essen voller Abneigung herunter. So wie immer.
Außer Mama, die sein Leben in diesen vier Wänden erträglich macht, widert ihn alles an. Ihre Fürsorge und der Optimismus, den er von Onkel Wendelin eingeimpft bekommt, lassen ihn aufrecht am Familientisch sitzen. Und so fragt er nach einer Weile in kindlicher Euphorie: »Habt ihr in der Zeitung gelesen, es ist ein Zirkus in der Stadt. Auf der Theresienwiese …«
Wieder trifft ihn die Handfläche seines Vaters im Gesicht. Die Sommersprossen explodieren.
»Beim Essen hast du den Mund zu halten.«
Der drohende Zeigefinger verharrt warnend vor seiner Nase. Es bleibt ein Rauschen in den Ohren. Es klingt wie …
3
Das Meer und das Gedränge
… Applaus, denkt sich Heinrich Pohl. Ganz deutlich. Als würde eine begeisterte Schar applaudieren. Erst zaghaft, sich dann steigernd. Heinrich Pohl klammert sich an seine Styroporkiste. Seine Beine strampeln wild nach unten. Er blickt rasch nach allen Seiten. In wenigen Metern Entfernung schläft der Clown auf dem Wasser.
Das unsichtbare Rauschen nähert sich, von hinten, von vorn. Von oben. Applaus für den Teilverlust seiner Amnesie? Ganz und gar nicht.
Auf Heinrich Pohl fällt karibischer Regen. Aus einem Wolkenband, das so plötzlich auftauchte wie sein Name.
»Ich bin Heinrich Pohl, ich erinnere mich.«
Langsam spricht er seinen Namen aus, als würde jeder Buchstabe einer Politur unterzogen.
»Heinrich Pohl.«
Als wäre er zerbrechlich und drohte mit den ersten Erinnerungen an seine Vergangenheit wieder zu zerbersten. Die Bilder, wie von einem Super-8-Film abgespult, kamen mit der Aztekenmöwe. Der Vogel ist weg, die Bilder bleiben. Es ist eher ein Fragment, ein Puzzleteil, das deutlich erkennbar ist, jedoch noch kein logisches Gesamtbild ergibt. Das erste Stück eines Tausend-Teile-Puzzles.
Heinrich Pohl will mehr. Braucht mehr.
Er presst die Augenlider zusammen. Schüttelt heftig den Kopf. Versucht sich mit aller ihm in dieser Situation zur Verfügung stehenden Macht zu konzentrieren. Forscht, geht tief in sich, gräbt, walkt, bohrt nach mehr. Mehr Bilder. Mehr Puzzleteile. Mehr Vergangenheit. Mehr einfache Antworten auf die einfachen Fragen, die er stellt. Wer bin ich, verdammter Mist? Was mach ich hier zur Hölle? Heinrich Pohl boxt das Salzwasser, brüllt verzweifelte Flüche in den Meereshimmel, schreit Beleidigungen heraus. Seine hilflose Auflehnung endet in einer Reihe gutturaler Laute, welche sich mitleiderregend über die Wogen erheben. Nur, wo kein Empfänger, da kein Mitleid.
Heinrich Pohl mahnt sich zur Ruhe.
»Ich bin Heinrich Pohl, das ist doch … immerhin etwas.« Er schließt die Augen.
»Alles wird sich klären. Und wenn es das Letzte ist, was ich denke.«
Er weiß immerhin, dass er Familie hat, zumindest einen Onkel und eine Mutter, die ihn lieben. Ein tröstlicher Zustand. Welche Rolle nimmt sein Vater dabei ein, der ein schummriges Bild eines gewalttätigen Cholerikers abgibt? Oder seine Brüder? Wie heißen sie noch gleich? Rolf-Egbert und Frederick-Maria?
Diese beiden zutiefst hirnrissigen Namen werden von keinem besonderen Gefühl begleitet.
*
Heinrich blickt in alle Richtungen. Das Lama zieht weiter, mittlerweile geschwächt, seine Bahnen. Das Tier wird ersaufen, denkt er sich. So wie der komische Clown.
So wie ich. Um Himmels willen.
Der Regen trommelt weiterhin einen leichten Marsch. Er ist warm und legt sich wie eine schützende Decke über Heinrichs panische Angst zu ertrinken.
»Los, Heinrich Pohl. Dein Name ist wieder da, jetzt kann auch Rettung kommen.«
Er versucht, mit geöffnetem Mund möglichst viele Regentropfen aufzufangen. Ein kläglicher Versuch, seinen Durst zu stillen. Sollte er richtig Durst bekommen, kann er immer noch die mexikanischen Bierdosen austrinken. Er könnte mit den leeren Dosen auch Regenwasser auffangen. Dann hätte er etwas Trinkwasser. Würde der Hunger unerträglich werden, wäre es wohl auch denkbar, das Lama irgendwie in einen verzehrbaren Zustand zu bringen? Mit den scharfen Kanten einer aufgerissenen Bierdose die Kehle des Tiers durchtrennen und aus dem noch warmen, aber toten Leib mundgerechte Happen schneiden? Vielleicht könnte man diese sogar auf dem Aluminium der aufgebogenen Bierdoseninnenseiten in der Sonne garen. So wie es die Überlebenden bei dem Flugzeugabsturz in den Anden 1972 mit ihren verstorbenen Freunden getan hatten.
»Wie Clownsfleisch wohl schmeckt?« Heinrich Pohl hält endlich inne.
»Okay, ich habe immerhin Bier. Alles andere wird sich finden, bestimmt.« Er ist sich sicher. Ziemlich sicher.
Ziemlich meint nicht gänzlich.
*
Bei jedem Blitz erstrahlt der Horizont in dunklem Blau. Der Regen hat aufgehört. Die Nacht begonnen. Ein Gewitter rast in weiter Entfernung über den Ozean. Im Abstand vieler Sekunden zerreißt ein fernes Donnern die Stille und erhellt am Ende von Heinrich Pohls Blickfeld das Firmament. Dort sind dunkle, massive Quellwolken zu bizarren Türmen aufgebaut, durch die sich die grellen Blitzstrahlen für einen Sekundenbruchteil schieben. Wenn das dumpfe Grollen folgt, hat sich die pechschwarze Dunkelheit bereits wieder über die Welt gelegt. Das Lama sucht ob des Licht- und Soundspektakels die Nähe der beiden Menschen. Umkreist in sicherem Abstand Heinrich und Clown. Enorm, welches Durchhaltevermögen in dem Lama steckt. Heinrich Pohl verfolgt das Himmelsspektakel träge. Seine Überzeugung, gerettet zu werden, erlebt gerade einen Dämpfer. Er hat Magenschmerzen. Fühlt sich matt und aufgeweicht. Das Meersalz beginnt zu brennen.
Er grübelt.
Was, wenn das Unwetter mich verschluckt? Die Kiste wird mich gewiss nicht schützen. Zu wenig Auftrieb. Zu wenig Oberfläche. Zu wenig Rettungsinsel bei Seegang.
Eine perfide Idee setzt sich in seinem Kopf fest. Die Rettungsweste. Sie könnte seine Überlebenschancen enorm erhöhen. Wer auch immer der Clown sein mag, Heinrich kennt ihn nicht. Bestimmt nicht.
Doch Heinrich zweifelt an seiner eigenen Annahme.
Wahrscheinlicher ist, dass er den Mann durchaus kennt. Irgendein Zusammenhang besteht zwischen ihnen. Aber seine Weste erleichtert nun mal das Treiben auf der Wasseroberfläche. Der Clown muss gehen. Auch wenn sie irgendein unbekanntes Schicksal aneinanderbindet. Hier hält er es mit dem Darwinismus. Jawohl, der Clown muss gehen. So viel steht fest.
Die Weste will er sich später holen. Nur noch kurz ausruhen.
Heinrich Pohl öffnet die erste Bierdose. Über seine Kunststoffkiste gebeugt, nimmt er gierig einen Schluck. Das Bier wirkt beruhigend. Im Hintergrund zerreißt wieder ein Blitz die stille Dunkelheit. Doch er sieht nicht nur das. Aufgeregt reckt er seinen Kopf nach oben. Er sehnt dem nächsten Blitz entgegen, der nicht lange auf sich warten lässt. Er braucht nur Bruchteile von Sekunden, ehe er seinen Blick auf etwas fokussiert. Eine erneute Blitzwelle versichert ihm: ein Schiff.
Am Horizont zieht ein Dampfer oder Kreuzer vorbei. In einer Entfernung, die Heinrich sofort jegliche Hoffnung nimmt. Ein unerreichbares schwarzes Schiff, auf dem Menschen in Zufriedenheit und Gesundheit einem Ziel entgegensteuern. Noch einmal wagt er einen Blick in den sich erhellenden Tunnel, der einem düsteren Gemälde einer Seeschlacht gleicht. Jeder Blitz eine Kanonenzündung. Jeder Donner eine Detonation. Jede Wolkenburg ein Rauchgebilde der Gewehrsalven. Vielleicht ist es aber auch kein Dampfer oder Kreuzer, der sich fernab von Heinrich Pohls wundersamer Wasserung bewegt. Vielleicht ist es ein …
4
Der Antiquitätenladen und der Dreimaster
»… Dreimaster. Von Kapitän Cook. Die Santa Maria?«
»Onkel Wendelin, die Santa Maria war Kolumbus’ Schiff. Cook war auf der Endeavour unterwegs. Zumindest bei seiner ersten Südseereise. Später zählten die HMSAdventure und die Resolution zu seinen Forschungsschiffen.«
»Schlaumeier.«
Onkel Wendelin streicht seinem Neffen über den Kopf. Der inspiziert angestrengt die große Flasche mit dem Buddelschiff. Heute kam eine Lieferung, zu der unter anderem dieses Flaschenschiff gehörte. Herauszufinden, ob das Schiff etwas Bedeutendes oder Wertvolles ist, darin sieht Heinrich seine Bestimmung. Onkel Wendelin ist es offenbar egal, ob es sich um ein Piratenschiff, ein Expeditionsschiff oder einen Mississippi-Dampfer handelt. Das Buddelschiff wird einen neuen Abnehmer finden. Ganz bestimmt. Solche Objekte sind begehrt, wenngleich sie keinen großen Umsatz bringen. Meist sind es Rentner oder Liebhaber maritimer Gegenstände, die sich Buddelschiffe zulegen. Dieses Flaschenschiff, bei dem es sich um die HMSNorthumberland handelt, die Napoleon in sein Exil auf St. Helena brachte, wie Heinrich später herausfindet, geht schließlich an einen Rentner namens Walter Steckmeier, der in den darauffolgenden Jahren immer nur dieses eine Modell kaufen wird. Die HMSNorthumberland. Napoleons letztes Transportschiff. Walter Steckmeier war Geschichtslehrer und hatte für den französischen Feldherrn ein besonderes Faible. Menschen mit besonderen Vorlieben eifern den irrsten Leidenschaften nach. Davon lebt ein Antiquitätenverkäufer.
Onkel Wendelin ist zwischen all dem Krimskrams und den Wertgegenständen des Altwarenladens ein geheimnisvoller Hüter der Gegenstände. Und der Zeit.
Im Besonderen der Zeit des Menschlichen. Der Zeit des Genüsslichen. Der Zeit des sich Entwickelnden. Und des Raumes. Der Hüter des räumlichen Miteinanders. Jeder Dynamik nachforschend, jedes Gegengewicht ausgleichend, wie eine vorausschauende Balanceerhaltung.
Der Duft seines fein-süßlich-herben Tabaks legt sich auf jeden Artikel im Antiquariat. Wie eine mystische Aromaschicht. Neben dem Genusspotenzial hat Wendelin Pohls Pfeifentabakkonsum die fortwährende Symbolhaftigkeit von Wagnis, gleicht den flatternden Segeln aufbruchsbereiter Expeditionsschiffe. Abenteuer hat er genügend gesammelt.
1969 verbrachte Wendelin Pohl als Student der Geisteswissenschaften ein Auslandssemester in Stockholm.
Bei Silvesterfeierlichkeiten am Universitätscampus traf er eine hübsche Musikstudentin. Da er der schwedischen Sprache mächtig war, gelang ihm die Konversation auch außerhalb bestimmter Fachtermini problemlos. Und die Klaviervirtuosin war angetan von der schneidigen und witzigen Art des deutschen Literaturwissenschaftsstudenten. Sie war im Begriff, der blumigen Aufforderung zum Tanz zu folgen, vergaß allerdings, dass damit der Stolz des ihr zur Seite geeilten Freundes ungemütlich gereizt wurde.
»Finger weg, Kerstin ist mein Mädchen«, fegte der junge Schwede dazwischen.
»Ich gratuliere zum Besitz solch überwältigender Schönheit«, kokettierte Wendelin mit einer Chapeau-Geste und fuhr locker fort, »nur stelle ich keine Besitzansprüche, auch keine temporären, sondern würde nur kurz um einen Tanz bitten. Dir gehört Kerstin, mir bleibt der Tanz. Was spricht dagegen?«
Kerstin war von der forschen Gangart des Deutschen beeindruckt, grinste verschämt vor sich hin und blickte ihren Freund von unten herauf an.
»Den Tanz kannst du haben«, erwiderte der Geschasste und krempelte die Ärmel hoch. Wendelin trat schnell einen Schritt zurück und wehrte ab: »Nein, nein, mein Freund, das Zeitalter des Fehdehandschuhs ist vorbei. Wir werden uns gewiss nicht um ein Mädchen prügeln. Im Grunde sehe ich, dass ich zu spät für Kerstin kam. Jedoch, und das möchte ich mir nicht aus dem Kopf schlagen, könnte ich mir vorstellen, dass ich mit dir um einen Tanz eifere. Ohne Fäuste. Einen Wettkampf des körperlosen Sportes könnte ich mir vorstellen. Was könnte dies sein?«
»Eisschnelllauf!«, ertönte es aus den hinteren Reihen des Kreises, der sich um das Trio gebildet hatte. Der Ratschlag kam von Henrik Stromson, Eishockeytrainer der Universitätsmannschaft. Der betagte Hüne packte Kerstins Freund am Genick, ebenso Wendelin.
»Lars, wir werden uns doch nicht von den Deutschen die Weiber ausspannen lassen.« Der eisige Blick des ehemaligen Marineoffiziers verdarb Wendelin nicht die Laune an diesem schönen Silvesterabend.
»Könnte mir jemand mit Schlittschuhen aushelfen?«
Kerstin folgte sichtlich unbehaglich dem grölenden Pulk. Ziel war der zugefrorene Campusgraben, ein Wasserband von einigen Hundert Metern Länge und einer Breite von etwa zehn Metern. Der Himmel ließ Flocken fallen, die wie Lars’ vorweggenommene Siegeskonfetti glitzerten. Der Tross sang schwedische Volkslieder und ließ den jungen Lokalmatador hochleben. Wendelin sang mit, »Lars hier, Lars da!«, hatte nach einigen Strophen und Refrains Melodie und Text intus. Eine wirklich groteske Situation, besang Wendelin den Sieg seines Gegners doch schon vor dem Wettkampf und stellte sich so als potenziell guter Verlierer dar.
Niemand setzte auch nur einen Pfifferling auf Wendelin Pohl, den Studenten aus Deutschland.
Der gefrorene, verschneite Campusgraben wurde freigeschaufelt, Start- und Ziellinie mittels Wollschals gezogen und die Kontrahenten an ihre Positionen befohlen. Lars beugte sich siegessicher zu Wendelin und reichte ihm die Hand.
»Später begießen wir deine Niederlage mit Wodka, mein Freund.« Wendelin griff fest zu.
»Den Wodka wirst du alleine trinken müssen. Später werde ich mit Kerstin tanzen.«
Wendelin Pohl erhaschte ein Lächeln von Kerstin und dachte, vielleicht solle er die Zeit, während der Lars sprintete, nutzen und gleich mit ihr tanzen. Aber die Fairness gebot ein regelkonformes Wettrennen, keine feige Münchhausiade. Der Deutsche würde ehrenhaft verlieren.
»Klara. Ferdiga. Gå!« – Wendelin, der mit den weißen Damenschlittschuhen einer eiskunstlaufenden Bohnenstange namens Linda Wikström ausgestattet worden war, erzeugte durch schnellkräftiges und hochfrequentes Einhacken der Kufenzacken in das Eis einen erstaunlich temporeichen Antritt, der dem Publikum ein verwundertes Raunen entlockte. Die winterlichen Fangspiele auf dem Bröderweiher in frühen Kinderjahren trugen nun Früchte in Form von erstaunlichen Beschleunigungsmaßnahmen.
Das Ganze entbehrte nicht einer gewissen Komik, stand dem athletischen Stemmschritt des geübten Eishockeyspielers der wilde, skippinghafte Sprint eines Amateurs gegenüber, der in Eistanzschuhen steckte.
Der Schwede holte seinen überraschenden Rückstand schnell auf, während der Deutsche in eine Art Gleitphase überwechselte. Als Lars und Wendelin gleichauf waren, zischte der Schwede einige Wortfetzen, die Wendelin noch nie gehört hatte, für deren Bedeutung aber keine Übersetzung nötig war. Wendelin kommentierte die schwedische Provokation mit einem keuchenden »Dansa! Freundchen! Dansa!«
Wendelin, sich nach Leibeskräften mühend, verlor immer mehr den Anschluss, behielt sich jedoch vor, bis zum Schluss das ihm mögliche Höchsttempo zu laufen.
Kerstins Sommersprossen leuchteten durch die Winternacht wie Glühwürmchen, und Wendelin war sich sicher, dass ihre gedrückten Daumen in den roten Wollfäustlingen ihm galten. Und tatsächlich konnte er noch einmal an Tempo zulegen, indem er seinen anfänglichen Antritt imitierte und dem Kontrahenten gefährlich nahe kam. Lars hingegen schien bereits auszutrudeln, winkte locker ins Publikum und deutete siegessicher auf seine Geliebte. Erst da spürte Lars das dampflokhafte Anbrausen des Herausforderers. Als dieser noch ein brüllendes »Dansa!« schmetterte, verkantete Lars vor Schreck seine Kufen und schlug aufs Eis. Aus dem plötzlich verstummten Zuschauermob drang nur ein spitzes, sommersprossiges Lachen, das sogleich wieder erstickte.
Im Moment der Ziellinienüberquerung explodierte der gesamte Campus. Fliegende Pudelmützen kreuzten mannhafte Flüche, Jubelposen standen ungläubigem Staunen gegenüber, Entsetzen reihte sich an Schadenfreude.
Der Deutsche hatte doch tatsächlich das Rennen für sich entschieden. Die Umstände des Sieges wurden nicht diskutiert. Es lag keine Regelwidrigkeit vor. Der Schwede war zu arrogant. Der Deutsche mit den Damenschlittschuhen erstaunlich gewieft – Ende.
Schließlich besannen sich fast alle auf den ursprünglichen Grund der Zusammenkunft des Abends.