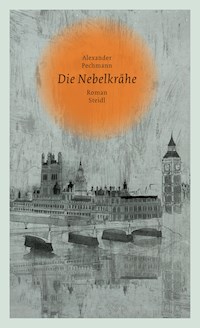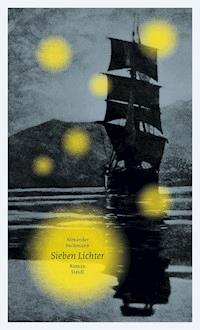Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Juli 1905 reist der Maler Paul Severin nach Königsfeld im Schwarzwald. Ein geheimnisvolles Mädchen stand ihm dort ein Jahr zuvor Modell für eine Reihe phantasievoller Gemälde. Severins Reisebekanntschaft, der englische Journalist und Abenteurer Algernon Blackwood, ist sich sicher, Severins Modell bereits vor zwanzig Jahren getroffen zu haben. Das Mädchen auf den Gemälden scheint keinen Tag gealtert zu sein. Ungläubig lässt sich Severin Blackwoods Geschichte erzählen: Als Internatsschüler erlebte er nachts in den Wäldern etwas Unheimliches, das ihn noch lange beschäftigen sollte. Auch Severin kennt diesen Wald und seine Geheimnisse und berichtet wiederum Blackwood von seiner dramatischen Kindheit und den sonderbaren Begegnungen, die ihn über Karlsruhe und Paris schließlich nach Königsfeld führten. Die beiden Männer beschließen, dem Rätsel gemeinsam auf den Grund zu gehen. Ihre Suche mündet in einem Labyrinth aus halbvergessenen Gerüchten und Legenden. Doch vielleicht ist die Wahrheit noch phantastischer als Märchen und Spukgeschichten aus alter Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AlexanderPechmann
Die zehnteMuse
RomanSteidl
Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er sagte ihnen streng, dass es niemand wissen sollte …
Markus 5, 42-43
I
»Haben Sie je über das Wesen der Zeit nachgedacht?«, sagte der Fremde, als ich geistesabwesend meine Uhr aus der Westentasche zog. Ich sah ihn verdutzt an. Er saß mir direkt gegenüber, aber bislang hatte ich ihm ebenso wenig Beachtung geschenkt wie den anderen Fahrgästen, jener üblichen Mischung aus gutgekleideten Geschäftsleuten und ungeduldigen Touristen im Abteil Erster Klasse der Schwarzwaldbahn. »Ein paar Minuten nach vier«, murmelte ich abweisend und vertiefte mich wieder in meine Zeitung, die freilich nichts Weltbewegendes zu berichten hatte – es sei denn, man interessierte sich für russische Revolutionäre und amerikanische Flugmaschinen.
Er lachte leise. »Ich fürchte, Sie haben mich missverstanden. Mein Deutsch ist wohl ein wenig … wie sagt man … eingerostet?« Seine Aussprache war jedoch tadellos, mit dem angenehmen Akzent eines englischen Kosmopoliten. Ich blickte auf. Der Mann hatte etwas von einem Vagabunden an sich, trotz seiner gepflegten, schlanken Erscheinung. Er trug ein hellbraunes Jackett aus leichtem Sommertweed, ein beiges Hemd, sportliche Kniebundhosen und derbe Wanderschuhe. Seine Augen leuchteten hellblau aus einem sonnengebräunten, glattrasierten Gesicht, das trotz einiger tiefer Furchen merkwürdig alterslos wirkte, wie das eines griechischen Seehelden. Allein wegen seines weitgehend kahlen Schädels schätzte ich ihn auf Mitte vierzig, doch war er, wie sich später herausstellte, wesentlich jünger.
»Entschuldigen Sie. Ich möchte Sie bei Ihrer Lektüre nicht stören.« Er wandte sich ab und sah nachdenklich lächelnd aus dem Zugfenster. Die Landschaft war seit dem letzten Bahnhof rauer und urtümlicher geworden: Nun ratterten und rumpelten wir an tiefen, mit Kiefern und Tannen dicht bewaldeten Schluchten entlang, und lange Tunnel sorgten immer wieder für Finsternis an diesem freundlichen Julitag.
»Sie stören mich keineswegs. Sie wollten wissen, wie spät es ist?«
Ahnte er, dass ich ihn anfangs völlig richtig verstanden hatte? Er ließ sich nichts anmerken und schüttelte lediglich den Kopf. »Ich bin diese Strecke schon einmal gefahren. Zwanzig Jahre ist es her, doch mir kommt es vor, als wären seitdem nur ein paar Wochen oder Tage vergangen. Unser Zeitgefühl ist so trügerisch, nicht wahr? Die Frage ist, ob wir uns selbst betrügen oder ob die Zeit uns zum Narren hält.«
Ich faltete die Zeitung zusammen und legte sie auf den leeren Sitz neben mir. Die Worte des Fremden machten mich neugierig genug, um den Gesprächsfaden aufzugreifen, auch wenn ich insgeheim befürchtete, dass er einer dieser aufdringlichen Schwätzer war, die einem die schönste Reise verderben können.
»Die Zeit hält uns zum Narren? Ist es nicht ziemlich abwegig, anzunehmen, dass sie eine bestimmte Absicht verfolgt?«
Seine Augen leuchteten belustigt auf. Er dachte wohl, ich hätte den Köder geschluckt und sei bereit für seine tiefsinnigen Spekulationen. »Abwegig nur für einen Materialisten, für den Zeit nicht mehr ist als das Rieseln der Körnchen durch eine Sanduhr – das Verstreichen von Minuten, Stunden, Monaten, Jahren. Wir Träumer können uns die Zeit auch als etwas Lebendiges vorstellen, als spielenden Knaben wie Aion oder als unbarmherzige Gottheiten wie Chronos, Thot, Zurvan und viele andere. Haben Sie die Bhagavad Gita gelesen?«
»Nein.« Ich wunderte mich ein wenig, da er es offenbar als selbstverständlich betrachtete, dass ich kein unverbesserlicher Materialist, sondern auf seiner Seite war. Ob ich das auch sein wollte, stand auf einem anderen Blatt, obwohl das Spiel der Nächte zweifellos einen großen Einfluss auf meine Arbeit und mein Leben ausübte. In meiner Jugend hatte ich einen Blick auf die heiligen Schriften der Hindus geworfen, aber keinen Zugang gefunden und mich bald anderen, weitaus seltsameren Lehren zugewandt.
Der Fremde schloss die Augen und zitierte aus dem Gedächtnis: »Ich bin die Zeit, die Weltzerstörerin, vernichtend jedes menschliche Geschlecht.« Er schwieg, blinzelte und sah mich prüfend an. »Die Macht über die Zeit wird selten einer liebenswürdigen Gottheit zugeschrieben.«
»Vielleicht, weil sie jedem von uns den Tod bringt«, sagte ich und wich seinem durchdringenden Blick aus.
»Den Tod, aber auch das Leben. Den Winter, aber auch den Frühling. Dass Sie zuerst an den Tod denken, überrascht mich allerdings nicht, nachdem ich Ihre letzten Werke gesehen habe.« Seine Stimme klang plötzlich kalt, wie die eines Richters, der sein Urteil verkündet.
»Sie kennen meine Bilder? Sie wissen, wer ich bin?« Ich spürte ein leises Unbehagen. Es kam nur selten vor, dass jemand mich außerhalb der Galerien und öffentlichen Veranstaltungen auf meine Arbeit ansprach. Unter den Meistern meines Fachs galt ich nur als kleines Licht mit allzu großen Ambitionen.
»Keine Angst, Herr Severin, ich bin kein Kunstkritiker. Eigentlich verstehe ich wenig von Kunst und würde mir nie anmaßen, Ihnen oder irgendwem meine persönliche Meinung aufzudrängen. Ich habe zwei oder drei Ihrer neueren Gemälde in einer kleinen Galerie in London gesehen. Genauer gesagt, ich habe die Vernissage besucht. Wir wurden einander aber nicht vorgestellt. Umso mehr freut es mich, Sie hier wiederzusehen. Mein Name ist Algernon Blackwood.«
Er streckte die Hand aus und ich ergriff sie zögernd. Den Namen hörte ich zum ersten Mal. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Blackwood. Besonders, da Sie kein Kritiker sind. Wenn Sie zugeben, wenig von Kunst zu verstehen, sind Sie ganz bestimmt keiner.«
Er lachte höflich. »Ja, mein Interesse ist eher privater Natur. Ich war fasziniert von einigen Ihrer Motive, da sie mich an längst vergangene Ereignisse und altbekannte Gesichter erinnerten. Diese Bilder, die auf den ersten Blick so phantastisch und gespenstisch erscheinen, zeigen Orte, die mir aus meiner Kindheit vertraut sind.«
Ich wusste sofort, welche meiner Bilder er meinte, und es verblüffte mich, dass irgendein Fremder einen so persönlichen Bezug dazu haben konnte. Plötzlich hielt ich es für möglich, dass er unsere Begegnung sorgfältig geplant hatte. Welche Absicht dahinterstecken mochte, konnte ich mir jedoch beim besten Willen nicht erklären. Eigentlich verdiente ich mein Geld mit Porträts von Wichtigtuern, Egomanen, Geizhälsen und Heuchlern, die sich überaus dankbar zeigten, wenn ich die Nachwelt schamlos belog und sie als bescheiden, gütig, großzügig und fromm darstellte. Natürlich malte ich auch Landschaften im klassischen Stil, die sich ganz gut verkauften, wenn ich nicht allzu übermütig mit Licht und Farben spielte. Mein Herz hing jedoch an den verrückten, von Träumen und Haschischvisionen inspirierten Arbeiten, die meine Vorliebe für Märchen, Aberglauben und rätselhafte Symbole reflektierten.
»Ich hatte tatsächlich das Glück, ein paar Kleinigkeiten in London ausstellen zu dürfen. Einige habe ich letztes Jahr hier in der Gegend gemalt. Ich verbringe den Sommer immer im Schwarzwald, streife umher und sammle allerlei Kuriositäten. Es gibt hier einige Plätze, die ich besonders liebe, und oft höre ich sonderbare Geschichten von den alten Bauern, Handwerkern und Fuhrmännern. Vieles davon lasse ich auf die eine oder andere Weise in meine Skizzen einfließen.«
Blackwood nickte. »Für jemanden, der nicht mit dem alten Wissen vertraut ist, sind die Bilder wohl schwer zu verstehen. Sie wirken auf mich wie verschlüsselte Botschaften aus einer anderen Welt, in der die kindliche Wahrnehmung nicht infrage gestellt wird. Da sieht man Bäume, denen Blut aus abscheulichen Spalten in der Rinde quillt. Einen toten Zeisig auf der flachen Hand eines Mädchens, und dasselbe Mädchen in der Pose einer Hohenpriesterin im Wasser eines Teichs zwischen Seerosen stehend. Als wäre die arme Ophelia von Millais von den Toten auferstanden.«
»Der Vergleich ist allzu schmeichelhaft, auch wenn ich eigentlich eine heidnische Version von Delaroches La Jeune Martyre im Sinn hatte … die Verbindung von Schönheit, Unschuld und Tod … und dann die Auferstehung als erotische Phantasie. Mein Bild ist allerdings völlig misslungen. Immer, wenn ich es mir ansehe, spüre ich, dass etwas falsch ist und dass ich es vernichten und noch einmal ganz neu anfangen muss. Es ist schlecht, verdammt schlecht!« Blackwood musterte mich erstaunt. Ich hatte in einem ziemlich schroffen Ton geantwortet und wütend auf eine harmlose Andeutung reagiert, aber er konnte nicht ahnen, was mich dazu bewegt hatte, dieses Motiv zu wählen, und was für Gefühle jeden Pinselstrich geführt hatten. Meine Hände zitterten, als ich daran dachte.
»Soweit ich mich erinnere, sorgte gerade dieses Werk in London für Gesprächsstoff. Es war das sinnlichste der ganzen Ausstellung. Hätte man es aus dem Saal entfernt, wäre sozusagen das Licht ausgegangen und alle anderen Bilder wären in der Dunkelheit verschwunden. Es hatte eine besondere Wirkung auf den Raum, auf die Umgebung und auf die Besucher der Galerie. Ganz erstaunlich!«
Ich schwieg einen Moment lang, denn ich hatte das Gefühl, dass er nicht meine Arbeit loben, sondern mich eher herausfordern wollte. »Nun ja«, antwortete ich schließlich, »ein gelungenes Kunstwerk, ganz gleich, ob es sich um ein Bild, eine Symphonie oder einen literarischen Text handelt, ist wie die Tür zu einem großen Haus. Man sollte sie öffnen und das Haus betreten können.«
Der Zug war unterdessen durch den letzten Tunnel der Strecke gerattert und hatte am Bahnhof von St. Georgen Halt gemacht, einem schläfrigen Städtchen am Hang eines steilen Hügels. Nun ließ die schwarze Dampflok ein übermütiges Pfeifen hören und fuhr hinaus in eine offenere Landschaft aus hellgrünen Sommerwiesen und Feldern, die den dunklen, manchmal bedrohlich finsteren Wald in den Hintergrund drängten.
»Ich muss an der nächsten Station raus«, sagte ich und begann meine Siebensachen zusammenzukramen. »Fahren Sie weiter?«
»Sind wir denn schon in Peterzell?«, fragte Blackwood zerstreut. »Ich war so lange nicht mehr hier.«
»Ja. Ich steige aus und nehme dann den Omnibus nach Königsfeld. Der Zug hält in ein, zwei Minuten.«
Blackwood warf mir erneut einen rätselhaften Blick zu. »Wunderbar, dann haben wir denselben Weg«, sagte er.
»Schön«, knurrte ich unverbindlich, als der Zug mit einem metallischen Kreischen abbremste und vor einem schmucklosen, zweistöckigen Gebäude mit steilem Schieferdach stehenblieb. Kurz darauf traten wir nacheinander auf den staubigen Bahnsteig in die gleißende Nachmittagssonne. Die Bahnhofsuhr war offenbar defekt, denn die Zeiger standen reglos auf sieben vor zwölf. Blackwood machte mich darauf aufmerksam. »Eine angemessene Begrüßung«, sagte er mit unergründlicher Miene.
II
Ich atmete tief durch nach den vielen Stunden, die ich in der abgestandenen Luft des Eisenbahnwagens verbracht hatte. Mein Nacken fühlte sich steif und verkrampft an, als ich mich nach dem Pferdeomnibus umsah, der auf dem Bahnhofsvorplatz auf die Fahrgäste wartete. Der Anblick der erschöpft wirkenden Pferde verlockte mich ebenso wenig wie das Gedränge rund um das dunkelgrün lackierte, klapprig aussehende Gefährt mit den Aufschriften KÖNIGSFELD und IRION auf der Rückseite. Ein paar Kurgäste, die nicht nur den Arbeitsalltag, sondern auch Höflichkeit und Zurückhaltung zu Hause gelassen hatten, schienen es sehr eilig zu haben, ihr Gepäck unterzubringen, und beschimpften den schnauzbärtigen Kutscher, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und achselzuckend seine Zigarette zu Ende rauchte.
»Damals, im Mai 1885, wartete eine kleinere Kutsche auf mich«, sagte Blackwood. Er hatte seinen Rucksack geschultert und stützte sich auf einen Wanderstock mit dickem Knauf. »Ich erinnere mich noch gut an den alten Kutscher, der diesem recht ähnlich sah. Er fuhr mehrmals am Tag zwischen der Poststation dort drüben am Gasthof Schoren und dem Dorf hin und her, und als er merkte, dass ich kaum Deutsch verstand, versuchte er mir mit ein paar aufgeschnappten Brocken Englisch die Geschichte der Schorenwirtin zu erzählen, die angeblich einen Bund mit dem Teufel geschlossen hatte. Devil! You know. Devil? Buuuh! Und er blähte die Wangen auf, bis er rot anlief, während er die Hände mit ausgestreckten Zeigefingern an die Schläfen hielt. Ich verstand nur, dass er mir einen Schrecken einjagen wollte, und hielt ihn für verrückt.«
Ich lächelte, als ich mir die Szene vorstellte. Die alte Sage über den schändlichen Teufel aus der längst verfallenen Roten Mühle und die heilkundige Wirtin war mir vertraut, und ich hatte mich schon immer gewundert, warum das Wissen um die Wirkung von Kräutern und Wurzeln hierzulande stets mit Hexerei und Teufelsspuk in Verbindung gebracht wurde.
»Wollen Sie wirklich den Omnibus nach Königsfeld nehmen?«, fragte Blackwood mit einem verächtlichen Unterton. »Ich gehe lieber zu Fuß. Es sind ja nur drei, vier Kilometer.«
Auch mir gefiel die Vorstellung nicht, mich nach der langen Zugfahrt erneut in ein überfülltes, von der Sonne aufgeheiztes Fahrzeug zu zwängen. »Sie haben recht. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Ich lasse mein Gepäck später vom Bahnhof abholen.« Neben einer kleinen Reisetasche hatte ich noch eine Staffelei, einen Klappstuhl und andere Utensilien dabei, die ich zum Arbeiten brauchte. Blackwood nickte zufrieden, und nachdem wir alles geklärt und unsere Habseligkeiten im Bahnhofsgebäude untergebracht hatten, gingen wir zum alten Gasthof Schoren am Waldrand, um von dort aus der Straße nach Königsfeld zu folgen.
»Schön, dass Sie mich begleiten«, sagte der Engländer. »Ich hätte damals in London allzu gern mit Ihnen gesprochen, und dass sich jetzt unverhofft eine Gelegenheit bietet, ist einfach wunderbar. Ihre Bilder haben mich sehr beeindruckt. Ich habe Ihnen geschrieben, um mehr über Sie und Ihr Modell zu erfahren, aber der Brief scheint nie angekommen zu sein.«
»Wussten Sie, dass ich nach Königsfeld fahre? Verdammt, was wollen Sie eigentlich von mir? Sind Sie mir etwa gefolgt?« Sein Anliegen und seine Beharrlichkeit machten mich ebenso misstrauisch wie Lob für Gemälde, die hierzulande, wo die Kunstprofessoren in Karlsruhe und Heidelberg einem altbackenen Naturalismus huldigten, meist Kopfschütteln auslösten.
»Nein, nein. Ich wusste nur, dass es an der Zeit war, zurückzukehren. Es ist eine Art Jahrestag für mich, und ich wollte ein letztes Mal meine alte Schule besuchen. In ein, zwei Tagen reise ich weiter nach Donaueschingen. Ich treffe dort ein paar Freunde, um mit ihnen der Donau von ihrer Quelle bis zur Mündung im Schwarzen Meer zu folgen.« Er erwähnte sein Vorhaben beiläufig, als gehörten solche Abenteuer zu seinem Alltag. Dann lachte er verlegen: »Sie müssen mich für ziemlich exzentrisch halten, aber ich fühle mich unwohl, wenn ich zu lange am selben Ort bleibe. Ich jage meinen Träumen hinterher, dann wieder fliehe ich vor ihnen. Können Sie das verstehen?«
Ich verstand ihn nur zu gut, auch wenn unsere Träume wahrscheinlich sehr verschieden waren. Der dichte Wald, durch den unsere Straße führte, roch würzig nach altem Holz und frischen Tannennadeln. Der Duft erinnerte mich unwillkürlich an einen flüchtigen Moment des Glücks, den ich ein Jahr zuvor erlebt hatte und den ich noch einmal erleben musste, um nicht wahnsinnig zu werden. Darüber wollte ich mit einem Fremden nicht sprechen, also antwortete ich ausweichend: »Sind Sie sicher, dass Sie nichts von Kunst verstehen? Sie reden wie ein Künstler – wie viele Maler, Dichter, Musiker, die ich in meinen Lehrjahren kennenlernen durfte. Damals in Paris.«
Er winkte ab. »Nein, ich habe keine hervorstechenden Talente und meine künstlerischen Ambitionen beschränken sich auf das Verfassen von unvorzeigbaren Gedichten und harmlosen Gespenstergeschichten. Ich habe mich in allen möglichen Berufen versucht und bin auf jede erdenkliche Weise gescheitert. Ich war Redaktionsassistent in Toronto, Journalist in New York, habe eine Molkerei betrieben und ein Hotel geleitet – all das ohne die Begeisterung, die für Erfolg unverzichtbar ist. Meistens verdiene ich mein Geld mit Unterrichts- und Nachhilfestunden in Französisch oder Deutsch, Stenographie oder Violine. Glücklich bin ich, sobald ich meine Koffer packen und weiterziehen kann. Meine Interessen wechseln zu rasch, um sesshaft zu werden.«
»Ich habe im Grunde nur ein einziges Interesse«, gab ich offen zu, doch als ich meine kleine Obsession näher erläutern wollte, ertönte hinter uns das Geklapper des Pferdeomnibusses, der gleich darauf an uns vorbeifuhr und Straßenstaub aufwirbelte.
»Und Ihr Interesse bezieht sich auf die Kunst?«, fragte Blackwood, als wartete er auf eine Offenbarung.
»Irgendwie schon.« Meine allzu kurze Antwort schien ihn zu enttäuschen, doch seine deutlich erkennbare Neugier ließ mich in mein sprichwörtliches Schneckenhaus zurückkriechen. Der Fremde war mir durchaus sympathisch, aber mein uneingeschränktes Vertrauen hatte er nicht gewonnen. »Kunst«, sagte ich schließlich, »ist meistens nichts als gutes, geschicktes Handwerk. Ich bin eigentlich nur ein Handwerker, der gerufen wird, wenn jemand eine leere Wand im Salon und zu viel Geld in der Tasche hat.«
»Dann habe ich mich wohl geirrt, und dieses Mädchen am Teich hat jemand anderer gemalt?« Ich glaubte, einen spöttischen Unterton herauszuhören.
»Nein, nein. Ich hatte ein paar Sommertage lang die Illusion, mehr zu sein als besagter Handwerker. Vorhin sagte ich, ein Kunstwerk sei wie eine Tür, und es war seit jeher mein Wunsch, diese Tür für mich und andere öffnen zu können.«
»Sie haben die Tür für mich geöffnet!«, rief er. »Sie ahnen nicht, wie sehr mich dieses Bild berührt hat. Als ich es zum ersten Mal sah, waren die vergangenen zwanzig Jahre wie ausgelöscht, und ich war wieder ein Junge von sechzehn Jahren, der beginnt, die Welt zu entdecken und die Rätsel des Lebens zu entschlüsseln.«
Ich musterte ihn skeptisch. Er schien es ernst zu meinen. »Wenn ein Bild einem einzigen Betrachter wichtig ist, sollte man zufrieden sein. Als ich Talitha malte, wollte ich nicht nur ihre eigentümliche grobe Schönheit und Natürlichkeit festhalten, sondern auch die unbegreifliche Art, wie sich alles veränderte, wenn sie in der Nähe war. Ihr wildes Lachen, ihr Licht, ihr Feuer, ihr Geheimnis.« Mir wurde klar, dass mir die richtigen Worte fehlten und dass alles, was ich sagte, wie das pathetische Gestammel eines Irren klang. »Besser kann ich es nicht erklären«, murmelte ich verlegen.
»Vielleicht bin ich der Einzige, der Sie versteht.« Blackwood war stehengeblieben. Seine Augen schimmerten. »Ich kenne das Mädchen. Ich kannte sie. Ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Sie war unverwechselbar, und all die Jahre habe ich an sie gedacht. Von ihr geträumt.«
»Sie haben Talitha vor ein paar Jahren getroffen?« Ich zuckte zusammen und starrte ihn ungläubig an.
»Vor genau zwanzig Jahren«, antwortete er leise, fast andächtig. Es dauerte, bis ich die Bedeutung seiner Aussage erfasste. Zwanzig Jahre! Talitha hatte so jung ausgesehen. Sie hatte ganz selbstverständlich von weit zurückliegenden Ereignissen gesprochen, die sie irgendwo aufgeschnappt haben mochte, doch obwohl sie auch mich an jemand anderen erinnert hatte, dürfte ihr wahres Alter höchstens achtzehn oder neunzehn gewesen sein.
»Das kann nicht sein. Unmöglich. Nein, nein, das ist absurd. Die Person, von der ich spreche, war vor zwanzig Jahren wahrscheinlich nicht einmal geboren. Sie haben damals vielleicht jemanden getroffen, der ihr ähnlich sah. Ihre Mutter, ihre ältere Schwester. Oder Ihre Erinnerung spielt Ihnen einen Streich.«
Blackwood nickte. »Maybe … Möglicherweise. Es gibt vermutlich eine rationale Erklärung. Aber tief im Inneren bin ich fest davon überzeugt, dass ich das Mädchen, das Ihnen Modell stand, vor zwanzig Jahren am Donisweiher gesehen habe. Und der Hintergrund Ihres Bildes beweist mir, dass sie es ebendort gemalt haben. Sie haben es mit 1904 datiert. Ich traf dasselbe Mädchen im Sommer 1885.«
»Nein, verdammt, das ist doch grotesk!«, fluchte ich, doch als unsere Blicke sich trafen, blieb seine Miene ernst und vollkommen selbstsicher.
III
Blackwood musste sich irren. Er hatte sich wohl in jungen Jahren in ein Dorfmädchen verliebt und glaubte nun, sie in dem Porträt Talithas wiederzuerkennen. Können wir uns immerzu auf unsere Erinnerung verlassen? Sehen wir die Wirklichkeit oder nur das, was wir sehen wollen? Ich hatte mir oft über diese Fragen Gedanken gemacht, da sie für meine Arbeit überaus wichtig waren. Meine Aufgabe bestand schließlich nicht darin, die Wirklichkeit abzubilden. Mir war viel mehr daran gelegen, die sinnlose Leere des Lebens mit Bedeutung zu füllen. Talithas Porträt hatte ebenso wenig mit der Realität zu tun wie all die Porträts von Bürgermeistern und Brauereibesitzern, die mir zu bescheidenem Wohlstand verholfen hatten. Ich versuchte, dies mit wenigen Worten zu erklären, doch Blackwood schüttelte energisch den Kopf.
»Mag sein, dass Ihr Bild zu einem gewissen Teil das Produkt Ihrer persönlichen Vorstellungskraft ist. Das ändert aber nichts daran, dass ich das Mädchen sofort wiedererkannt habe. Sie nennen es Talitha, ich habe seinen Namen nie erfahren. Ein sonderbarer Name übrigens: Wussten Sie, dass er auf ›Aramäisch‹ ›Mädchen‹ oder ›Lämmchen‹ bedeutet?«
»Eine Aramäerin ist sie wohl kaum. Bei den Protestanten und Herrnhutern ist der Name auch nicht weit verbreitet«, behauptete ich, obwohl ich über Talithas Konfession nur Mutmaßungen anstellen konnte. Ich fürchtete, er würde als Nächstes von mir verlangen, ihn zu ihr zu führen, aber er ging nur nachdenklich weiter und schwieg eine Weile. »Vielleicht ist es besser, wenn ich Ihnen zunächst die ganze Geschichte erzähle«, sagte er dann. Ohne auf meine Antwort zu warten und ohne seine Schritte zu verlangsamen, begann er zu sprechen. Hin und wieder suchte er nach der korrekten deutschen Vokabel oder flocht ein englisches Wort ein, ansonsten bemerkte ich nicht das geringste Zögern, nicht die kleinste Unsicherheit, so dass ich davon ausgehen musste, dass er mir gegenüber völlig aufrichtig war.
Blackwoods Geschichte
Man hat mir zuweilen vorgeworfen, ein Tagträumer zu sein und ein Übermaß an Phantasie zu besitzen, und ich kann es keineswegs leugnen. Wo andere eine alte Mauer sehen, sehe ich die Ruine eines verzauberten Schlosses. Der dunkle Wald, den wir hier durchqueren, mag für seinen Besitzer nichts weiter sein als ein paar Hektar Nutzholz, für mich ist er ein lebendiges, atmendes Labyrinth, in dem sich Wunder und Rätsel verbergen. In einer meiner frühesten Erinnerungen schaue ich aus dem Fenster des Kinderzimmers in Wood Lodge, Shooter’s Hill, im Nordwesten von Kent, unweit der Vororte von London, und sehe das Antlitz Gottes am Himmel. Erfüllt von einer unbegreiflichen Mischung aus Ehrfurcht und Freude rufe ich nach meiner Mutter, um meine Entdeckung mit ihr zu teilen. Sie mustert mich besorgt und hält mir ihre kühle Hand an die Stirn, ehe sie meinem aufgeregten Drängen nachgibt und meinem kleinen Zeigefinger folgend aus dem Fenster schaut. Sie lächelt, und ich bin glücklich über einen seligen Moment aus wortlosem Einverständnis, bis sie sich zu mir herabbeugt und die Illusion zerbricht: »Das ist doch nur ein Ballon, Algie!« Ein Heißluftballon war am Crystal Palace aufgestiegen und flog über die Hügel und Felder von Kent.
Gott war allgegenwärtig in unserem Haushalt, auch wenn mir sein Gesicht nach diesem Zwischenfall weitgehend verborgen blieb. Vater und Mutter waren fromme, engagierte Christen, die religiöse Versammlungen organisierten und Vorträge hielten, um Seeleute und Arbeiter auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Dabei hatte mein Vater selbst erst auf Umwegen zur Religion gefunden. In seiner Jugend galt er als Draufgänger und Frauenheld, als Schurke, der von seinen Freunden am Eton und Trinity College wegen seines tadellosen Aussehens Beauty Blackburn gerufen wurde. Bei Ausbruch des Krimkrieges meldete er sich freiwillig und kehrte wie manch anderer übermütige Abenteurer nervlich zerrüttet und gesundheitlich angeschlagen heim. Doch er sprach kaum über seine Erlebnisse, sondern suchte nach Halt und Sinn in endlosen theologischen Studien und Gesprächen. Regelmäßig besuchte er die Mildmay Conferences in London, die frommen Christen eine Gelegenheit für Austausch und Diskussionen boten und nicht an eine bestimmte Konfession gebunden waren. Über einen Freund, der in denselben Kreisen verkehrte, lernte er meine Mutter kennen, eine junge Witwe aus Aberdeen – eine aristokratische Schönheit mit eiserner Selbstbeherrschung, scharfer Urteilskraft und grimmigem Humor.
Ich war das vierte von fünf Kindern, die aus dieser Verbindung hervorgingen – oder von sieben, zählt man die allerdings wesentlich älteren Sprösslinge ihrer ersten Ehe hinzu. Als ich elf oder zwölf Jahre alt war, lebten wir in Shortlands House, einem großen Herrenhaus in der Nähe von Bromley. Vater ging jeden Morgen zum nahen Bahnhof und nahm den Zug nach London, wo er als hoher Finanzbeamter für das Postamt arbeitete. In allen häuslichen Angelegenheiten und Erziehungsfragen verließ er sich voll und ganz auf Mutter, die mit unnachgiebiger Autorität, aber ebenso viel Herzensgüte über ihr Reich herrschte.
Wir Kinder hatten kaum Möglichkeiten, uns diesem strengen Regiment zwischen Morgenandacht und Abendgebet zu entziehen, doch entwickelte ich eine große Liebe zu den teils verwilderten Gärten von Shortlands House, die meine kindliche Vorstellungskraft fesselten. Es gab dort uralte, knorrige Bäume und kleine, halbverborgene Teiche, die an Bilder von verwunschenen Orten aus Märchenbüchern erinnerten. Hier mochten sich in jedem Winkel Elfen, Nixen und andere Zauberwesen verbergen, die für mich interessantere Spielkameraden darstellten als meine Geschwister Ada, Arthur und Ceci. Nur meine ältere Schwester Beatrice begleitete mich gelegentlich, wenn ich nachts heimlich aus dem Fenster kletterte, über eine Leiter in den Küchengarten gelangte und vorbei an den Rosenhecken und Obstbäumen zu meinem Lieblingsteich lief. Wir hatten ein kleines Boot, mit dem wir über das im Mondlicht schimmernde Wasser glitten. Unter dem Nachthimmel beschworen wir Geister und Dämonen und erschauderten, wenn ein leises Rascheln in den Wipfeln der Bäume oder der schrille Ruf einer Eule auf unsere heidnischen Gebete zu antworten schienen. Beatrice war tagsüber ein allzu braves, langweiliges Mädchen, das Psalmen auswendig aufsagen konnte. Unter den Sternen jedoch verwandelte sie sich in eine andere Person, die eher der mächtigen Fee Morgana als einer Sterblichen glich.
In solchen Nächten dachte ich an all die Menschen, die in ihren stillen Kammern schliefen, und fragte mich, warum sie so gleichgültig blieben, während man hier draußen den Gesängen des Windes lauschen konnte. Ich glaubte dann, dass ich mit diesen Leuten nichts gemein hatte, dass sie einer anderen Spezies angehörten. Nacht und Sterne und Bäume und Wind und Regen bildeten die Welt, in der ich leben wollte. Sie waren lebendig, vertraut, verwandt und berührten mich tief in meiner Seele, während meine schlafenden Eltern und Geschwister nichts mit mir und meiner Wirklichkeit zu tun hatten.
Niemand außer meiner älteren Schwester und einem alten Gärtner, der mich ins Herz geschlossen hatte und morgens die Leiter vor meinem Fenster wegräumte, kannten mein kleines Geheimnis. Das bildete ich mir zumindest ein. Heute gehe ich davon aus, dass meine Mutter über meine nächtlichen Exkursionen sehr wohl Bescheid wusste, sie aber stillschweigend als harmlose Knabenstreiche duldete. Hätte mein Vater davon erfahren, wäre ich wohl nicht um eine kleine Ermahnung herumgekommen. Er hätte die zerlesene Bibel gezückt, die er stets bei sich trug, und einen passenden Vers gefunden, doch härtere Strafen wie Stubenarrest oder gar Ohrfeigen hatte ich nie zu befürchten. Die wären auch gar nicht nötig gewesen, denn der traurige Gesichtsausdruck, mit dem er mir verdeutlichte, wie sehr er über mein Verhalten enttäuscht war, schien mir Strafe genug.
Ich hatte oft den Eindruck, dass mein Verhalten und meine schulischen Leistungen meine Eltern enttäuschten. Anfangs konnte ich noch recht gute Noten in Griechisch, Englisch und Französisch vorweisen, doch muss mich irgendetwas aus dem Gleichgewicht gebracht haben, denn ich begann mich von meinen Mitschülern zu distanzieren und meine Pflichten zu vernachlässigen. Da ich meine Zeit lieber allein in der freien Natur verbrachte und während des Unterrichts von nächtlichen Seen im Mondlicht träumte, sank ich allmählich von einem der Besten meiner Klasse zu einem der Schlechtesten herab. Mein Vater hatte die Entwicklung mit Sorge verfolgt und offenbar Rat bei seinen Bekannten gesucht. Diese hatten ihm ein kleines, abgelegenes Internat der Herrnhuter Brüdergemeine empfohlen, einer religiösen Gemeinschaft, die ganz im Sinne meines pietistischen Elternhauses tätige Nächstenliebe predigte und ihre Missionare bis nach Tibet und Labrador schickte.
Ich stellte mir diese deutsche Schule als halbverfallenes, mittelalterliches Gemäuer vor, in dem alte, graubärtige Männer in braunen Kutten umherschlichen. Es musste inmitten undurchdringlicher, finsterer Waldgebiete liegen – nichts anderes verhieß das Wort »Schwarzwald« –, was mich keineswegs abschreckte. Im Gegenteil: Die Vorstellung, in geheimnisvolle Märchenwälder einzutauchen, gefiel mir so gut, dass ich den Tag der Abreise regelrecht herbeisehnte. Ich war mir sicher, dass ein großes Abenteuer auf mich wartete, und obwohl meine Erwartungen der überspannten Phantasie eines sechzehnjährigen Jungen entsprangen, sollten sie auf ungeahnte Weise übertroffen werden.