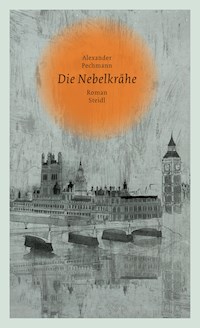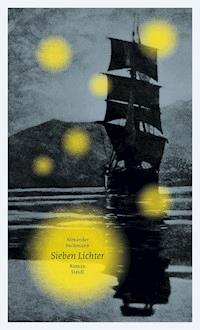Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charles, jüngster Bruder von Jane Austen, fuhr Zeit seines Lebens zur See. Im Frühjahr 1816 erreicht Jane eine schreckliche Nachricht: Kapitän Austens Fregatte Phoenix hat Schiffbruch vor der anatolischen Küste erlitten. Austen reist weiter nach Smyrna, um die Heimreise zu organisieren. Doch die reiche Hafenstadt, in der viele Nationen friedlich zusammenleben, wird von dem zwielichtigen osmanischen Gouverneur Katipzade Mehmed Bey regiert, der sich seit Jahren für die Interessen der britischen Handelsfamilien einsetzt und den Hass des Sultans auf sich zieht. Austen gerät immer tiefer in einen mit allen Mitteln geführten Machtkampf, als ihn die junge Witwe Rachel Löwenthal bittet, ihr dabei zu helfen, das Schicksal ihrer Familie aufzuklären, für das Katipzade verantwortlich sein soll. Die Suche nach Antworten führt Austen und seine neuen Freunde bis in die geheimsten Winkel der Jahrtausende alten Stadt, zu dem melancholischen Orientalisten Otto Friedrich von Richter und der taubstummen Anthoula, zu der geheimnisvollen Sängerin Arevhat, zu griechischen Freiheitskämpfern, Sufi-Meistern und chassidischen Mystikern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Pechmann
IM JAHR DES SCHWARZEN REGENS
Roman Steidl
Reise, o Freund, aus dir selberUnd in dein eigenes Herz.
Rumi
Was vergeht, ist die Zeit, nicht aber die Liebe.
Nizami
ERSTER BRIEF
Chawton, 19. September 1815
Lieber Charles,
dieses kleine Stück Papier ist unweigerlich dazu bestimmt, auf seinem Weg zu Dir mehr Abenteuer zu bestehen als ich in meinem ganzen Leben. Der Brief wird bei Regen und Sturm die Kutsche nach Portsmouth in letzter Minute erreichen. In einem geteerten Postsack gut verstaut muss er Wochen und Monate im Frachtraum eines stolzen Schiffes schmachten, ohne je das weite Meer zu sehen. Der Fels von Gibraltar zieht unerkannt an ihm vorbei. Piraten von der Barbarenküste scheitern bei dem Versuch, ihn zur erbeuten, am Heldenmut unserer englischen Briefträger. Dann endlich erreicht er das Hauptquartier der glorreichen Mittelmeerflotte. Doch die Fregatte, an deren Kommandanten er adressiert ist, hat gerade den Hafen verlassen! Schon verschwinden ihre weißen Segel am Horizont, und die schäumende Gischt ihres Kielwassers löst sich auf in der wogenden See. Halt! Halt! Ein wichtiges Dokument für den Kapitän! Nein, zu spät, er ist außer Hörweite und sein Blick richtet sich kühn auf ferne Ufer.
Vielleicht sollten wir mittels Brieftauben korrespondieren? Das lange, sehr lange Warten auf Nachrichten ist kaum zu ertragen, aber es regt meine Phantasie an und reizt zu geistigen Höhenflügen. Ich sinniere gern über meinem Weltatlas und stelle mir vor, wo die Phoenix gerade ankern oder die Wellen durchpflügen mag. Als unser lieber Frank in See stach, habe ich es ebenso gehalten und mir wilde Seeschlachten, Kanonendonner und einsame Felsküsten vorgestellt, an denen ein armer Schiffbrüchiger strandet, das zerbrochene Steuerruder noch immer fest umklammert. Dann, nach vielen Monaten, kam endlich der heiß ersehnte Brief von ihm. Er war kurz, sehr kurz. Der gute Frank besitzt all die Tugenden, die einen Seemann auszeichnen sollten: Entschlossenheit, Wagemut und gottgefälligen Ernst, doch sein Schreibstil lässt mich verzagen. Füllwörter und Adjektive sind ihm unbekannt. Wäre er Kolumbus, würde er schreiben: »Neue Welt entdeckt. Freue mich auf zu Hause. Grüße an alle.«
Du ahnst bereits, was ich von Dir verlange. »Habe die Wunder des Orients gesehen« reicht mir nicht. Du solltest zumindest hinzufügen: »Sie sind recht prächtig.« Ich erwarte einen ausführlichen Bericht Deiner Erlebnisse. Du weißt, wie sehr ich Deinen Humor und Dein Seemannsgarn schätze. Erzähle mir alles, auch die kleinsten Kleinigkeiten, oder bleib, wo der Pfeffer wächst!
Miss Palmer wird Dir ausführlich über die Kinder schreiben. Wir haben den Tag gemeinsam im Great House verbracht. Sie sind alle wohlauf, die kleinen Schätze, aber sie vermissen ihren Vater sehr.
Genauso wie
Deine Jane
ZWEITER BRIEF
Malta, Mittwoch, 7. März 1816
Liebe Jane,
falls Dich dieser Brief in einigen Wochen erreicht, ist die Welt doch nicht untergegangen. Oder noch nicht. Die Journale, die im Lesesaal des Offizierskasinos von Marsa Muschetto und in den Cafés von Smyrna ausliegen, zumal die französischen, scheinen sich indes mit dem Unausweichlichen abgefunden zu haben. Der Weltuntergang ist ihr liebstes Steckenpferd, und die Vorzeichen sind in der Tat bedrohlich. In Tirol soll roter Schnee gefallen sein. Sterngucker haben einen gewaltigen Sonnenfleck entdeckt, dessen Form einer achtbeinigen Spinne gleicht und der angeblich das baldige Auseinanderbrechen unseres Tagessterns ankündigt. Bei solchen erschreckenden Nachrichten empfinde ich jeden ungetrübten Morgen als Geschenk und freue mich einfach, am Leben zu sein.
Andererseits käme mir eine mittelprächtige Sintflut keineswegs ungelegen, denn ich bin hier weitgehend zum Müßiggang verdammt und warte auf einen äußerst lästigen Termin. Das Militärgericht soll über meine Verantwortung beim bedauerlichen Verlust der Phoenix urteilen. Aber vielleicht sollte man lieber Poseidon vor den Kadi zerren, da er so respektlos mit meiner schönen Fregatte umgesprungen ist. Freilich hatte niemand dem Meeresgott erzählt, wie tapfer sie einst vor Trafalgar kämpfte oder wie fromm unsere abergläubischen Matrosen auf sein Wohl anstießen, wann immer sie leewärts eines Rumfässchens vor Anker gingen. Ihn trifft eigentlich ebenso wenig Schuld wie mich – so viel kann ich Dir verraten, ohne dem Ergebnis der Verhandlung vorgreifen zu wollen. Wie ich Tempo und den Fleiß unserer wackeren Bürokraten kenne, dürfte sie nicht vor Ende April stattfinden, so dass ich Dich, Miss Palmer, Harriet und Cassy kaum vor Juni oder Juli wiedersehen werde.
Wie ich die kleinen Racker vermisse! Sage ihnen, dass ich jeden Tag an sie denke und für sie bete. Die armen Mädchen so kurz nach Fannys Tod allein lassen zu müssen, hat mir mehr Kummer bereitet als alles andere, obwohl ich natürlich wusste, wie gut Miss Palmer für sie sorgt. Aber es herrschte Krieg und ich war tatsächlich überzeugt, einen wichtigen Beitrag zu leisten, als ich das Kommando der Phoenix übernahm. Damals ahnte ich noch nicht, wie viele fruchtlose Monate ich damit zubringen sollte, einem gespenstischen Kriegsschiff der Franzosen nachzujagen, das bis heute nie wieder gesichtet wurde. Unseren letzten Auftrag, die Suche nach griechischen Piraten, die unsere Handelsrouten bedrohen, magst Du Dir als abenteuerlich und heldenhaft vorstellen. Hättest Du jedoch die ein oder zwei abgewrackten Schebecken voll erbärmlicher Hungerleider neben der prächtigen Phoenix gesehen, würdest Du anders darüber denken. Du hättest die räudigen Seeräuber wohl so umstandslos adoptiert wie mutterlose Kätzchen und ihnen zur Stärkung eine Schale frischer Milch hingestellt.
Die Kapitäne der Aquilon, Garland und Reynard müssen sich seit dem Ende des Erzschurken Napoleon ebenfalls mit diesem ungewaschenen Schrecken der sieben Meere herumschlagen. Hier wird buchstäblich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, doch die Ägäis war seit Homers Zeiten nicht mehr so sicher wie heute und wird es vorläufig bleiben – zumindest bis jemand eine angemessenere Betätigung für unsere Mittelmeerflotte findet oder aus Langeweile einen neuen Krieg anzettelt.
Was meine eigene Karriere angeht, will ich mir keine großen Hoffnungen machen. Der Verlust eines Schiffes wiegt schwer, selbst wenn alle Offiziere zu meinen Gunsten aussagen, selbst wenn unser lieber Frank die richtigen Leute kennt und mir mit seinen weitreichenden Beziehungen gewisse Vorteile sichern könnte. Man wird mir nicht allzu bald ein neues Kommando anbieten, nach diesem Vorfall und all den sonderbaren Verwicklungen in Smyrna. Man wird unangenehme Fragen stellen und wissen wollen, ob ich stets bedingungslos die politischen und wirtschaftlichen Interessen des Empire vertreten oder – ohne es zu wollen – den Feinden Seiner Majestät gedient habe. Wüsste ich doch nur eine einfache Antwort! Dann könnte ich mir auf angenehme Weise die Zeit vertreiben, könnte Deinen neuen Roman lesen, der sogar hier auf Malta, meilenweit entfernt von Deinem hübschen, kleinen Walnusstisch, schon eifrig diskutiert wird. Ich könnte mich abends beim Tanz bei den hübschen Malteser Debütantinnen einschmeicheln oder irgendwo am Rande der munteren Gesellschaft eine reifere Dame finden, die ihr beträchtliches Vermögen mitsamt ihrer lückenhaften Tugend einem verwitweten Seemann in mittleren Jahren anvertrauen möchte.
Wäre das nach Deinem Geschmack? Zweifellos, auch wenn Miss Palmer ihr Vorrecht nicht kampflos aufgeben wird! Doch die Geschichte der letzten Tage, die ich unbedingt aufschreiben muss, um herauszufinden, ob ich richtig oder falsch gehandelt habe, dürfte nicht nur heiter ausfallen. Andererseits mag man eine Geschichte über Schiffbruch in einem fremden Land durchaus für erbaulich halten, solange man nicht selbst darin verwickelt ist. Ich bin fast sicher, dass Du und Cassandra so manches darin entdecken werdet, was Euren winterbleichen Wangen ein wenig Farbe verleiht. Doch solange ich mich nicht dafür schämen muss, es in Worte gefasst und niedergeschrieben zu haben, müsst Ihr Euch keineswegs beim Dorfpfarrer von Chawton dafür entschuldigen, unzüchtige Lektüre genossen zu haben.
Verzeih, liebe Schwester, einem alten Seemann seinen Hang zur Übertreibung und seinen Mangel an Zartgefühl! Ich will in den nächsten Tagen und Wochen versuchen, alles so aufzuschreiben und zu erzählen, als würden wir des Abends zu Hause am Kamin sitzen, in der Hand eine Tasse Tee oder besser noch heißen Grog, gewürzt mit Zimt und Nelken. Harriet und Cassy werden es für ein Märchen halten, was es im Grunde auch ist, denn es handelt von einer verzauberten Stadt, in der es nicht mit rechten Dingen zugeht, und von einem Unhold, der die Schätze derjenigen Menschen vermehrt, die ihm ein gottloses Opfer darbringen.
Es beginnt mit einem Sturm.
Gib mir etwas Zeit, dann wirst Du alles erfahren.
Umarme die Kinder für mich und grüße alle sehr herzlich von mir.
Dein Charles
DRITTER BRIEF
Tunis, an Bord der H.M.S. Boyne (98),
21. April 1816
Liebe Jane,
morgen findet die Sitzung des Militärgerichts statt. Eine reine Formalität, sagt man mir, schließlich sei ich nicht der erste Kapitän, der ein Schiff Seiner Majestät verloren hat. Dennoch bin ich so nervös, wie es jeder in meiner Lage wohl sein würde, der nicht über ein Herz aus Stein und eine Leber aus Eisen verfügt. Erinnert sich denn niemand an Admiral John Byng, den man zum Tode verurteilte, weil er eine unzureichende Menge Franzosen niedergemetzelt hat? Ich finde keine Ruhe, und an Schlaf ist nicht zu denken. Du wirst Dich wundern, wie viele graue Haare mir sozusagen über Nacht gewachsen sind, während ich die leeren Stunden dazu nutze, die Messingknöpfe meiner Uniform auf Hochglanz zu polieren. Es ist fast derselbe Aufwand, als müsse man tadellos aufgetakelt vor den Traualtar treten, wo es gilt, ein paar entscheidende Worte zu stammeln, die das künftige Leben machtvoll bestimmen werden. Nur ist es in diesem Fall ein einsamer, freudloser Gang, ohne wartende Braut und ohne Kutsche mit weißen Pferden. Auf mich warten lediglich die steinerne Miene des alten Vizeadmirals sowie die gelangweilten Blicke des Oberkommandierenden der Mittelmeerflotte und seiner Beisitzer mit ihren konservativ gepuderten Perücken, unter denen die Kopfhaut dank der unerträglichen Hitze Nordafrikas schrecklich juckt. Die Verhandlung hätte eigentlich im Hauptquartier der Flotte auf Malta stattfinden sollen, doch Sir Charles Penrose und der Viscount Exmouth sind hier auf dem mächtigen Dreidecker Boyne und stellen gemeinsam mit den Holländern eine Expedition gegen die Barbarenküste zusammen, an der auch die Phoenix beteiligt gewesen wäre.
Da ich nicht weiß, wie lange ich aufgehalten werde, schicke ich Dir mit diesem Brief ein Manuskript, das ich in den letzten Wochen für Dich und die Kinder verfasst habe. Es enthält die Wahrheit über meinen Aufenthalt in Smyrna und alles über meine dortigen Erfahrungen und Erlebnisse. Das Material ist für die Admiralität nicht von Interesse, es handelt sich vielmehr um Aufzeichnungen privater Natur, die weder zu meiner Verteidigung beitragen noch zu meiner Verurteilung führen können. Für mich persönlich sind sie dennoch wichtig, denn sie enthalten viele Fragen, die mich noch lange Zeit verfolgen werden. Für Dich bieten die Seiten vielleicht eine amüsante oder gar lehrreiche Lektüre. Vielleicht gelingt Dir dabei das, was mir bislang nicht gelungen ist: die Knoten zu entwirren und zu erkennen, ob ich den richtigen Weg gewählt habe oder den falschen.
In der Hoffnung,
Dich bald in die Arme schließen zu können,
grüßt Dich herzlichst
Dein Charles
BERICHT
EINIGER DENKWÜRDIGER BEGEBENHEITEN
AN LAND UND AUF SEE,
AUFGEZEICHNET VON
KAPITÄN CHARLES AUSTEN
Von Konstantinopel nach Tschesme
14. bis 20. Februar 1816
Für mich war es ein Segen, Konstantinopel endlich verlassen zu können, diese verwirrende Metropole zwischen Abend- und Morgenland und ihr erstickendes, grellbuntes Getümmel aus bitterem Elend und orientalischer Pracht. Die Reynard, eine wendige kleine Briggschaluppe der Cherokeeklasse mit zehn Geschützen, hatte mir am 14. Februar neben ein paar Briefen aus der Heimat eine Order der Admiralität mitgebracht, ich solle unverzüglich nach Malta zurückkehren, wo man die Phoenix für eine Expedition nach Nordafrika ausrüsten werde. Noch am selben Tag, nachdem die letzten Landgänger zurückgekehrt waren, nahm ich einen türkischen und einen griechischen Lotsen an Bord und gab Befehl, die Anker zu lichten. Unsere Segel wölbten sich in einer günstigen Brise, und die langen, schwarzgrünen Wogen des Bosporus trugen Kämme aus weißer Gischt, als wir, dichtauf gefolgt von der Reynard, den geschäftigen Hafen verließen. Ich warf einen letzten Blick auf das alte Stambul, den gewaltigen Moloch aus dunkelroten Gebäuden, engen, unübersichtlichen Gassen, zahllosen Moscheen mit säulenartigen Minaretten und Kuppeln samt goldener Kugel und Halbmond. Die schwarzen Kaike der türkischen Händler, die alle einlaufenden Schiffe umringten und lautstark ihre Waren, Geflügel in Weidenkörben, frisches Fladenbrot, Obst und Gemüse oder Transportmöglichkeiten anpriesen, fielen ab, um sich neue, willigere Opfer zu suchen. Wir segelten am wuchtigen Leanderturm vorbei, den die Türken »Mädchenturm« nennen, weil irgendein Sultan dort seine Tochter einsperrte, um sie vor Unheil zu schützen – was unweigerlich zu neuem Unheil führen musste. Zur Linken lagen nun Galata und Pera, die wir bald hinter uns ließen, zur Rechten kam die Festung der Sieben Türme in Sicht, dann die weit verstreuten Zypressenhaine des muslimischen Friedhofs. Die Strömung führte uns geradewegs zu den Prinzeninseln mit ihren uralten Klöstern und baufälligen Palästen, und wir hielten Kurs auf die Dardanellen, um das Thrakische Meer zu erreichen.
Das Wetter hatte in den vergangenen Wochen merkwürdige Kapriolen geschlagen, über die auch die ältesten und erfahrensten unter meinen Matrosen stirnrunzelnd den Kopf schüttelten. Im Hafen hatten wir einige kurze, heftige Gewitter und plötzliche Hagelschauer miterlebt, die für diese Region und diese Jahreszeit ungewöhnlich waren. Der Wind drehte häufiger, als ich es je in diesen Breiten erlebt hatte, und unser etwas übergebildeter Schiffsarzt Dr. Keenan, ein junger Oxford-Mann mit irischen Wurzeln, der seine Kammer für naturwissenschaftliche Experimente und Untersuchungen nutzte, meinte, der Regen, der unsere Decks nicht sauber wusch, sondern mit einer rußigen Substanz beschmutzte, enthalte außergewöhnlich viele Aschepartikel, die von einem größeren Vulkanausbruch zeugen mochten.
»Der Vesuv?«, fragte ich und dachte an Pompeji, die verschüttete Stadt, die wir gemeinsam besucht hatten, als die Phoenix in Neapel vor Anker lag. »Womöglich«, antwortete der kleine, korpulente Doktor ausweichend und blinzelte nervös hinter seinen Augengläsern, als wollte er eine schlechte Nachricht für sich behalten. Für einen Iren war er ungewöhnlich einsilbig und zurückhaltend. Ich nahm es auf die leichte Schulter und bedrängte ihn nicht länger. Ein Schiff auf hoher See schien mir ein sicherer Aufenthaltsort während eines Vulkanausbruchs zu sein, und ich genoss es viel zu sehr, das rhythmische Schlagen der Wellen gegen den Bug zu vernehmen und die hochfliegende Gischt auf den Wangen zu spüren, während über mir die Takelage in der stärker werdenden Brise ächzte und stöhnte.
Die gemeinen Matrosen, sogar jene, die den Dienst in der Royal Navy nicht ganz freiwillig angetreten hatten, schienen dieselbe Erleichterung zu empfinden wie ich, folgten ohne zu murren den Befehlen meiner Offiziere und packten tüchtig an, wenn es galt, die Rahen zu brassen oder die Schoten zu kürzen. Die Bewegungen dieser Männer, die in Gruppen von zehn oder zwölf an den Tauen zogen, wirkten so kraftvoll und zuversichtlich, dass sie den mächtigen Zweidecker mit seinem Herz aus Eichenholz und seinen Schwingen aus weißer Leinwand regelrecht zum Leben erweckten und in ein atmendes Wesen zwischen Himmel und Meer verwandelten.
Ich dachte zurück an die Jahre, die ich mit Fanny und den Kindern auf der Namur verbracht hatte, einer zum Wachschiff degradierten Fregatte dritter Klasse mit 74 Geschützen, die an der Mündung der Themse, vor einer schäbigen kleinen Ortschaft namens Sheerness, vor Anker lag. Meine nicht sonderlich heldische Aufgabe bestand allein darin, frisch angeheuerte oder auch in den Dienst gepresste Seeleute zu registrieren und auf die Linienschiffe der Navy zu verteilen. Im Winter war es so klamm und feucht an Bord, dass ich meine Familie in dem tristen Städtchen unterbringen musste, doch in den Sommermonaten durften meine Frau und die Kleinen bei mir bleiben, und ich genoss einige glückliche Tage, in denen ich fast vergaß, dass wir im Krieg waren und mein Bruder Frank irgendwo dort draußen unermüdlich Ruhm, Ehre und Prisengelder einstrich, während ich ein schlecht bezahlter Beamter auf einem morschen alten Pott war, der nur noch in seinen Träumen unter Vollzeug in die Ferne segelte.
»Du liebst das Meer, Charles«, sagte Fanny einmal, als ich abends an der Reling lehnte, meine Pfeife rauchte und wehmütig das Spiel der Wellen beobachtete. »Du liebst es mehr als mich, mehr als die Kinder, mehr als deine Brüder und Schwestern. Wenn du die Wahl hättest zwischen einer Liebesnacht mit der schönsten Frau auf Erden und einer einsamen Hundswache unter dem Sternbild Orion auf hoher See, fernab vom Land, mit zähem Pökelfleisch und wurmstichigem Zwieback als Verpflegung und brackigem Wasser, um den scheußlichen Fraß runterzuspülen … Wofür würdest du dich entscheiden?«
»Oh, das ist eine schwierige Frage!«, antwortete ich scherzhaft, doch sie überhörte den ironischen Unterton.
»Schwierig? Herrgott, du bist ein unverbesserlicher alter Griesgram!« Sie wandte sich ab und verschränkte die Arme. Als ich nicht darauf reagierte, kam sie wieder näher, schmiegte sich an mich und legte ihren Kopf mit den duftenden schwarzen Locken auf meine Schulter. »Sag mir, was du siehst«, drängte sie. »Was ist dort draußen, das deine Blicke so magisch anzieht?«
»Sag du es mir.«
»Nun, ich sehe Wasser. Jede Menge Wasser. Verflixt, bei all dem stinkenden Unrat, den die Themse ins Meer spült, ist es wahrscheinlich eine äußerst schmutzige Brühe.«
Kurz hatte ich das Gefühl, ich könnte ihr die richtige Antwort geben. Eine, die mich zufriedenstellte und sie glücklich machte und darüber hinaus so viel Wahrheit enthielt, wie es ein menschliches Wesen ertragen konnte. Es lag mir auf der Zunge, hatte sich aber im Nu zu einer schmerzhaften Wortlosigkeit aufgelöst. So versuchte ich es erneut mit einem Scherz: »Ich liebe den Anblick barbusiger Meerjungfrauen am frühen Abend.«
Darüber musste sie lächeln. »Und ich hätte nichts dagegen, wenn du mich ebenso sehnsüchtig ansehen würdest. Obwohl … bringt es nicht Unglück, eine Frau an Bord zu haben?«
»Ich habe mich immer schon über diesen seltsamen Aberglauben gewundert. Es gibt jedoch einen anderen, der mir weitaus besser gefällt und nach dem eine Frau den aufgewühlten Ozean beruhigen kann, indem sie ihre Brust entblößt. Das ist auch der Grund, warum weibliche Galeonsfiguren meist einen nackten Oberkörper zeigen. Sie lindern den Sturm und sorgen für gute Fahrt.«
»Ich hätte eher vermutet, dass sie den Sturm entfesseln«, erwiderte Fanny mit vergnügt blitzenden Augen. So, genau so hätte ich sie gern in Erinnerung behalten: das lebenslustige, lebenshungrige Mädchen, in dessen glockenhelles Lachen ich mich auf Bermuda Hals über Kopf verliebt hatte. Doch als sie rund vierzehn Monate nach unserem Gespräch auf der Namur hoffnungslos und fiebrig zu mir aufblickte, während ich ihre Hand hielt und keinerlei tröstende Worte für sie fand, stellte sie mir dieselbe Frage: »Du hast immer nur das Meer geliebt, Charles, nicht wahr?«
»Nein«, sagte ich zu der Sterbenden, die mit jedem Wort, das sie flüsterte, ein Stück ihrer Seele verlor. »Nein, gewiss nicht, Liebste.« Dabei fragte ich mich unwillkürlich, ob das wirklich der Wahrheit entsprach oder ob ich Fanny und mich selbst belog.
Am 19. Februar befanden wir uns einige Meilen vor der Bucht von Smyrna, und man sah durch den Schleier des Nieselregens in der Ferne die dunklen Gipfel dreier Berge aufragen, von denen einer der berühmte Pagos sein musste – ein legendärer Ort der Dichter und Propheten, wo in grauer Vorzeit Amazonen ihre Stadt gegründet und ein Feldherr Alexanders des Großen eine Festung gebaut hatte. Das Wetter war seit unserer Abfahrt wechselhaft und stürmisch geblieben, der Wind wehte stetig aus Südwest, so dass wir lavieren mussten, um weiter nach Süden voranzukommen. Sinnvoller wäre es wohl gewesen, die Bucht anzusteuern und auf besseres Wetter zu warten. Dies war zumindest der Vorschlag des griechischen Lotsen, während der türkische es für angebracht hielt, die Strömung zu nutzen, um in die Straße von Chios zu gelangen, wo der geräumige und weniger überlaufene Hafen von Tschesme für ein großes Schiff wie die Phoenix genauso gut, wenn nicht besser geeignet sei. Die beiden stritten in einem unverständlichen Kauderwelsch über die Vor- und Nachteile der beiden Optionen, gerieten in Rage, warfen mit exotischen Schimpfwörtern um sich und hätten wohl auch ihre Dolche aus ihren roten Stoffgürteln gezogen, um den jeweiligen Argumenten Nachdruck zu verleihen, wäre ich nicht mit der ernst gemeinten Drohung dazwischengegangen, die beiden Streithähne notfalls über Bord zu werfen.
Sie beruhigten sich ebenso rasch, wie sie in Wut geraten waren, und lächelten diensteifrig, als wäre nichts geschehen. »Bitte uns zu verzeihen, Kapitän«, sagte der Grieche, »wir sind beste Freunde, fast Brüder, also werden wir uns immer irgendwie einig, auch wenn wir uns hin und wieder in die Haare geraten.«
Die schwierige Entscheidung über unseren Kurs wurde mir schließlich abgenommen, als der Wind plötzlich auf Nord drehte – eine steife Brise der Stärke sieben. Ich ließ die Rahen aufbrassen, Großsegel und Besansegel reffen, und die Matrosen riskierten Leib und Leben, als sie in schwindelnder Höhe die notwendigen Befehle ausführten. Obwohl wir nun weniger Leinwand führten als bei unserer Abfahrt, kamen wir gut voran und würden wohl am frühen Morgen die Insel Chios erreichen, die Homer als schroff oder bergreich bezeichnet. Ich übergab das Kommando an Deck an den Ersten Offizier, Mr. Farnham, ein weit gereister, erfahrener Seemann, der ein paar Brocken Griechisch verstand und deshalb besser mit den eigensinnigen Lotsen umgehen konnte. Dann ging ich nach achtern in die Kapitänskajüte, um eine Kerze für meine kleine Harriet anzuzünden, damit sie daheim ihren fünften Geburtstag nicht ganz ohne ihren Vater feiern musste. Ich sprach ein Gebet für sie und schickte ihr meine Liebe; sie dürfte heftigen Schluckauf bekommen haben, so fest und innig dachte ich an sie.
Die Nacht verbrachte ich schlaflos. Zu viele Dinge gingen mir durch den Kopf, als dass ich mich hätte entspannen können. Ich machte mir keine Sorgen wegen des aufkommenden Sturms, denn ich hatte ein herrliches Schiff und eine tüchtige, eingespielte Crew. Doch die neuen Befehle des Oberkommandierenden deuteten darauf hin, dass ich meine Töchter nicht so bald wiedersehen würde. Stattdessen durfte ich mich wohl mit algerischen Piraten herumschlagen – und falls diese Burschen eine ebenso jämmerliche Figur machten wie ihre griechischen Spießgesellen, wäre die Reise nach Nordafrika nur eine triste Fortsetzung meiner bescheidenen Abenteuer in der Ägäis. Dabei hatte ich mir stets eine anspruchsvolle Mission gewünscht, bei der ich mich als Kommandant auszeichnen könnte, und wäre eigentlich am liebsten mit kühnen Seehelden wie Cook oder Scoresby in unentdeckte Länder aufgebrochen. Irgendwann muss ich dennoch eingeschlafen sein, denn ich sah, wie so oft während der letzten eineinhalb Jahre, Fanny reglos neben meiner Koje stehen, im Arm das Baby, das vierzehn Tage nach ihr gestorben war. Ihr Anblick beunruhigte mich nicht, denn ich stellte mir vor, dass sie auf diese Weise, indem sie fast jede Nacht in meinen Träumen erschien, über mich wachte, als wäre nicht einmal der Tod dazu in der Lage, unsere sorgfältig gespleißten Tauenden zu durchtrennen.
Sie blickte mich ernst an und ihre Lippen bildeten Worte, ohne dass mir ein Laut zu Ohren kam. Ich glaubte, dass sie mir dieselbe Frage wie immer stellte, und da wir im Traum oft bessere Antworten finden als bei wachem Bewusstsein, sagte ich: »Nein, gewiss nicht. Meine Liebe zu dir ist …« Doch der wunderbare Schluss des Satzes kam mir abhanden, als ich unsanft aus dem Schlaf gerissen wurde.
Einer der jungen Kadetten, fast noch ein Kind, rüttelte an meinem Arm, um mich aufzuwecken. »Sir, verzeihen Sie, Sir, Mr. Farnham bittet Sie, unverzüglich an Deck zu kommen, Sir.« Seine Stimme klang merkwürdig schrill.
Da ich eingedenk der wechselhaften Winde und tückischen Riffe nur die Stiefel und den Uniformrock ausgezogen hatte, war ich im Nu bereit, nach dem Rechten zu sehen. Die Phoenix stampfte und rollte heftig, und ich hatte beiläufig bemerkt, dass die Uniform des Kadetten ziemlich durchnässt war. »Wie ist die Lage, Mr. Jenkins?«
»Der Sturm ist noch schlimmer geworden, Sir. Mindestens Stärke neun, hohe Wellen, Gischt und heftiger Regen. Dazu schlechte Sicht, Sir. Es ist noch dunkel, Sir.«
Zwei Minuten später stand ich Halt suchend neben dem Ersten Offizier, dem Steuermann und den beiden Lotsen auf dem gefährlich schwankenden Achterdeck. Es war früh am Morgen, aber stockfinster. Farnham hatte sämtliche Segel einholen lassen, doch heftige Böen ließen das Schiff immer wieder krängen, bis die Rah des Großsegels fast die schäumenden Kämme der schwarzen Wogen berührten, welche tosend über die schräg liegende Bordwand schwappten. Ich musste gegen die entfesselten Naturgewalten anbrüllen.
»Position?«
»Wir sind in der Straße von Chios, die Insel liegt steuerbords, Sir. Die Lotsen meinen, wir könnten den Hafen von Tschesme noch erreichen, ehe die Gewitterfront uns einholt.« Der Steuermann wies nach achtern, wo monströse Blitze den Horizont immer wieder in fahles, gespenstisches Licht tauchten, während die fernen Donnerschläge noch vom Toben der See und vom Heulen des Windes übertönt wurden.
»Sturmsegel setzen! Untermars und Vorstengestag. Kurs zwei Strich backbord, bis Sie die Küste sehen. Lassen Sie sich von den Lotsen einweisen.«
»Aye, Sir!«
Ich starrte mit zusammengekniffenen Augen in die Finsternis, wo sich bereits die Küstenlinie hätte abzeichnen müssen, konnte jedoch nichts erkennen außer einer Wand aus niederprasselndem Regen. Vor fast fünfzig Jahren hatten die Russen in dieser Meerenge die osmanische Flotte in Brand gesteckt, und ich versuchte, mir vorzustellen, wie die lichterloh brennenden, schwerfälligen Galeeren der Türken in einer Sturmnacht wie dieser ausgesehen haben mochten, als sie sich hilflos gegenseitig rammten, ihre Rahen sich hoffnungslos ineinander verhakten und das verheerende Feuer von einem Schiff auf das nächste übersprang.
»Land in Sicht!«, schrie der Wachmatrose im Mastkorb. Nicht, dass ich mehr gesehen hätte als zuvor, aber nun hatte ich das instinktive Gefühl, dass fast unmerkliche Veränderungen des Seegangs und der Atmosphäre, der schwache Geruch frühlingsfeuchten Ackerbodens, die Küste und vorgelagerte Untiefen ankündigten. Wenig später erblickte ich durch das Fernglas die rechteckigen Umrisse der Hafenfestung von Tschesme, denn die Morgendämmerung beendete zögernd die bedrückende Finsternis und verwandelte die Schwärze des Ozeans und des Himmels allmählich in ein dunkles Grau. Nun durfte ich wieder hoffen, dass wir einen sicheren Ankerplatz erreichen würden, wo wir seelenruhig auf das Abflauen des Sturms warten konnten.
Die beiden Lotsen gaben sich redlich Mühe, über die günstigste Stelle in der weiträumigen Bucht einig zu werden. Wir folgten ihren Anweisungen, und bald hieß es beidrehen, Segel einholen und Anker werfen. Gerade noch rechtzeitig, denn inzwischen tobte das Gewitter direkt über uns – Blitz und Donner folgten dicht aufeinander wie eine nicht enden wollende Salve zur Krönung eines größenwahnsinnigen Herrschers. Der Sturm steigerte sich zu einem Orkan, der die Wellen meterhoch auftürmte und auf die Decks der Phoenix herabstürzen ließ. Die fast neunhundert Tonnen schwere Fregatte war nur ein Spielzeug in der Hand der Naturgewalten und wurde trotz der zwei Buganker und des Notankers immer weiter in Richtung Küste geschoben.
Ein mächtiger Blitz traf den Großmast. Auf den ohrenbetäubenden Donner folgte ein erschütternder Knall, als eine brennende Spiere herabstürzte und die beiden Beiboote auf dem Mitteldeck mitsamt der Reling zerschmetterte. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt, aber ich ahnte bereits, dass das Schiff so gut wie verloren war, und dies, obwohl wir gerade den vermeintlich sicheren Hafen erreicht hatten! Kanoniere und Seesoldaten halfen den Matrosen dabei, Taue zu kappen und die Trümmer des Mastes zu beseitigen. Mir war klar, dass ich auch die anderen Masten opfern musste, denn das oberste Gebot lautete nun, die Mannschaft an Land zu bringen und so viel wertvolles Material zu bergen wie möglich. Das konnte nur gelingen, solange der Rumpf unversehrt blieb und nicht auseinanderbrach. Viele Seeleute können nicht schwimmen und verlassen sich lieber auf angeblich wundertätige Tätowierungen an ihren Unterarmen als auf schlichte Leibesübungen.
Im nächsten Moment wirbelte eine heftige Orkanböe die Phoenix herum und drückte sie mit einem Schlag, der durch Mark und Bein ging, auf eine Sandbank, wo sie in Schräglage liegen blieb, während die Brandung mit Fäusten aus weißer Gischt unbarmherzig auf die Bordwand eindrosch.
Der Regen hatte ein wenig nachgelassen, und es herrschte bessere Sicht: Die Stadt und der Hafen mit seinen zahlreichen schaukelnden Fischerbooten lagen keine Meile entfernt. Die Festung zeichnete sich deutlich gegen den grauen Himmel ab, und dahinter sah man eine Anhöhe, auf der mehrere Reihen weiß getünchte Häuser mit roten Ziegeldächern standen. Wir waren noch näher am rettenden Ufer gestrandet, als ich anfangs vermutet hatte, und wenn wir den Fockmast kappten, mochten die Wanten und Spieren den Seeleuten inmitten der Fluten ausreichend Halt geben, bis sie seichteres Wasser erreichten. Ich brüllte die entsprechenden Befehle und achtete darauf, dass die jungen Kadetten und Stewarts als Erste von Bord gingen. Sie kletterten flink wie Affen über die Reling auf die Püttings und von dort auf den gefällten Mast, der im Windschatten des gestrandeten Rumpfes lag und so vor der heftigen Brandung geschützt war. Es folgten langsamer und behäbiger die Marinesoldaten in ihren roten Uniformröcken, mit der Anweisung, ihre Karabiner und militärische Ausrüstung mitzunehmen. Danach kamen die Kanoniere, Lotsen und einfachen Matrosen, die Zimmermänner und Segelmacher, Quartiermeister und Bootsmannsmaate, die Köche und Kombüsengehilfen, die sogar versuchten, einige der panisch flatternden Hühner, die wir in Konstantinopel an Bord genommen hatten, in Sicherheit zu bringen. Die Vollmatrosen, Steuermänner und Offiziere durchkämmten noch einmal die unteren Decks und Quartiere, um nach Verletzten und Hilflosen zu suchen, während der Erste Offizier, der Schiffsarzt und ich die wichtigen Dokumente, Logbücher und Geldmittel aus dem Tresor in der Kapitänskajüte holten und in wasserdichten Mappen verstauten. Unterwegs hatte ich kaum je daran gedacht, aber die Phoenix, die seit September 1814 unter meinem Kommando gesegelt war, glich einem schwimmenden Dorf, das rund zweihundertsiebzig Männern Obdach und Arbeit bot. Nun war sie nur noch ein nutzloses Wrack, das jederzeit zur tödlichen Falle werden konnte, falls eines der tonnenschweren Geschütze sich aus seiner Verankerung löste, falls ein weiterer Blitz die Pulverkammer in Brand setzte oder ein wütender Brecher die solide wirkenden Planken bersten und splittern ließ.
Der Rumpf des Schiffes lag nun so fest auf der Sandbank, dass wir nach Abflauen des Sturms wahrscheinlich zurückkehren konnten, um alles Wichtige und Wertvolle, vielleicht sogar die Kanonen, zu bergen. Fürs Erste musste ich mich damit zufriedengeben und Gott danken, dass niemand unter meinem Kommando ums Leben gekommen war. Ich ging pflichtgemäß als Letzter von Bord. In einem alten Seesack trug ich Admiral Nelson, unseren Schiffskater, den ich mit Müh und Not in das behelfsmäßige Transportmittel bugsiert hatte. Ich hatte ihn an seinem Lieblingsplatz in der Kombüse gefunden und konnte ihn unmöglich hilflos zurücklassen. Mein Schiff musste ich aufgeben, aber zumindest kann ich mit Fug und Recht behaupten, Nelson gerettet zu haben! Es war jedoch gar nicht so einfach, durch das Gewirr aus gekappten Tauen und zersplitterten Rundhölzern voranzukommen, während der Sturmwind blies, die Wellen peitschten und der Kater wütend in dem über meiner Schulter hängenden Seesack zappelte. Ich fiel mehrmals ins Wasser, blieb aber stets in der Nähe des gefällten Masts und spürte bald sandigen Grund unter den Füßen. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichte ich den flachen Strand, wo die arg durchnässte Crew der Phoenix mit bleichen Gesichtern wartete wie eine Schar verlorener Söhne.
Von der Reynard, die uns mit einigem Abstand gefolgt war, hatte ich schon seit geraumer Zeit nichts mehr gesehen. Als ich mich nun umdrehte und auf die weite Bucht hinausschaute, erkannte ich jedoch das Sturmsegel unseres kleineren Begleiters und den hölzernen Fuchs an seinem Bug, der immer wieder kühn aus den Fluten emporstieg.
Tschesme
20. bis 21. Februar 1816
Im Hafen von Tschesme ankerten überwiegend kleine Küstensegler und Fischerboote, die für den Mittelmeerraum typischen dreimastigen Schebecken, neben türkischen Gülets, bauchig und zweimastig, sowie einige wenige arabische Daus und Zanuken. Es war kein bedeutender Handelshafen wie Konstantinopel oder Smyrna, wo Schiffe aus aller Herren Länder einliefen, um die Kostbarkeiten des Orients nach Europa zu bringen, sondern eher ein schläfriges Städtchen, in dem reiche Familien der Metropolen, vorwiegend Türken, Griechen und Levantiner, Sommerresidenzen eingerichtet hatten, um sich in den heißen Monaten von den regelmäßig grassierenden Choleraepidemien fernzuhalten. Die herrschaftlichen Villen, teils regelrechte Paläste, blickten von einer Anhöhe über die Bucht, während am Fuße des Hügels dicht gedrängt die windschiefen Hütten der Fischer und Handwerker neben den schlichten Lagerhäusern der Kaufleute standen. Ich hielt es für das Beste, mich an den Besitzer eines solchen Lagerhauses zu wenden, um meine Mannschaft provisorisch unterzubringen. Zunächst suchte ich nach meinen Lotsen, Mr. Timotheos und Mr. Faruk, die sich an Land als nützlicher erweisen mochten als auf See. Ich entdeckte sie einige Schritte von den anderen Schiffbrüchigen entfernt, wo sie sich mit einer Gruppe Einheimischer unterhielten, die herbeigeeilt waren, um nachzusehen, was die Flut angespült hatte. Vielleicht hatten sie sogar die Absicht, sich das eine oder andere Strandgut unter den Nagel zu reißen.
Die Gruppe, bärtige Fischer in Kalikohemden und vornehm aussehende Männer in aufwendig bestickten Jacken, die sich frühmorgens trotz des abflauenden, aber immer noch steifen Windes herausgewagt hatten, drehte sich sofort zu mir um; zunächst mit ernsten, fragenden Mienen, dann mit breitem Grinsen. Einige lachten sogar. Etwas verwirrt erwiderte ich ihre Blicke, bis mir klar wurde, was sie so maßlos erheiterte. Der schändlich zerzauste Kater, den ich geborgen hatte, lugte missmutig aus dem Seesack hervor. Er klammerte sich an meine Schulter wie Odysseus an das von Poseidon umhergeschleuderte Floß und schien wenig geneigt, sein Refugium freiwillig aufzugeben. An meine kleine Harriet und ihre grenzenlose Tierliebe denkend, beschloss ich, auch für den pelzigen Leichtmatrosen einen sicheren Hafen zu finden.
»Besmele!«, rief Mr. Faruk, der türkische Lotse. »Ihr habt Nelson gerettet. Allah belohnt die Barmherzigen!« Dann stellte er mir eifrig den Mann vor, mit dem er sich gerade unterhalten hatte, ein älterer, in armenischer Tracht gekleideter Herr mit graumeliertem Bart und selbstsicherem, aber keineswegs herrischem Auftreten. »Mr. Curotavich hat uns freundlicherweise seine Hilfe angeboten. Er ist einer der angesehensten Kaufleute der Stadt.«
»Falls Sie ein trockenes Plätzchen für meine Männer haben, bis das Wetter sich beruhigt hat und wir eine Transportmöglichkeit gefunden haben, wäre ich Ihnen überaus dankbar«, sagte ich zu dem Kaufmann. Mir wurde plötzlich bewusst, wie viel Kraft mich die Strapazen der letzten Stunden gekostet hatten. Obwohl die Luft nicht wirklich kalt war, so um die zehn Grad, fror ich erbärmlich und konnte das heftige Zittern meiner Glieder kaum unterdrücken. »Die Royal Navy wird Sie selbstverständlich für alles entschädigen, Sir.«
»Sie und Ihre Offiziere sind in meinem Haus willkommen«, erwiderte Curotavich mit einer angedeuteten Verbeugung und in tadellosem Englisch. »Die Matrosen können wir in einer der Baracken am Hafen unterbringen. Für Verpflegung, Decken und trockene Kleidung soll gesorgt sein. Ich schicke meine Leute los, alles aufzutreiben.« Er winkte einige Männer heran und gab ihnen entsprechende Befehle, während ich die Quartiermeister und ihre Maate zu mir rief. Sie sollten unsere Helfer begleiten und mir nachher Bericht erstatten. Mein Erster Offizier, Mr. Farnham, der Schiffsarzt Dr. Keenan und ich wollten der Einladung des Kaufmanns folgen, während ich die Aufsicht über die Crew dem Zweiten Offizier, Mr. Hood, überlassen würde. Sobald das Nötigste geregelt war, würden wir mit dem Kapitän der Reynard das weitere Vorgehen besprechen. Die Briggschaluppe war viel zu klein, um alle Seeleute aufzunehmen, doch konnte sie dabei helfen, die Ladung der Phoenix zu löschen und die Fregatte abzuwracken, wie es den Vorschriften der Marine entsprach. Der traurige Anblick des mastlosen Rumpfes in der Brandung, ein Leviathan aus englischem Eichenholz, dem man das Herz herausgerissen hatte, weckte mein Schuldbewusstsein: Das Unglück war unter meinem Kommando geschehen – ich hatte versagt, hatte die falschen Entscheidungen getroffen, und musste die Last ganz alleine tragen. Einsamer als ein Kapitän auf hoher See ist nur der Kapitän eines gestrandeten Wracks.
Mr. Curotavichs Haus war nicht ganz so groß wie die Villen der reichsten Handelsfamilien, aber schön gelegen, am Stadtrand, mit ummauertem Obstgarten, dessen Feigen- und Granatapfelbäume so früh im Jahr bereits Knospen trugen. Von der Anhöhe hatte man einen guten Blick auf die Bucht und die Phoenix, deren weit verstreute Trümmer den Strand bedeckten. Abgesehen von einzelnen Böen hatte der Sturm nachgelassen, es regnete nicht mehr, und auf dem Höhepunkt der Ebbe würde man die Fregatte oder das, was von ihr übrig war, gut erreichen können. Um sie vor Plünderern zu schützen, hatte ich den Befehl gegeben, Wachen einzuteilen, denn die Menge der Schaulustigen wuchs stetig.
Dr. Keenan, Mr. Farnham und ich wurden überaus freundlich empfangen. Der ganze Haushalt hatte sich versammelt, die Dienerschaft und drei Generationen aus der Familie unseres Gastgebers – Kinder, Geschwister, Eltern und Schwiegereltern. Die Erwachsenen trugen armenische Kleidung, die wesentlich farbenfroher wirkte als die doch eher triste Mode unserer Breiten: Ich bewunderte die kunstvoll bestickten langen Kleider der Frauen und Mädchen, die bequemen Baumwollhosen und kurzärmeligen Jacken der Männer und Knaben.
Mr. Curotavich sprach als Einziger gut genug Englisch, um sich mit uns unterhalten zu können, und bot uns sogleich an, zunächst in die trockenen Sachen zu schlüpfen, die er uns zur Verfügung stellte – weite Hosen und kragenlose Hemden mit besticktem Saum, Stoffgürtel aus rotem Kaliko und hellbraune, knopflose Jacken mit exotischen Stickereien. Bevor ich mich umzog, nutzte ich die Gelegenheit, um Admiral Nelson an eines der hübschen, dunkelhaarigen Mädchen weiterzureichen, die den Kater so liebevoll in die Arme schloss, dass ich unwillkürlich an Lady Hamilton denken musste, die skandalträchtige Liebschaft unseres berühmtesten Seehelden. »Verwöhnen Sie die alte Teerjacke nicht zu sehr«, sagte ich streng, und der Hausherr übersetzte lächelnd meine Worte. »Er ist an harte Seemannskost gewöhnt und gewiss einer der besten Mäusejäger der Navy.« Aus naheliegenden Gründen verschwieg ich, dass der zähe Bursche sich hauptsächlich von »Millers« ernährt hatte, wie unsere Matrosen die in Bilge und Frachtraum hausenden Ratten zu nennen pflegten. Doch in den Armen der jungen Dame blickte er so selbstzufrieden und überheblich drein, als hätte man ihn mit frischer Sahne großgezogen.
Ich meinerseits war überglücklich, eine Tasse Tee zu bekommen – vorzüglichen Tee übrigens –, und hätte gern den Tag mit dem Austausch von Höflichkeiten und einem gemütlichen Pfeifchen verbracht. Meine Pflichten durfte ich freilich nicht vernachlässigen. Also kehrte ich nach einer erholsamen Stunde schnurstracks zurück in den Hafen, um nachzusehen, wie meine Männer versorgt wurden und ob Kapitän Thompson von der Reynard bereits an Land war. Mit ihm musste ich dringend sprechen, denn es galt, das Oberkommando über das Unglück zu informieren, ein Transportschiff für die Crew anzufordern, die Räumung des Wracks zu organisieren und vieles mehr. Thompson, ein alter Seebär, der schon so manchen Schiffbruch miterlebt hatte, wusste sicher bestens Bescheid, was ich tun und beachten musste, um alles vorbildlich abzuwickeln. Sein guter Rat war mir zu wichtig, um es mir bei Curotavich lange bequem zu machen. Der Kaufmann bestand jedoch darauf, mich persönlich zu den Baracken zu begleiten.
»Wir haben häufig Stürme im Winter und Frühjahr, aber dieser war außergewöhnlich«, bemerkte er unterwegs, während wir vorbei an weiß getünchten Mauern auf einem holprigen Kopfsteinpflaster bergab gingen. »Heute ist es viel zu kalt für Ende Februar.«
»Nach einer guten Tasse Tee und in trockener Kleidung fühlt es sich recht mild an«, erwiderte ich höflich und verschwieg, dass meine Knie immer noch zitterten und ich mir in der orientalischen Tracht lächerlich vorkam.
»Normalerweise haben wir hier recht gleichmäßige Tagestemperaturen von bis zu fünfzehn Grad. Dieses Jahr ist es viel wechselhafter und oft ziemlich kühl. Der Wind dreht häufiger. Ich habe noch nie gesehen, wie ein so großes Schiff wie das Ihre hilflos herumgewirbelt wird.«
»Aber Tschesme wird eigentlich nicht von großen Fregatten angelaufen, nicht wahr?« Ich fragte mich bereits, ob das Militärgericht dies als meinen entscheidenden Fehler werten würde.
»Nein. Eigentlich wäre die Bucht auch für die Kauffahrer der Levant Company und für Linienschiffe geeignet, aber ein Ferman des Sultans verbietet uns den direkten Handel mit dem Ausland. Wir liefern Weizen, Obst und Gemüse nach Chios. Rosinen, Granatäpfel und Feigen bringen wir auf dem Landweg nach Smyrna, wo Engländer, Franzosen, Niederländer, Deutsche und Österreicher ihre Handelsbüros und Gesandtschaften haben.«
»Was ist der Zweck dieses Verbots? Können Sie mir sagen, was dahintersteckt?«, fragte ich neugierig.
Curotavichs Miene verfinsterte sich. »Politik«, sagte er abfällig, als würde er gleich ausspucken. Offensichtlich war es ein heikles Thema.
»Gibt es eine Möglichkeit, rasch Kontakt zum britischen Konsul in Smyrna aufzunehmen?«
»Die Stadt ist nur einen Tagesritt entfernt. Etwa vierzig Meilen. Auf dem Seeweg muss man die Halbinsel umrunden und meist gegen den Wind kreuzen. Das kann zwei, drei Tage dauern.«
Wir erreichten das Lagerhaus am Hafen, das Curotavich zur Verfügung stellte, nach einer guten Viertelstunde. Mein Zweiter Offizier, Mr. Hood, begrüßte uns mit einem wortlosen Nicken. Er wirkte erschöpft und verärgert, was ich als schlechtes Zeichen wertete, denn es brauchte mehr als Sturm und Schiffbruch, um diesen stoischen Burschen aus der Fassung zu bringen. »Kapitän Thompson ist eben eingetroffen, Sir. Er legt sich gerade mit dem Hafenmeister und einem Hauptmann der Janitscharen an. Es geht um die Reynard, die hier angeblich nicht anlegen darf.«
»Der Hafen ist eigentlich für ausländische Schiffe gesperrt«, erklärte der Kaufmann. »Aber da es sich um einen Notfall handelt, dürfte es nicht so schwer sein, sich zu einigen.«
Vor dem Eingangstor der Baracke trafen wir tatsächlich Thompson, der einen finster dreinblickenden Türken mit eindrucksvollem schwarzen Schnurrbart und prächtiger Uniform anbrüllte, während der viel schlichter gekleidete, korpulente Hafenmeister mit roter Weste und einem gleichfarbigen Fez auf dem Kopf ratlos danebenstand. Thompson war ein schmächtiger Kerl mit krummen Beinen, der in seinen Schnallenschuhen, Kniehosen und weißen Strümpfen wie die Karikatur eines cholerischen Marineoffiziers aussah. Er geriet leicht in Zorn – nicht weil er sich wegen jeder Kleinigkeit gekränkt fühlte, sondern weil er ungerecht oder dumm erscheinendes Verhalten als persönliche Beleidigung auffasste. Eigentlich kam ich ganz gut mit ihm zurecht, doch der Janitscharenhauptmann umklammerte bereits den Griff seines Krummsäbels, der vor seiner Brust in einer breit um den Leib gewickelten hellgrünen Seidenschärpe steckte.
»Austen, kommen Sie mal her und hören Sie sich diesen vermaledeiten Unsinn an.« Thompson hatte uns gesehen und winkte mir zu. »Man will unsere Männer ins Meer jagen, nur weil irgendein dummdreister Schreibstubenlümmel in Konstantinopel ein Stück Papier unterzeichnet hat.«