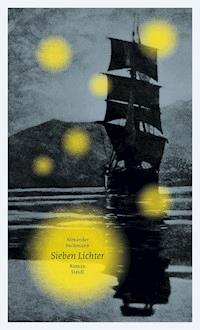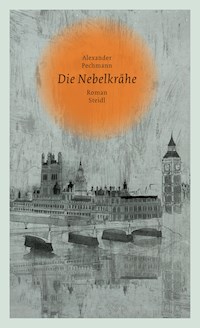
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London im Juni 1923. Peter Vane kann nicht mehr schlafen. Eine unbekannte Stimme raunt ihm immer wieder ein einziges Wort zu: Lily. Doch der junge Kriegsveteran und Mathematikstudent kennt niemanden mit diesem Namen. Nur das Foto eines kleinen Mädchens, das ihm sein verletzter Kamerad Finley im Schützengraben zugesteckt hat, scheint auf merkwürdige Weise mit Lily in Verbindung zu stehen. Finley ist verschollen und um ihn aufzuspüren, sucht Peter trotz aller Zweifel Hilfe bei der berühmten Spiritistin Hester Dowden, die behauptet, mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen zu können. Doch als Peter an einer Séance teilnimmt, spürt er eine ganz andere unheimliche Präsenz: Oscar Wilde, der doch eigentlich seit 23 Jahren tot ist, diktiert ihm seine Gedanken. In der festen Hoffnung, dass alles rational erklärbar sei, versucht Peter mithilfe der exzentrischen Dolly, das Rätsel um Lilys Foto zu lösen, Mrs. Dowden als Betrügerin zu entlarven und seine eigenen Dämonen zu besiegen. Doch je tiefer er in das Geheimnis eindringt, desto deutlicher wird, dass der Schlüssel dazu in seiner eigenen Vergangenheit verborgen liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Berichte, die ich aus dem Jenseits erhalten habe, sind nicht besonders verlockend.Oscar Wilde
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Quellen
Widmung und Dank
Über den Autor
Impressum
I
»Lily?«, wisperte eine unbekannte Stimme nah an meinem Ohr. So nah, dass ich den Atem des Sprechers hätte spüren müssen. »Lily, Lily.« Aufgeschreckt aus dem Schlaf, schlug ich blindlings um mich. Meine geballte Faust traf die Wand neben meinem schmalen Bett. Keuchend sank ich zurück auf das Kissen, riskierte einen Blick in das dämmrige Zimmer und wartete, dass der rasende Puls sich beruhigte. Draußen musste der Tag bereits begonnen haben, denn man hörte durch die geschlossenen Fenster und Jalousien bereits das vertraute Rattern der Räder auf dem Kopfsteinpflaster der trostlosen Euston Road und die groben Rufe der Fuhrmänner und Lieferanten.
Meine schmerzende Hand und die blutigen Knöchel reibend, stand ich langsam auf und suchte nach meiner Brille. Ein Teil von mir schien immer noch nicht ganz wach zu sein und tappte durch ein Labyrinth aus verblassenden Traumbildern. Ich konnte mich jedoch kaum an etwas Greifbares erinnern, nur an das eine Wort. Die Stimme eines ängstlichen Kindes, das nach seiner Mutter verlangt.
Meine bescheidene Unterkunft, eine Dachkammer, hatte kein eigenes Bad. Ich goss Wasser aus dem Krug in die Waschschüssel und wusch mein Gesicht, bevor ich mich ankleidete. Die erfrischende Kälte vertrieb das beschämende Gefühl der Hilflosigkeit, doch ich musste erst Luft und Licht in die Stube lassen, bevor ich einen klaren Gedanken zu fassen vermochte.
Diese Kinderstimme: Sie hatte so fremd geklungen. Das war es, was mich beunruhigte. Ich konnte sie nicht einordnen. Sie hatte nichts gemein mit den üblichen Wachträumen, mit den Empfindungen und Visionen, die immer wieder aus der Tiefe meines Bewusstseins auftauchten wie schillernde Luftbläschen aus einer dunklen Quelle am Meeresgrund.
Meine Vergangenheit blieb in unwillkürlichen Gedankengewittern erschreckend lebendig. Mehr als vier Jahre nach dem Ende des Großen Krieges schien ich nicht ganz in der Gegenwart angekommen zu sein, und manchmal meinte ich, am helllichten Tag die näherkommenden Einschläge, die gebrüllten Befehle der Offiziere und die gemurmelten Gebete der Kameraden zu hören. Ein stechender, säuerlicher Geruch in einer engen Seitengasse konnte mich durch die Zeit zurück in die Gräben der Westfront katapultieren. Ein Gesicht in der Menge verwandelte sich plötzlich in das des hoffnungslos lächelnden Jungen, der mich ansah, um gleich darauf in einer Wolke aus Blut und Dreck zu verschwinden.
»Sie sind nicht der Einzige«, hatte der Arzt gesagt und dabei vielleicht nur auf seine eigenen Sorgen angespielt. Manchmal wirkte er auf mich wie die bloße Hülse eines Mannes, den der Kummer ausgehöhlt hatte. Seine Worte klangen so müde und leer, als würde er sie täglich hundertmal wiederholen, und meine Gedanken schweiften ab, sobald mein Blick auf die zwei schwarz gerahmten Fotografien auf dem Bücherregal hinter ihm fiel. Seine Söhne vermutlich. Die Geschichten werden austauschbar, hat man erst eine Uniform angezogen.
»Ich könnte Ihnen Medikamente verschreiben. Beruhigungsmittel. Schlafmittel. Mein Rat aber ist: Sobald Sie Stimmen hören, lauschen Sie. Antworten Sie meinetwegen. Wenn Sie Bilder sehen, schauen Sie genau hin. Verschließen Sie Ihre Augen nicht vor der Wahrheit, öffnen Sie Ihre Sinne. Nur so lernen Sie, das Unerträgliche zu ertragen.«
Ich glaube nicht, dass er mein Problem wirklich erfasste. Ja, ich hatte Entsetzliches erlebt und getan, und diese Schrecken hatten ihre brennenden Spuren aus Schuld, Reue und Verzweiflung hinterlassen. Da ich gar nicht erst versuchte, es zu verdrängen oder zu leugnen, konnte ich morgens in den Spiegel blicken, ohne den Wunsch zu verspüren, mir eine Kugel in den Schädel zu jagen. Was mir wirklich zu schaffen machte und mich langsam zermürbte, war das scheinbar ewige Fortdauern dieser Episode, mit der ich eigentlich abgeschlossen hatte. Längst hatte ich mir ein neues Leben aufgebaut, studiert, eine Doktorarbeit über Riemann’sche Geometrie begonnen, mich in Fragen vertieft, die nichts mit dem elenden Krieg und seinen Verheerungen zu tun hatten. Doch die Schatten ringsum unterhielten sich weiterhin zwanglos über ihr »Ticket nach Blitey«.
Wir grünen Jungs lernten allmählich die Sprache der altgedienten Soldaten. Einige von ihnen hatten in den Kolonien gekämpft und ein seltsames Kauderwelsch mitgebracht, das sich bald ohne Weiteres mit zufällig aufgeschnappten französischen und flämischen Vokabeln mischte. Das bevorzugte Gesprächsthema der Alten war eben jenes Ticket nach Blitey, die ersehnte Fahrkarte nach Hause, die einem diese oder jene Verwundung bescheren mochte. »Blitey« war angeblich ein indisches oder eher anglo-indisches Wort, das »Heimat« bedeutete. Viel später erfuhr ich, dass es sich um eine Verballhornung von handelte – fremdes Land – England aus der Perspektive der Hindus. Man diskutierte lang und breit, welches Körperteil man für das Privileg einer vorzeitigen Heimkehr opfern wolle, und erzählte grausige Geschichten über Männer, die dem Feind gewinkt hatten, um einen Scharfschützen zu provozieren. Ein Treffer in Arm oder Hand wäre willkommen gewesen, doch für einen Mann ohne Kopf war das Ticket wertlos.
Ich beteiligte mich nicht an solchen Gesprächen. Hätte ich eine Meinung gehabt und sie zum Besten gegeben, hätte wohl niemand sie ernst genommen. Die alten Berufssoldaten hielten mich für unzurechnungsfähig, da ich mich bereits zur Mobilmachung von 1914 freiwillig gemeldet hatte; nicht, weil ich mich nach einem hübschen Grab auf dem Heldenfriedhof sehnte, sondern allein wegen des Versprechens, nach dem Ende des Krieges ein Stipendium am King’s College oder University College zu bekommen. In ihren Augen war das ein absurder Handel. Niemand außer mir schien an ein baldiges Ende des Gemetzels zu glauben und niemandem erschien es sinnvoll, Monate oder Jahre bei schlechter Verpflegung im Dreck zu sitzen und Zielscheibe für die Hunnen zu spielen, nur um danach weitere Monate und Jahre bei ebenso schlechter Verpflegung über verstaubten Büchern zu brüten.
»Professor« nannten sie mich, gutmütig spottend. Sogar die Offiziere riefen »Professor« statt »Private Vane«, wenn sie nach dem Appell Aufgaben verteilten, und ich begann diesen Spitznamen sogar zu mögen. Erinnerte er mich doch stets an meine bescheidenen Hoffnungen, an meinen persönlichen Hauptgewinn in dieser blutigen Lotterie.
Nur Finley sprach mich mit meinem Vornamen an. Für ihn war ich einfach Peter, und er war für mich zuweilen der einzige Grund, warum ich nicht vor Angst den Verstand verlor, mein Lee-Enfield-Gewehr fallen ließ und schreiend die Flucht ergriff wie die Franzosen damals am Chemin des Dames. In seiner Nähe hatte ich immer das abwegige Gefühl, unverletzlich zu sein, als hätte ich ihm unbewusst die Rolle meines Schutzengels zugesprochen. Dabei sah er weder wie ein Engel noch wie ein Beschützer aus. Er war etwas kleiner, aber wesentlich älter als ich, hatte struppiges rotes Haar und ein pockennarbiges Gesicht mit dunklen, oft rettungslos traurigen Augen.
Er hatte sich ebenfalls kurz nach Kriegsbeginn freiwillig gemeldet, doch in seinem Fall kam niemand auf die Idee, sich über seine Motive lustig zu machen. Vermutlich deshalb, weil er sie nicht so unbedarft preisgab wie ich, sondern schulterzuckend, mit versteinerter Miene zu Boden blickte, sobald man ihn danach fragte.
»Ich habe meine Gründe.« Mehr konnte man ihm nicht entlocken, und daraus erwuchs der Nimbus eines vom Schicksal verfolgten Mannes, einer mythischen Gestalt, um deren Seele die Götter würfeln. Dies verschaffte ihm seltsamerweise Respekt, sogar bei den alten Hasen, und zwar viel mehr, als wenn er von patriotischer Pflicht schwadroniert hätte. Sie klopften ihm ernst, fast mitleidig auf die Schulter, wenn er nach einer besonders markigen Ansprache unseres Kompanieführers eine der unsterblichen Weisheiten Samuel Johnsons zitierte: »Patriotismus ist die letzte Zuflucht der Schurken.« Viele der Berufssoldaten waren Patrioten, aber keiner war so naiv zu glauben, dass unser Tod zum ewigen Ruhm des Empires beitragen würde. Jeder von uns und jeder der namenlosen Kerle auf der anderen Seite starb einzig und allein zum Wohl der Schurken, die diesen abscheulichen Krieg angezettelt hatten.
II
Finley erzählte nie von seiner Heimat oder seiner Familie, aber er war kein stiller, schweigsamer Mensch. Im Gegenteil: Er redete gern und hatte die seltene Gabe, seine Zuhörer mit Worten zu fesseln. In einer gerechten Welt wäre er wohl als Schriftsteller oder Dichter berühmt geworden, in dieser schäbigen ungerechten musste er damit Vorlieb nehmen, einer Handvoll zerlumpter Burschen in verdreckten Uniformen die quälend langsam verstreichenden Stunden in muffigen Baracken und schlammigen Schützengräben zu verkürzen.
Meine Großeltern, bei denen ich aufgewachsen war, hatten darauf geachtet, dass ich meine Zeit nicht mit Romanen und Gedichten verplemperte. Sie gaben mir Lexika oder Biografien berühmter Wissenschaftler wie Darwin und Newton zu lesen, beschützten mich aber vor dem schädlichen Einfluss von H. G. Wells, Henry Rider Haggard und Arthur Conan Doyle, da sie fürchteten, ich könnte nach meiner armen Mutter geraten und in der Halbwelt der Londoner Künstler und Schauspieler zugrunde gehen. So lernte ich all die herrlichen Abenteuergeschichten erst dank Finley kennen, der sie oder eher seine ganz persönliche Version von ihnen mit spürbarer Begeisterung nacherzählte. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ein halbes Dutzend grober Kerle sich wie kleine Jungs mit glänzenden Augen und gespitzten Ohren um ihn scharten, um kein Wort zu verpassen, während er, frei nach Bram Stokers Erzählung, den Angriff der Seesoldaten auf die »rote Palisade« malaysischer Piraten schilderte. Finley hatte eine gewisse Vorliebe für Schatzsucher und Seefahrer, doch König Salomons Schatzkammern waren ihm ebenso vertraut wie die nächtlichen Gassen der Großstadt, in denen ein brutaler Mörder namens Mr. Hyde sein Unwesen trieb, oder die vornehmen, von tausend Kerzen erhellten Salons, in denen Dorian Gray mit unschuldigen Debütantinnen flirtete. Natürlich mochte er auch verwickelte Kriminalfälle, ob echt oder erfunden, und an dem Tag, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah, hatte er gerade – in Anlehnung an einen alten Schmöker von Sheridan Le Fanu – die Geschichte des auf unerklärliche Weise verschwundenen Mark Wylder erzählt, der schließlich in einem Waldstück entdeckt wird, wo seine skelettierte Hand aus dem Boden ragt.
Wir waren in der Nähe eines Dörfchens bei Compiègne stationiert, rund vierzig Meilen nördlich von Paris, und warteten in einem der Gräben an der Front auf die überfällige Ablösung. Es war vergleichsweise ruhig, auch wenn man stets mit bösen Überraschungen rechnen musste. Nur wenige Tage zuvor, am 17. März 1917, war es den Deutschen tatsächlich gelungen, mit einem Luftschiff bis nach Compiègne vorzudringen, dem Hauptquartier der französischen Streitkräfte und Standort eines großen Lazaretts, und ich hatte mit eigenen Augen gesehen, wie das brennende Wrack auf die Innenstadt stürzte. Am wenige Meilen entfernten Frontabschnitt hielt man uns freilich mit weitaus konventionelleren Aktionen auf Trab, doch manchmal hörte man stundenlang keinen Ton, und wir malten uns aus, wie die Soldaten auf der anderen Seite heimlich an noch größeren, fantastischeren Kriegsmaschinen bastelten. Wahrscheinlich saßen sie aber ebenfalls bloß in ihren Unterständen, warteten auf Ablösung und vertrieben sich die Zeit nicht anders als wir.
Als Finley seine Geschichte beendet hatte, schwiegen die Soldaten eine Weile. Dann sagte jemand: »Also das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie war das noch mal? Die Leiche streckte plötzlich die Hand aus der Erde?«
»Nein. Der Mann war tot. Man hatte ihn verscharrt, aber nicht tief genug, sodass Wind und Wetter und wilde Tiere die dünne Erdschicht abgetragen haben.«
»Aber dann muss der Mörder ihn mit ausgestrecktem Arm verbuddelt haben, oder? Und warum hat er ihn nicht abgehackt oder abgesägt?«
»Er hatte es eben eilig.« Finley zuckte die Schultern. Obwohl er sich gleichgültig gab, sah ich deutlich, dass er sich insgeheim über die Fragen amüsierte. Sein Publikum nahm alles für bare Münze, und wenn es noch so versponnen war, und diskutierte es eifrig bis ins letzte Detail. Finley lauschte eine Weile, bevor er sich erneut einmischte.
»Hört mal, Jungs. Das ist doch nicht so kompliziert. Wylder verkrampfte sich im Todeskampf und fiel zu Boden, die Hand abwehrend ausgestreckt. Der Mörder ließ ihn an Ort und Stelle liegen, streute lediglich Laub und eine Handvoll Erde über die Leiche, aber die Hand ragte noch ein Stück weit heraus. Ungefähr so.«
Finley krümmte die Finger seiner linken Hand zu einer Klaue und streckte sie in die Luft.
»Wylder wurde also stehend verscharrt?«, fragte der Soldat, der die Diskussion begonnen hatte. Mir war der Mann bislang nie als besonders begriffsstutzig aufgefallen.
»Wie kommst du denn auf die Idee?« Finley verlor langsam die Geduld. Er trat auf eine leere Munitionskiste und zog mit seinem Messer eine Linie an der Wand des Schützengrabens. »Hier liegt also Wylder, und so ragt seine Hand aus der Erde.«
Bevor wir den Schuss hörten und begriffen, was geschehen war, lag Finley auch schon am Boden und umklammerte mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Die Hand selbst war von dem Treffer nahezu zerfetzt. Finley starrte auf Knochensplitter und blutiges Fleisch, doch er schrie nicht. Der Schock verhinderte noch, dass er Schmerz verspürte.
»Halt still«, sagte der kommandierende Offizier. »Wir lassen den Krankenwagen kommen. In ein, zwei Stunden bist du in Compiègne.« Zum Glück hatten wir im Reservegraben ein Feldtelefon, das direkt mit dem Hauptquartier verbunden war.
Ich kniete mich neben Finley in den Schlamm. Jemand reichte mir den Verbandskasten, aber man konnte nicht viel mehr tun, als das Handgelenk abzubinden, um den Blutfluss zu stoppen, und Dakin’sche Lösung zum Desinfizieren auf die offene Wunde zu träufeln. Dann wickelte ich notdürftig Mull um das, was von der Hand übrig war. Finley ertrug alles wortlos.
»Kannst du aufstehn?« Er nickte, und ich half ihm vorsichtig hoch. Fünf Minuten später gingen wir langsam und geduckt durch die Kommunikationsgräben zum Reservegraben, den man im Schutz eines Erdwalls und außerhalb der Reichweite der deutschen Scharfschützen verlassen konnte. Der Krankenwagen hielt für gewöhnlich gut fünfhundert Meter hinter diesem Ausgang, von dem aus wir seine Ankunft beobachten konnten. Er musste in Kürze eintreffen, denn das Lazarett war nicht weit.
»Danke«, sagte Finley leise; sein Gesicht bleich, seine Züge verzerrt. Ich nickte und steckte ihm eine halbvolle Zigarettenschachtel in die Brusttasche. »Jetzt hast du dein Ticket. Sogar Erste Klasse.«
Er lächelte matt und klopfte mit der unverletzten Hand auf die Zigaretten. »Nimm sie noch mal raus. Da ist ein kleines Bild drin.«
Ich holte die Schachtel mitsamt einer Daguerreotypie heraus, die etwa dieselbe Größe hatte.
»Mein kleiner Schatz«, erklärte Finley. »Bewahr das Bild für mich auf, bis ich wiederkomme. Vielleicht bringt es dir Glück.« Ehe ich antworten konnte, näherte sich der Krankenwagen, wir verließen die Deckung und liefen zum Treffpunkt. Der Wagen blieb knirschend auf dem Kiesweg stehen. Es war ein neues Modell, das Rotkreuzzeichen frisch lackiert, ganz anders als die verbeulten Rostlauben vom Ambulance Corps der französischen Armee. Am Steuer saß eine junge Frau ungefähr in meinem Alter, also nicht viel älter als zwanzig. Sie ließ den Motor laufen, zog die Handbremse an und öffnete die Fahrertür, während ihre Beifahrerin, eine Krankenschwester, flink ausstieg, um Finley zu helfen. Sie bestand darauf, dass er sich auf die für den Krankentransport vorgesehene Pritsche hinten im Wagen legte.
»Keine Sorge. Ihr Freund ist in guten Händen«, rief die Fahrerin und zeigte ein verschmitztes Lächeln, in dem ich eine Spur Melancholie zu erkennen glaubte. Ich musste sie angestarrt haben wie ein Schuljunge, aber das wurde mir erst bewusst, als der Wagen davongebraust war und ich immer noch hohlköpfig dreinblickte. Ihre hohe Stirn, die markante Nase, die unter schweren Lidern schimmernden blaugrünen Augen gingen mir lange nicht aus dem Sinn. Ich glaubte, dieses Gesicht schon einmal gesehen zu haben, wusste aber nicht wo. Später erfuhr ich, dass zwei reiche britische Ladys eine Ambulanzeinheit aus zwanzig Rettungswagen und fünfundzwanzig Fahrerinnen finanzierten. An dem ganzen Unternehmen, der erst wenige Wochen vor diesem Zwischenfall gegründeten »Brakespeare Ambulance Unit«, waren ausschließlich Frauen beteiligt, die nicht selten ihr Leben riskierten, um Verwundete zu bergen und in Sicherheit zu bringen.
Nachdenklich kehrte ich zurück zu meinen Kameraden. Plötzlich kam es mir fast so vor, als hätte Finley alles geschickt inszeniert, um nach Hause zu kommen. Andererseits war er nicht der Typ, der davonläuft, und wir hatten zusammen viel schlimmere Zeiten durchgemacht, ohne dass er je geklagt hätte. Der Fall blieb ein Rätsel, und mein Freund kehrte nach jenem Ereignis im April 1917 nicht zurück an die Front. Einmal machte das Gerücht die Runde, man habe Finley wegen Desertion vors Kriegsgericht gestellt. Die statistische Häufung von vergleichsweise ungefährlichen Schusswunden an Händen und Armen hatte dazu geführt, dass man dergleichen genauer unter die Lupe nahm. Allerdings verlangte niemand von mir oder einem meiner Kameraden eine Zeugenaussage, weshalb ich nicht glauben konnte, dass man Finley tatsächlich verdächtigte. Dann wieder hieß es, er sei an einer Infektion gestorben. Eine offizielle Meldung blieb jedoch aus. Als ich die Gelegenheit fand, im Lazarett nach ihm zu suchen, konnte mir keine der Schwestern Auskunft über seinen Verbleib geben. Auch über die Fahrerin wusste man nichts Genaues, nur dass sie wohl zu den Brakespeares gehörte, die sich bald einen Ruf als wilde Bande verrückter Engländerinnen und verwegener Amerikanerinnen verschafft hatten. Die Daguerreotypie, die ich für Finley aufbewahren sollte, trug ich noch jahrelang bei mir. Niemand hat je danach gefragt.
III
An dem Morgen, als ich die Stimme hörte, holte ich die alte Daguerreotypie hervor. Ich hatte sie schon lange nicht mehr in der Hand gehabt und kaum noch an Finleys rätselhaften Abgang gedacht. Das unscharfe Bild, das ein stämmiges, drei oder vier Jahre altes Mädchen mit einem Stofftier zeigte, war für mich eine Art Talisman geworden. So wie ich mich damals in Finleys Nähe sicher gefühlt hatte, wirkte das Wissen um die kleine Kupferplatte in meiner Brieftasche irgendwie beruhigend, und zweifellos hätte ich mich sehr unbehaglich gefühlt, wäre sie verloren gegangen.
»Hast du mir je ihren Namen genannt?«, sagte ich laut zu dem Schatten, der mich immer begleitete und manchmal sogar auf meine Fragen antwortete. »Nein«, kam ich ihm zuvor und suchte nach einem Bleistift. Bevor ich das Bild wieder einsteckte, schrieb ich »Lily« in mein Notizbuch. Nach kurzem Zögern fügte ich ein Fragezeichen hinzu.
Nach Kriegsende hatte ich mehrfach versucht, Finley ausfindig zu machen. Da er sich nicht meldete, weder bei mir noch bei den wenigen anderen Überlebenden unseres Regiments, zu denen ich Kontakt hielt, ging ich inzwischen davon aus, dass er trotz der vergleichsweise harmlosen Verletzung gestorben war. Blutvergiftung war in solchen Fällen die häufigste Todesursache. Sein Name musste also in den Gefallenenlisten auftauchen, die man in der Bibliothek einsehen konnte. Ich hatte Stunden unter der großen Kuppel des Lesesaals der British Museum Library verbracht, um die systematisch geordneten, in einundachtzig Bänden abgedruckten Listen zu prüfen und die Namen unseres Infanterieregiments immer wieder durchzugehen. Die meiste Zeit dürfte ich allerdings damit vergeudet haben, das Regal mit den Folianten anzustarren. Die Bücher bildeten für mich das absurdeste Denkmal dieses sinnlosen Krieges: als hätte Gevatter Tod persönlich zur Feder gegriffen und sein Meisterwerk verfasst. Es kostete mich einiges an Überwindung, nach dem richtigen Band zu suchen und ihn aus dem Regal zu nehmen, und es ekelte mich regelrecht davor, ihn aufzuschlagen. Lange saß ich schweigend davor, während in meinem Kopf blindes Chaos herrschte. Ich meinte, ein Brüllen und Donnern zu hören, wusste aber, dass es sich um Illusionen handelte. Ebenso wie Finley, der neben mir saß und seelenruhig einen seiner Monologe hielt.
»William James sagte einmal sinngemäß, dass Nationen nicht durch Kriege gerettet werden, sondern durch Menschen, die einen aufrechten Menschen erkennen, wenn sie ihn sehen, und lieber ihn zum Anführer wählen als tollwütige Partisanen und aufgeblasene Quacksalber …«
Der Platz neben mir war leer, und die Stimme verstummte, als ich mich zu ihr umdrehte. Derlei ängstigte mich nicht, weckte aber immer neue Erinnerungen, denen ich nachhing, ohne zu merken, wie die Zeit verging. Beim Verlassen der Bibliothek hatte ich nichts herausgefunden und meine Ungewissheit eher erweitert als geschmälert. Ich dachte daran, an das Kriegsministerium oder das Nationalarchiv zu schreiben, aber irgendwann beschloss ich, die Sache einfach abzuhaken. Es lenkte mich zu sehr von meiner Arbeit ab, führte zu endlosen Spekulationen, ohne mir etwas zurückzugeben. Im Gegenteil, ich fühlte mich nur schlechter, solange ich mich damit beschäftigte. Das galt auch für die Frage, wer das Kind auf der Daguerreotypie sein mochte und was aus ihm geworden war. Ich wollte mein Leben nicht damit verbringen, Phantomen nachzujagen. Nun aber fragte ich mich, ob die Phantome nicht längst ein Teil von mir geworden waren? Womöglich würde es sich als fatal erweisen, sie allzu lang zu ignorieren und in den Hintergrund zu drängen. Vielleicht musste ich nur lernen, ihnen zuzuhören, um das Rätsel zu lösen.