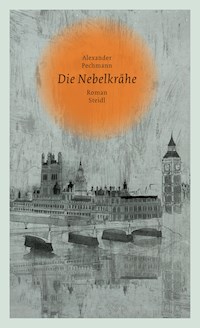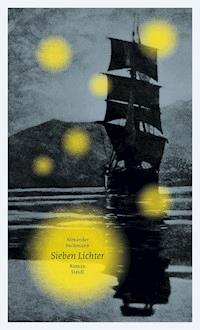Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Im Bücherregal Alexander Pechmanns verbirgt sich ein besonderes Kleinod: Seine Seiten sind vergilbt, der Rücken durchgewetzt, der blutrote Leineneinband fleckig, als hätte es monatelang in einem offenen Rettungsboot gelegen. Es ist der maritime Lieblingsroman seines zur See fahrenden Ururgroßvaters und Urquell einer nun schon über mehrere Generationen vererbten Liebe zur Meeresliteratur. In seinem von Orlando Hoetzel wunderschön illustrierten Buch spürt Alexander Pechmann dieser Liebe nach. Er gibt einen Überblick über bekannte und unbekannte Werke, beleuchtet Zusammenhänge und Einflüsse und nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise über die sieben Meere der Literatur, wo seit Odysseus' Irrfahrt Geisterschiffe kreuzen und Windsbräute toben, wo Schiffbruch erlitten, gemeutert, geschmuggelt und so mancher Goldschatz gehoben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Pechmann
Die Bibliothek der sieben Meere
Mit Odysseus, Robinson Crusoe und Jane Austens Kapitänen unterwegs auf dem Ozean der Literatur
Mit Illustrationen von Orlando Hoetzel
© 2023 by mareverlag, Hamburg
Lektorat Angela Volknant
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung Orlando Hoetzel
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-830-4
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-681-2
www.mare.de
Das Meer ist für mich ein fortwährendes Wunder,Die darin schwimmenden Fische –die Felsen – die Wellenbewegung –
Die Schiffe mit all den Menschen an Bord,Welch seltsamere Wunder mag es dort geben?
Walt Whitman
Inhalt
PROLOG. Anker lichten
I. Das Meer der Mythen
Odysseus und seine Söhne
Sindbads Schatzinseln
Der alte Seemann
Der Fliegende Holländer
II. Das Meer des Unbekannten
Die großen Entdecker
Robinsonaden
Südseeträume
Die Wunder der Eismeere
III. Das Meer der Abenteuer
Seehelden und Seeschurken
Piraten, Piraten, Piraten
Schatzsucher und Schiffsköche
Schmugglerbarone und Strandräuber
IV. Das Meer der Arbeit
Vor dem Mast
Unter Walfängern
Arbeiter des Meeres
Wächter der See
V. Das Meer des Unheils
Sturmgötter und Windsbräute
Schiffbruch mit Pudel
Meuterei und Meuchelmord
VI. Das Meer der Angst
Monster der Tiefe
Geisterschiffe
Schiffsgeister
VII. Das Meer der Leidenschaft
Große Liebesgeschichten
Jane Austens Kapitäne
Matrosenliebe
Sehnsucht nach dem Meer
EPILOG. Zu neuen Ufern
Zum Weiterlesen
Dank
Personenregister
Viten
PROLOG
Anker lichten
Das Lieblingsbuch meines Ururgroßvaters sieht aus, als hätte es manch einen Orkan, manch einen Schiffbruch überstanden. Die Seiten sind vergilbt, der Buchrücken ist durchgewetzt, der Rest des blutroten Leineneinbands fleckig, als hätte es wochen- und monatelang in einem offenen Rettungsboot gelegen. Vermutlich hat es ihn auf all seinen Reisen begleitet. Er las es in einer schaukelnden Kajüte der englischen Jacht Pandora, die 1876 in die Arktis aufbrach, um nach der verschollenen Franklin-Expedition zu suchen, im schattigen Büro des Hafenkommandanten von Pola und an der Marineakademie in Fiume, wo er im Jahr 1900 im Rang eines Contre-Admirals starb.
Dieses wunderliche Familienerbstück, Urquell einer mehrere Generationen anhaltenden Liebe zur Meeresliteratur, steht in meinem Bücherregal etwas verloren zwischen Adelbert von Chamissos Reise um die Welt und James Boswells Journal. Wann immer ich es vorsichtig herausnehme und darin blättere, überlege ich mir, wo ein ordnungsliebender Bibliothekar es eigentlich einordnen würde. Tom Cringle’s Log, so der Titel, erschien ohne Jahresangabe in der Reihe Blackwood’s Standard Novels in Edinburgh. Der Autor, ein gewisser Michael Scott, hatte es 1829 anonym in Fortsetzungen veröffentlicht, und es handelt von Reisen und Abenteuern in der Karibik, von Erlebnissen und Kämpfen auf verschiedenen Segelschiffen. Auf den ersten Blick ein klassischer, heute vergessener Seeroman, doch bei näherer Betrachtung wirkt die Zuordnung weniger eindeutig. Ist es nun ein Roman oder eine Autobiografie, ein Reisebericht oder eine frei erfundene Abenteuergeschichte? Diese Fragestellung scheint für die Literatur der Meere nicht ungewöhnlich zu sein. Wir Landratten können meist nicht beurteilen, ob es sich um Seemannsgarn oder historische Fakten handelt. Auf hoher See scheinen die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion leichter zu verschwinden als anderswo, und man kann mit einer Handvoll nautischer Fachbegriffe ein unheiliges Maß an Authentizität vorgaukeln. Aber nicht nur die Trennlinie zwischen Dichtung und Wahrheit wird mitunter durchlässig, sondern auch jene zwischen Erzählung und Essay, Klassik und Romantik. Was für literarische Kategorien gilt, scheint ebenso für unterschiedliche Nationalitäten und Sprachen zu gelten. Diese verschwimmen nicht nur auf den Schiffen, die mit ihren zusammengewürfelten Crews zu fremden Gestaden aufbrechen, sondern auch in den Lebensläufen etlicher Romanciers, deren Horizont sich nie auf eine kleine Ecke der Welt beschränkte. Es liegt in der Natur des Meeres, dass man schwerlich Zäune errichten und Grenzsteine setzen kann, und ebenso verhält es sich mit der Meeresliteratur und den Meeresliteraten.
Einer der beliebtesten »englischen« Schriftsteller, Joseph Conrad, war eigentlich Pole, geboren als Konrad Korzeniowski, und seine besten Romane spielen im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer. Der Erfolgsautor Heinrich Smidt wurde als »deutscher Frederick Marryat« bezeichnet und schrieb, wie sein englischer Kollege, Geschichten über den Fliegenden Holländer. Eugène Sue galt als »französischer James Fenimore Cooper«, mit dem ihn eine herzliche Freundschaft verband, und Emilio Salgari als »italienischer Karl May«. Der Russe Alexander Grin wurde von seinen Landsleuten für einen Engländer gehalten, Friedrich Gerstäcker übersetzte und imitierte sein amerikanisches Vorbild Herman Melville, und der Ire Lafcadio Hearn starb als japanischer Staatsbürger. All diese Autoren waren, beruflich oder privat, zur See gefahren und konnten aus persönlichen Erfahrungen schöpfen, aber auch aus den Romanen ihrer Schriftstellerkollegen; sie kannten selbstverständlich das erste große Werk der Meeresliteratur, Homers Odyssee, und damit die großen klassischen Mythen der Ozeane. Jeder von ihnen dürfte in seiner Jugend Defoes Robinson Crusoe verschlungen haben, und jeder hatte aus dem Mund derer, die selbst dabei gewesen waren, Geschichten über Entdeckungsreisen, Schiffskatastrophen, Seekriege, Meuterei und bemerkenswerte Schicksale auf allen sieben Meeren gehört.
Da eine Unterteilung in Nationalliteraturen schwieriger ist, als man auf den ersten Blick meinen möchte, könnte man versuchen, die Werke der Meeresliteratur chronologisch zu ordnen, von der altgriechischen Odyssee zu Luís de Camões’ Lusiaden, dem portugiesischen Versepos über die Entdeckungsfahrten Vasco da Gamas; von Daniel Defoes frühen Seeromanen zu Tobias Smollett; von James Fenimore Cooper zu Herman Melville, Friedrich Gerstäcker und Pierre Loti; von Frederick Marryats Peter Simpel zu C. S. Foresters Hornblower und Rafael Sabatinis Captain Blood. Doch eine solche Ordnung würde an Aussagekraft verlieren, wenn man bedenkt, dass ein bedeutendes Werk wie Melvilles Moby-Dick erst rund dreißig Jahre nach dem Tod des Autors wirklich wahrgenommen wurde und Bücher wie Stevensons Schatzinsel und Jules Vernes 20 000 Meilen unter dem Meer unabhängig von ihrer Entstehungszeit geliebt und gelesen wurden. Autoren des frühen 20. Jahrhunderts, wie Forester, ignorierten den historischen Übergang vom Segel- zum Dampfschiff und ließen ihre Seehelden in den Napoleonischen Kriegen des frühen 19. Jahrhunderts kämpfen. Autoren des späten 19. Jahrhunderts wie Joseph Conrad und Henry James distanzierten sich indes selbstbewusst vom Genre des Seeromans, hielten diese literarische Kategorie für Kinderkram und schrieben dennoch über Schiffsreisen und Abenteuer auf hoher See. – Ebenso eine ganze Reihe Autorinnen wie Jane Austen, Elizabeth Gaskell, Sarah Orne Jewett und Sophie Wörishöffer, die oft eine andere, eigene Art von Literatur des Meeres pflegten, wobei sie offenbar lieber am vermeintlich sicheren Ufer blieben, als sich auf das schwankende Deck eines Schiffes zu wagen.
Die einzige Ordnung, die mir sinnvoll erscheint und die eine gute Übersicht über die Literatur der Meere ermöglicht, ist jene nach Themenkreisen. Diese Kreise gleichen den Wellen, die Kieselsteine erzeugen, wenn man sie ins Wasser wirft. Sie breiten sich in alle Richtungen aus, überschneiden sich gelegentlich und verschwinden schließlich – wie alle Geschichten, Namen und Kategorien. Dennoch erzeugen sie ein Bild, das verführerisch sein kann und vielleicht den Anreiz bietet, den Kieseln hinterherzuspringen, um den einen oder anderen Schatz aus der Tiefe zu retten und zurück ans Licht zu holen.
Ich nenne diese Themenkreise Meere, wohl wissend, dass sie sich nur schwer eingrenzen lassen und ineinanderfließen wie die Sieben Meere der Geografie. Die Reihenfolge ist nicht ganz beliebig, denn das »Meer der Mythen« mit seinen prägenden Vorstellungen von Göttern, Wundern und Seehelden lebt fort in der Fantasie aller folgenden Autoren. Gleiches gilt für die Entdecker, Weltreisenden und Robinsone im »Meer des Unbekannten«, deren Erfahrungen eine Unmenge literarischer Werke inspirierten. Im »Meer der Abenteuer« findet man den Ursprung des modernen Seeromans – vor allem in Werken von Seefahrern, die nach dem Ende der Napoleonischen Kriege kein Kommando bekamen und sich mit dem Schreiben von Abenteuergeschichten über Wasser hielten. Im »Meer der Arbeit« werden die Schicksale einfacher Fischer, Walfänger und Matrosen zu Literatur. Das »Meer des Unheils« ist der Ort, wo gewaltige Stürme herrschen, Schiffe sinken und Matrosen meutern. Die schrecklichsten Seeungeheuer und entsetzlichsten Gespenster hausen im »Meer der Angst«, ein Kapitel, das zart besaitete Gemüter überspringen dürfen, um rasch ins »Meer der Leidenschaft« zu gelangen, wo große Gefühle zu ihrem Recht kommen.
In all den Werken, die auf den folgenden Seiten eingehende Beachtung finden, wird der Beziehung zwischen der Lebenserfahrung der Autoren und ihrer literarischen Schöpfung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die wahren Geschichten hinter den erfundenen werden erkundet, ohne den Zauber der Fantasie zu mindern.
Die Bibliothek der sieben Meere ist eine flüchtige Institution, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ewige Gültigkeit erhebt. Der Schwerpunkt liegt bei englischsprachigen Autoren und Werken des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, da sie stilprägend für das gesamte Genre waren und sind. Bekanntes und Vergessenes steht gleichberechtigt nebeneinander. Die Auswahl ist rein subjektiv; sie basiert auf meinen persönlichen Vorlieben und auf den gewaltigen Bücherbergen, die sich seit den Tagen meines Ururgroßvaters in den Regalen meiner Familie angesammelt haben.
Odysseus und seine Söhne
Ich hörte einmal von einem alten deutschen Gelehrten, der die Odyssee auf Gummi drucken ließ, damit er die Verse in der Badewanne lesen konnte. So weit würde ich nicht gehen, aber in jungen Jahren liebte ich die Nacherzählungen von Gustav Schwab und Auguste Lechner, den farbenprächtigen Hollywoodfilm mit Kirk Douglas und die fast wortgetreue Fernsehserie mit Irene Papas als treuer und stolzer Penelope. Das Original habe ich erst spät kennengelernt, obwohl mir dessen Bedeutung natürlich schon vorher bewusst war. So wie Homers klassische Versepen Ilias und Odyssee am Anfang der europäischen Literatur stehen, ist Odysseus der unverzichtbare Ahnherr unzähliger Figuren der Meeresliteratur. Er ist ein listenreicher Krieger und Pirat, ein wagemutiger Abenteurer, der zu unbekannten, fantastischen Ländern und sogar in die Unterwelt vordringt, ein von den Göttern Verfluchter, der den Bann zu brechen versucht; ein Schiffbrüchiger, der an einem fremden Ufer angeschwemmt wird, ein geschickter Handwerker, der ein seetüchtiges Floß baut, um endlich heimzukehren zu Frau und Kind, und ein Rächer, der seine Feinde gnadenlos niedermetzelt.
Die Odyssee, entstanden im 8. Jahrhundert vor Christus, war eines von vielen weniger bekannten Epen, deren Handlung an die Ilias und die Ereignisse um den Trojanischen Krieg anschloss oder dessen Vorgeschichte schilderte. Sie gehörten zu einem Sagenkreis, der angeblich alles umfasste, was zwischen der Vereinigung der ersten Götter von Himmel und Erde und dem Tod des Odysseus geschah. Aristoteles erwähnt im 23. Kapitel seiner Poetik die Kyprien, worin der Raub der schönen Helena und die Ursachen des Krieges geschildert werden. Die Aithiopis erzählt von den Kämpfen des »gottgleichen« Achilles und seinem Tod durch die Hand des Paris, dessen vom Gott Apoll gelenkter Pfeil die berühmte »Achillesferse« trifft. Die Iliupersis berichtet von der Zerstörung Trojas und die Nostoi von den Heimfahrten der mehr oder weniger heldenhaften Krieger. Welche gewaltigen Abenteuer sie dabei erlebten, werden wir nie erfahren, da diese und viele andere Werke des Sagenkreises verloren gegangen sind. Homers Epen blieben uns wohl allein deshalb erhalten, weil sie an Schulen und Universitäten am häufigsten abgeschrieben wurden und weit über Griechenland hinaus die größte Verbreitung fanden.
Dabei weiß eigentlich niemand, wer Homer wirklich war, ob man ihm die zwei weltanschaulich, stilistisch und erzähltechnisch so unterschiedlichen Werke, die im Abstand von mehreren Jahrzehnten entstanden sein dürften, nur zuschrieb oder ob er sie tatsächlich verfasste; ob er die Verse lediglich vortrug, wie der blinde Sänger Demodokos in der Odyssee, oder ob er sie Wort für Wort auf vierundzwanzig Buchrollen aus Leder bannte. Der Dichter lebte wahrscheinlich in einer der Hafenstädte des Ionischen Bundes, in Chios oder Smyrna. Als Kind mochte er den Segelschiffen nachgeträumt haben, welche die Küsten des Mittelmeeres verbanden und weit nach Westen, nach Ägypten und Phönizien vordrangen, um Handel zu treiben und Kolonien zu gründen. Er lauschte den Geschichten der Seeleute über die betörenden Sirenengesänge, über schreckliche Meeresungeheuer wie die sechsköpfige Skylla oder den Schiffe verschlingenden Strudel Charybdis. Er hörte von Inseln, auf denen einäugige Riesen hausten, und solchen, wo Götter herrschten und wo mächtige Zauberinnen wie Kirke Männer in Schweine verwandelten. Um mit solchen Mächten zu ringen, war mehr nötig als Kraft und Geschicklichkeit – es brauchte einen starken Willen, einen klugen Kopf und die schützende Hand der Göttin Athene. Wer, wenn nicht Odysseus, der listenreiche Krieger des Trojanischen Krieges, hätte solche Abenteuer bestehen können?
Anders als die geradlinig erzählte Ilias ist die Odyssee ein verschachteltes Werk aus verschiedenen Erzählsträngen, mit Rückblenden und kunstvoll ineinander verwobenen Schicksalen. Die Irrfahrten des Odysseus, dem ein Fluch des Meeresgottes Poseidon die Heimkehr verwehrt, bilden nur einen Teil des Epos. Dieses beginnt mit dem Beschluss der Götter, die Gefangenschaft des Helden auf Kalypsos Insel zu beenden. Dann wird von der Suche des Telemach nach seinem verschollenen Vater berichtet und von seiner Reise, die aus dem Jüngling einen Mann machen wird; sozusagen die antike Version einer Coming-of-Age-Geschichte. Erst im fünften Gesang erfahren wir, wie Odysseus ein Floß baut, um die Insel zu verlassen, auf der er sieben Jahre verbrachte. Immerhin durfte er die meiste Zeit in den Armen der Nymphe Kalypso liegen, hatte es also wesentlich bequemer als die Schiffbrüchigen späterer Epochen, wie etwa Robinson Crusoe. Der ausführlich geschilderte Bau des Floßes ist besonders interessant, da er Rückschlüsse auf das Handwerk der Bootsbauer zu Homers Zeiten erlaubt. Die Beschreibung ist so realistisch, dass man das Wasserfahrzeug nachbauen könnte, sollte man jemals auf Kalypsos Insel stranden und sie tatsächlich wieder verlassen wollen. Die Odyssee bietet auch allgemein einen guten Einblick in die Seefahrt der Antike, und etliche Details zeigen, dass Homer keine ahnungslose Landratte war. Vielleicht hat er sogar in Hafenkneipen mit alten Kapitänen über nautische Technik gefachsimpelt. Da er die Schiffe als »schwärzlich« oder »dunkelbugig« bezeichnet, mussten ihre Rümpfe stark geteert gewesen sein. Der Bugspriet, zuweilen »blaugeschnäbelt« oder »rotgeschnäbelt« genannt, war bunt bemalt. Die kleinsten Schiffe wurden von zwanzig Ruderern angetrieben, die größten von fünfzig oder sogar hundert. Bei günstigem Wind wurde ein Mast mittels zweier bugwärts gespannter Taue aufgestellt, im Mastschuh verkeilt und mit einem heckwärts gespannten Tau gesichert. Dann hisste man das Segel mit der Rahe auf und brasste es in den Wind. Die Ruder wurden eingezogen; es wurde also nie gleichzeitig gesegelt und gerudert, wie man es zuweilen in Hollywoodfilmen sieht. Der von Homer verwendete Begriff »bauchig« meint, dass die Schiffe, wie offene Fischerboote, nur ein kleines Deck am Bug hatten, wo ein Ausguck seinen Posten einnahm, und ein größeres achtern, wo Kapitän und Steuermann an der Ruderpinne Platz fanden. Die Fracht wurde unter den Ruderbänken verstaut, so wie der mit allen möglichen Winden gefüllte Sack, den der von Zeus eingesetzte Verwalter der Winde, Aiolos, den Seefahrern mit auf den Weg gab. Die antiken Galeeren waren so leicht gebaut, dass man sie auf einen Strand ziehen und notfalls rasch zurück ins Meer stoßen konnte, wie bei Odysseus’ Flucht von der Insel des Zyklopen Polyphem. Die alten Seefahrer blieben meist in Küstennähe und verbrachten die Nacht ungern auf hoher See. Statt in einer Bucht den Anker zu werfen, zogen sie das Schiff lieber an Land. Odysseus’ Reise von einer Insel zur nächsten spiegelt also die damals übliche Art des Reisens wider. Seine Fahrt auf dem Floß, das schließlich im Sturm zerbricht, führt ihn ins Land der Phaiaken, an den Hof des Königs Alkinoos, dem er die Geschichte seiner Irrfahrten erzählt. Da der Held selbst von seinen Taten berichtet, kann man nicht ausschließen, dass es sich bei den märchenhaften Geschichten über Monster und Zauberinnen um reinstes Seemannsgarn handelt, zumal er es bei anderen Gelegenheiten mit der Wahrheit auch nicht so genau nimmt. Am Anfang steht jedoch eine realistische Episode, die eine andere, dunklere Seite des Helden offenbart. Odysseus, der nach der neunjährigen Belagerung Trojas Sehnsucht nach Heim und Herd verspürt, entpuppt sich hier als blutrünstiger Pirat, der rasch noch das Land der Kikonen heimsucht, um ein wenig zu plündern und zu brandschatzen:
Gleich von Ilion trieb mich der Wind zur Stadt der Kikonen,
Ismaros, hin. Da verheert’ ich die Stadt und würgte die Männer.
Aber die jungen Weiber und Schätze teilten wir alle
Unter uns gleich, dass keiner leer von der Beute mir ausging.
Die einst mit den Trojanern verbündeten Kikonen rufen ihre Nachbarn zu Hilfe, deren übermächtige Heerscharen die Plünderer zurück ins Meer jagen.
Diese kurze Piratengeschichte zeugt nicht nur davon, wie gewalttätig es in Homers Welt wirklich zuging, sie zeigt auch einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Epen Ilias und Odyssee. In dem erstgenannten, älteren Werk sind fast alle Taten vom Schicksal und von den Göttern gelenkt. Odysseus hingegen wird zwar von Poseidon verflucht und von Athene in mannigfaltigen Verkleidungen beschützt, doch bestimmt er sein Schicksal selbst durch eigene Entscheidungen und Taten, und diese sind nicht immer richtig oder nach damaligen Maßstäben moralisch. So rettet er zwar seine Kameraden und sich selbst, indem er den einäugigen Zyklopen Polyphem blendet, doch stürzt er gleich darauf sich und die Seinen ins Verderben, als er den Riesen verhöhnt, ihm prahlerisch seinen Namen verrät und so erst den Zorn von dessen Vater Poseidon auf sich zieht. Odysseus ist ebenso erfindungsreicher Held wie eitler und fehlbarer Mensch, zu guten wie bösen Taten fähig. Er ist nicht nur »göttlicher Dulder«, liebender Ehemann und Vater, sondern immer auch »Städtezerstörer«, Abenteurer und Krieger, »besudelt von Blut und Schmutz wie ein Löwe«.
Die Odyssee umfasst jedoch auch das Schicksal gewöhnlicher Menschen, die Not der in der Heimat wartenden Frauen, Kinder, Diener und Sklaven, die vom bunten Treiben der Götter und Helden nur am Rande berührt werden. Penelope, die ihrem Mann Odysseus treu bleibt und sich listig gegen die Freier wehrt, die seinen Platz einnehmen wollen, ist sozusagen das Gegenstück zum reisenden Helden. Sie ist eine Heldin des Haushalts und Alltags, das Urbild der duldsamen Ehefrau und insbesondere Seemannsgattin, der wir in etlichen Romanen der Neuzeit wiederbegegnen. Ihre unheroische Welt ist Schauplatz der zweiten Hälfte des Epos, und die zögernde Annäherung zwischen Mann und Frau nach vielen Jahren der Trennung spielt eine ebenso große Rolle wie die Irrfahrten des Helden und sein Kampf gegen den Zorn der Götter. Odysseus kehrt nicht im Triumph zurück nach Ithaka, sondern als Bettler, der bei einem Schweinehirten Unterkunft findet und diesem eine alternative Version seiner Reisen erzählt, die zwar zu seiner Tarnung gehört und erlogen sein soll, aber viel glaubhafter wirkt als das Seemannsgarn um Kirke und Polyphem. Die Lügengeschichte führt nicht zu fantastischen Wunderinseln, sondern schildert einen missratenen Raubzug nach Ägypten und zu Orten, die ein griechischer Glücksritter des 8. Jahrhunderts vor Christus durchaus besucht haben könnte. Erst anlässlich eines Wettkampfes, den die Hausherrin ausruft, gibt Odysseus sich zu erkennen, schlüpft wieder in seine Heldenrolle und rächt sich erbarmungslos an allen Männern, die seinen Hof belagerten und seine Frau bedrängten. Die Göttin Athene verhindert weiteres Blutvergießen, und es scheint, als sei es Odysseus vergönnt, friedlich im eigenen Bett zu sterben. Laut anderen Überlieferungen hatte er jedoch weniger Glück.
Im 6. Jahrhundert vor Christus erschien eine kuriose Fortsetzung der Odyssee, die Telegonie. In diesem fragmentarisch erhaltenen Epos macht sich Telegonos, Sohn von Odysseus und der Zauberin Kirke, auf die Suche nach dem Vater und tötet ihn unwissentlich mit dem giftigen Dorn eines Stachelrochens, um hernach Penelope zu heiraten, während Kirke Telemachs Frau wird. Diese antike Seifenoper versuchte offensichtlich, aus einem bewährten Stoff noch einmal Kapital zu schlagen, und diente mehreren, leider verschollenen, Tragödien als Vorlage. Erst 260 vor Christus gelang es dem aus Alexandria stammenden Dichter Apollonios von Rhodos, ein Werk zu schaffen, das überzeugend auf den griechischen Sagenkreis zurückgriff, ohne Homers Stil zu imitieren: die Argonautika. Sie basiert auf einem verschollenen Epos, das wohl noch älter ist als Ilias und Odyssee, und berichtet von den Abenteuern Jasons, der in Begleitung von griechischen Superhelden wie Odysseus’ Vater Laertes, Herakles und Orpheus in See sticht, um das Goldene Vlies zu gewinnen, was mithilfe der listenreichen Königstochter Medea gelingt. Auf der Heimfahrt erleben sie allerhand Abenteuer auf Inseln und in fernen Ländern, die uns aus der Odyssee vertraut sind. Sie begegnen der Zauberin Kirke, die sich hier als Medeas Tante entpuppt, müssen sich dem unheilvollen Gesang der Sirenen stellen und begegnen Alkinoos, dem König der Phaiaken.
Die an den Stationen der Odyssee angelehnte Irrfahrt ist hier vor allem eine Liebesgeschichte, und die leidenschaftliche Medea wird zu einer dem Helden Jason ebenbürtigen Hauptfigur. In ihrem Schwanken zwischen Liebe und Pflicht wirkt sie vielschichtiger als die eher eindimensionalen Frauenfiguren bei Homer.
Ein Liebespaar steht auch im Mittelpunkt eines frühen Prosaromans aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, die Aithiopika von Heliodor. Der phönizische Autor, über den man noch weniger weiß als über Homer, orientiert sich weniger inhaltlich als in seiner kunstvoll verschachtelten Erzählweise an der Odyssee. Die äthiopischen Abenteuer von Theagenes und Charikleia, so der Titel der deutschen Übersetzung von Horst Gasse, hatten großen Einfluss auf die europäische Romanliteratur, und die Handlung um Liebende, die getrennt werden und erst nach zahllosen Prüfungen zueinanderfinden, wurde oft kopiert und variiert. Giuseppe Verdi verwendete einige Motive daraus für seine Oper Aida (1871). Für die Meeresliteratur ist der spätantike Roman interessant, weil von Seereisen zwischen Griechenland und Ägypten, wilden Kämpfen gegen Piraten und kriegerischen Konflikten der Völker des Mittelmeeres erzählt wird. Der Hintergrund ist realistisch gestaltet, gespickt zwar mit Anspielungen auf literarische Vorgänger, aber ohne die fantastischen Fabelwesen und aktiv ins Geschehen eingreifenden Götter der alten Versepen.
Ein aufmerksamer Leser des Romans war Miguel de Cervantes, der sich nach seinem Dienst in der spanischen Marine und jahrelanger Gefangenschaft in Algier der Literatur widmete. Sein weltberühmter Don Quijote erschien in zwei Teilen, 1605 und 1615. Sein weniger bekanntes Werk Die Mühen und Leiden des Persiles und der Sigismunda von 1617 war, wie der Autor zugab, »ein kühner Versuch, mit Heliodor zu wetteifern«. In der kuriosen und arg verwickelten Handlung leben auch Motive aus Homers Odyssee wieder auf: das Floß, der Sturm, Schiffbruch, Rettung aus Seenot und der Besuch einer Reihe von seltsamen Inseln. Doch Cervantes war nur einer von unzähligen Autoren, die zu diesen ewig fesselnden Themen zurückkehrten.
Sindbads Schatzinseln
Sindbad der Seefahrer, eine der berühmtesten Figuren der orientalischen Literatur, ist in mancher Hinsicht ein Nachfahre des alten Helden Odysseus. Seine sieben Reisen führen ebenfalls zu fantastischen Ländern und entlegenen Inseln, wo er wilde Abenteuer mit allerlei Monstern, Riesen und Kannibalen bestehen muss und alle Prüfungen mit List und Verstand meistert. Sindbads Begegnung mit den Riesen während seiner dritten Reise ist der Episode um den Zyklopen Polyphem so auffallend ähnlich, dass Homers Odyssee dem anonymen Autor als Vorlage gedient haben muss, obwohl Homer nie ins Arabische übertragen wurde und die Riesen ein wenig anders aussehen: »Dann kam von der Zinne der Burg ein riesenhaftes Geschöpf auf uns herabgestiegen; es war einem Menschen ähnlich, doch von schwarzer Farbe und von ungeheurem Wuchs, etwa einer großen Dattelpalme gleich; seine Augen waren wie glühende Kohlen, seine Augenzähne wie die Hauer eines Ebers, und sein Maul war weit und tief wie der Schacht eines Brunnens. Ferner hatte er lange, hängende Lippen wie ein Kamel, die fielen ihm bis auf die Brust herab, und Ohren wie zwei Barken, die ihm über die Schulterblätter hingen; und die Nägel seiner Hände waren den Krallen des Löwen gleich.« Dieses Ungeheuer, das einige Schiffskameraden Sindbads schnappt, über dem Feuer röstet und verspeist, wird schließlich – wie sein älterer Kollege Polyphem – besiegt, indem man ihm glühende Spieße in die Augen stößt. Doch während Odysseus’ Sieg über Polyphem den Zorn der Götter heraufbeschwört und zum Auslöser seiner weiteren Irrfahrten wird, bleibt Sindbads Abenteuer nur eine Episode von vielen, die vornehmlich dazu dienen, seine Geschicklichkeit zu beweisen, ohne ihm weitere tragische Verstrickungen aufzubürden.
In der Rahmengeschichte wird bereits deutlich, dass weltliche Anliegen in den Vordergrund rücken und kosmische Mächte eine untergeordnete Rolle spielen, auch wenn hin und wieder Allah, der Allbarmherzige, um Beistand gebeten wird. So erzählt ein reicher Kaufmann namens Sindbad einem gleichnamigen armen Lastenträger, wie er zu seinem Wohlstand gekommen ist. Die Geschichten könnten auch anschauliche Beispiele eines Ratgebers für arabische Kaufleute sein, denn sie zeigen vor allem, wie man mittels Klugheit, Wagemut und Entschlossenheit den Weg zum Erfolg ebnet. Mit anderen Worten: wie man in fernen Ländern Schiffbruch erleidet, gegen Kannibalen und wilde Kreaturen kämpft und am Ende nicht nur mit heiler Haut davonkommt, sondern auch noch mit vollen Taschen heimkehrt.
Die Geschichte der sieben Reisen Sindbads bilden einen eigenen Erzählzyklus, der nur in der europäischen Wahrnehmung zu den Märchen aus Tausendundeiner Nacht gehört. Eigentlich handelt es sich um ein separates Buch, das später von Antoine Galland in seine zwölfbändige, zwischen 1704 und 1717 veröffentlichte Übersetzung der Märchensammlung eingefügt wurde.
Galland gilt als Entdecker der orientalischen Erzählkunst und wird zuweilen auch als ihr Erfinder bezeichnet, da er die Originaltexte nicht nur übersetzte, sondern auch nach eigenem Ermessen ergänzte, überarbeitete und an europäische Lesegewohnheiten anpasste. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen, entdeckte jedoch schon in jungen Jahren eine Vorliebe für das klassische Griechisch und Latein und studierte in Paris. Dort weckte seine besondere Sprachbegabung die Aufmerksamkeit des französischen Botschafters Marquis de Nointel, der 1670 beschloss, Galland als Dolmetscher an den Hof des osmanisch-türkischen Sultans mitzunehmen. Der junge Mann nutzte den fünfjährigen Aufenthalt, um Türkisch, Neugriechisch, Arabisch und Persisch zu lernen. Er suchte für den Botschafter seltene Handschriften und Kunstgegenstände und sammelte bei weiteren Reisen Kuriositäten für den König von Frankreich. Früh begann er, sich für Märchen und Folklore zu interessieren, veröffentlichte ein Buch mit indischen Geschichten und Fabeln, ein Werk über den Ursprung des Kaffees und eine Sammlung mit »bemerkenswerten Aussprüchen« der Orientalen. Von 1692 an arbeitete er mit Barthélemy d’Herbelot an der Bibliothèque orientale, einem umfassenden Lexikon der Völker des Orients, ihrer Geschichte und Kultur, ihrer Weisheit und ihres Humors, gespickt mit Anekdoten aus arabischen, türkischen und persischen Chroniken. Zugleich Nachschlagewerk und vergnügliches Lesebuch, bildete es den Grundstein der europäischen Orientalistik.
Während Galland für die Bibliothèque orientale recherchierte, fiel ihm eine alte Handschrift des Erzählzyklus um Sindbad den Seefahrer in die Hände, den er übersetzte und 1701 mit großem Erfolg veröffentlichte. Eine spanische Übersetzung war bereits im Jahr 1253 erschienen, ohne im übrigen Europa Verbreitung zu finden. Das arabische Original stammt vermutlich aus dem frühen 9. Jahrhundert und ist älter als das älteste erhaltene Fragment der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Der Ursprung Sindbads liegt also nicht in diesen beliebten Märchen, sondern in einem anderen Genre der mittelalterlichen islamischen Literatur, der sogenannten »Wunderbücher«. Diese sonderbaren, heute fast unbekannten Werke plünderten Reiseberichte, historische Chroniken, Überlieferungen aus der griechischen und römischen Antike und stellten Sammlungen über Adscha’ib (»Wunder«) zusammen: seltsame Phänomene aus aller Welt, Ungeheuer, Kuriositäten, gespenstische Erscheinungen, verrückte Abenteuer und fantastische Irrfahrten. Man machte keinen Unterschied zwischen Legenden und geschichtlichen Tatsachen. Oft versuchte man, die Glaubwürdigkeit der Schilderungen zu unterstreichen, indem man eine bestimmte Person namentlich als zuverlässige Quelle anführte. Zuweilen scheint sich aber auch eine gewisse Ironie eingeschlichen zu haben, wie in der folgenden Einführung: »Der Kapitän Abu’z-Zahr el-Barchati erzählte mir die folgende Geschichte von ibn-Enschartu, einem seiner Onkel von Seiten der Mutter, der sie wiederum aus dem Munde seines Vaters hatte.« Das klingt schon einmal äußerst vertrauenswürdig, nicht wahr? Der Autor berichtet daraufhin von einer Insel, auf der Menschen mit Fischen verkehrten und eine neue Spezies von Fischmenschen zeugten, die an Land und im Meer gleichermaßen heimisch sind. Es handelt sich eigentlich um reinstes Seemannsgarn, präsentiert von Buzurg ibn Schahriyar (»Bozorg« in der deutschen Erstübersetzung), einem arabischen Kapitän und Kartografen, der alles Sonderbare und Bemerkenswerte aufschrieb, was seine Schiffskameraden und andere Seeleute in fernen Ländern aufgeschnappt hatten. Sein Buch Die Wunder Indiens (Adscha’ib el-Hind)wird immer wieder als Quelle für Sindbads Abenteuer genannt, stammt jedoch vermutlich aus einer späteren Epoche, aus dem 10. Jahrhundert, und beschränkt sich keineswegs auf Indiens Sehenswürdigkeiten. Die Gerüchte und Geschichten stammen aus aller Welt, auch aus Persien, China und Afrika. Buzurg ist vermutlich ein Pseudonym, doch seine maritimen Anekdoten sind keine Produkte einer überspannten Fantasie, sondern Nacherzählungen von alten bis uralten Überlieferungen, wie man sie sich vor rund tausend Jahren während der langen Nachtwachen auf arabischen Handelsschiffen erzählte. Und aus solchen, über Generationen mündlich weitergegebenen Geschichten mögen tatsächlich die fantastischen Erlebnisse Sindbads auf seinen sieben Reisen entstanden sein.
Die Wunder Indiens ist nie vollständig ins Deutsche übersetzt worden, 1883 erschien eine zweisprachige, französisch-arabische Ausgabe in Leiden, 1928 eine darauf basierende englische. Die kleine Auswahl, die 1949 auf Deutsch veröffentlicht und zu Unrecht rasch vergessen wurde, enthält jedoch etliche auffällige Parallelen zu den beliebten Sindbad-Geschichten. Sindbads erste Reise führt zu einer Insel, die sich als Rücken eines riesigen Fisches erweist. Buzurg erwähnt eine Insel, die sich als Panzer einer Schildkröte herausstellt. Auf der zweiten Reise begegnet Sindbad dem Riesenvogel Roch, und auch Buzurg weiß einiges über vergleichbar großes Federvieh zu berichten. Ebenso über Kannibalen und Schlangen, gegen die Sindbad auf seiner dritten Reise heldenhaft antritt. Schiffbrüche in fernen Ländern, wie Sindbad sie immer wieder erleiden muss, sind bei Buzurg ein häufiges Thema, und er spricht auch gern von gewaltigen Schätzen und Kostbarkeiten, die von wagemutigen Reisenden entdeckt wurden oder noch auf einen Entdecker warteten.
In Die Wunder Indiens wird darüber spekuliert, wie bestimmte Tierarten entstanden sind. Der Elefant, so heißt es, sei das Ergebnis einer Vermählung von Schwein und Büffel, der Affe sei aus einer Kreuzung von Mensch und Hyäne hervorgegangen, und die Fischer, die oft lange, sehr lange Zeit einsam auf dem Meer verbringen, seien verantwortlich für ein Volk von Fischen mit Körpern, Händen und Füßen der Adamssöhne. Diese merkwürdigen Chimären und Zwitterwesen tauchen auch in den Sindbad-Geschichten auf. Am bekanntesten ist vielleicht der seltsame Alte, der sich von Sindbad auf den Schultern tragen lässt und nicht wieder absteigen will. Erst nachdem der Held den Schurken durch eine List bezwungen hat, erfährt er von anderen Seeleuten die Wahrheit: »Der, so dir auf der Schulter ritt, heißt der Schaikh Al-Bahr oder der Alte vom Meere, und keiner hat je seine Beine auf dem Nacken gespürt und ist lebend davongekommen, außer dir; und die, so unter ihm sterben, verzehrt er; also Preis sei Allah für deine Rettung!« Nun ist Schaik Al-Bahr auch die arabische Bezeichnung für das Walross. Hat Sindbad also die ganze Zeit ein Walross auf den Schultern getragen? Eher nicht, denn ein Wesen wie das in dieser Geschichte beschriebene erscheint auch in vielen asiatischen Spukgeschichten. Daran lässt sich ermessen, wie weit arabische Seefahrer nach Osten vordrangen, nicht nur nach Indien, sondern weiter nach Thailand und China. Kapitän Buzurgs kleine Sammlung fantastischer Seemannsgeschichten weist in dieselbe Richtung und erzählt von den Wundern am Hof des chinesischen Kaisers: einem Garten, dessen Blumen naturgetreu aus Seide gefertigt wurden, einem Teich, in dem kostbare Perlen die Kieselsteine ersetzen, von Magnetbergen, die Schiffe, ob ihrer Eisenbeschläge, rettungslos anziehen, und vieles mehr.
Der Schauplatz der meisten Geschichten lässt sich jedoch nicht genau verorten. Sie spielen im Niemandsland der Fantasie und im Ozean der Fabulierkunst, wie jene von der Insel der Frauen, auf die es ein paar Schiffbrüchige verschlägt: »Während alle über ihre Rettung frohlockten, erschien unversehens eine Schar Frauen aus dem Inneren der Insel, und nur Gott allein wusste, wie viele es waren. Sie stürzten sich auf die Männer, Tausend Frauen auf jeden Mann, und schleppten ihn in die Berge, wo sie ihn zwangen, zum Werkzeug ihrer Lust zu werden. Sie kämpften stets von neuem miteinander, und der Mann gehörte der Stärksten. Die Männer starben an Erschöpfung.«
Man fragt sich, wie der wackere Sindbad die Prüfungen dieser Insel bestanden hätte, doch er ist leider vorbeigesegelt. Allerdings entsprechen der Aufbau und die Moral der Geschichte voll und ganz Sindbads überlieferten Abenteuern. Es beginnt mit dem altbewährten Schiffbruch an einem fremden Gestade, dann folgt die Begegnung mit gefährlichen Tieren, Kreaturen oder Menschen (in diesem Fall liebeshungrige Frauen), die nebenbei einen gewaltigen Schatz hüten (die Fraueninsel verfügt über eine reiche Goldader). Die Seeleute sterben, und nur einem, dem Kapitän, gelingt es, mitsamt dem Schatz (dem Gold und einer schönen Frau) zu fliehen.
Sindbads Geschichten sind also gewissermaßen eine Blaupause für unzählige fantastische Abenteuer- und Reisegeschichten vom Mittelalter bis in unsere Zeit. Im 14. Jahrhundert schilderte der Lütticher Arzt Jean de Bourgogne unter dem Pseudonym Sir John Mandeville existierende und erfundene Wunder ferner Länder, ohne selbst jemals weit gereist zu sein. Später wurde das Erfolgsrezept gern mit satirischen Ansätzen verquickt, Beispiele sind etwa Schelmuffskys wahrhaftige curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und zu Lande (1696) von Christian Reuter, Jonathan Swifts Gullivers Reisen (Gulliver’s Travels, 1726) und Gottfried August Bürgers Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (1786). Bürger, der sich bei einer auf Englisch verfassten Anekdotensammlung von Rudolf Erich Raspe bedient hatte, fand in Deutschland zahlreiche Bewunderer und Nachahmer.
Die Autoren des späten 19. Jahrhunderts verzichteten weitgehend auf Ironie und Satire und kehrten zurück zu dem ursprünglichen Konzept, demgemäß die Reisen zu fernen Inseln und unbekannten Ländern sowie die sich daraus ergebenden Abenteuer vor allem eine Bewährungsprobe für junge, nicht selten äußerst patriotisch gesinnte Männer darstellen. Diese Grundidee prägte die Romane und Erzählungen von Henry Rider Haggard, Friedrich Wilhelm Mader und Jules Verne.
In den Groschenromanen und der Science-Fiction-Literatur des frühen 20. Jahrhunderts, aber auch in entsprechenden Comics und Filmen tauschte man die obligatorische Insel bald gegen ferne Planeten ein, auf denen Astronauten statt Seefahrer stranden und ihre Tapferkeit, Kraft und Intelligenz beweisen müssen. Die letztgenannte Tugend wurde allerdings manchmal für unnötig befunden, insbesondere, wenn die emsigen Drehbuchschreiber Hollywoods Hand anlegten. So findet man Kapitän Buzurgs tausend Jahre alte Geschichte von der Fraueninsel tatsächlich als grellbuntes Filmspektakel über einen Frauenplaneten wieder. In den Krallen der Venus lautete der schöne deutsche Titel, Zsa Zsa Gabor spielte die glamouröse Amazonenkönigin inmitten von Pappkulissen (Queen of Outer Space, 1958).
Auch Sindbads Abenteuer wurden immer wieder verfilmt. Nicht ganz werkgetreu, aber gelegentlich mit viel Charme. In meiner Kindheit liebte ich Sindbads siebte Reise (1958). Der verlockende Werbespruch auf dem Filmplakat lautete: »Sindbad im Kampf gegen die Giganten der Fabelwelt«, und er kämpfte tatsächlich gegen Zyklopen, Sirenen, Magier, Drachen, einen zweiköpfigen Adler und ein Skelett. Dies hat zwar wenig mit dem Original zu tun, entspricht aber voll und ganz der Sensationslust der mittelalterlichen Wunderbücher.
Die meisten der in diesem Buch erwähnten Autoren haben irgendwann in ihrem Leben die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht gelesen und sich davon inspirieren lassen. Im englischen Sprachraum war Edward Lanes geglättete, prüde Fassung von 1840 die populärste, während Richard Burtons deftige, fantasievolle Nachdichtung von 1885 nur in kleiner Auflage erschien und als pornografisch galt. Doch Antoine Gallands Ausgabe lag bereits ab 1706 in englischer Übersetzung vor und regte etliche Imitationen an. Der Dichter und Philosoph Samuel Taylor Coleridge, dessen Poem Kubla Khan von seiner Liebe zu orientalischen Märchen zeugt, hatte die Geschichten im Alter von sechs Jahren entdeckt und davon so schreckliche Albträume bekommen, dass sein Vater ihm die heiß geliebten Bände wegnahm und im Kamin verbrannte. Dies hinderte ihn nicht daran, seine Fantasie in Regionen vordringen zu lassen, in die sich nicht einmal Sindbad, das Urbild aller tapferen Seefahrer, gewagt hätte.
Der alte Seemann
Dass Seevögel Wind und Wetter beeinflussen, gilt seit der Antike als selbstverständlich. Der Eisvogel (Alcedo ispida) wurde schon bei Plinius, Vergil und Theokrit als besonderes Tier erwähnt, das die Wellen zu glätten vermag und damit für »halkyonische Tage« sorgt, welche für die Seefahrt besonders günstig sind. Die lateinische Bezeichnung Alcedo geht zurück auf Alkyone, eine griechische Sagengestalt, die um ihren Gemahl trauerte und, wie Ovid in seinen Metamorphosen erzählt, nach ihrem Tod in einen Eisvogel verwandelt wurde. Während der Eisvogel unweigerlich gutes Wetter verheißt, wird das Erscheinen des Sturmvogels seit jeher als Vorzeichen eines Unwetters gewertet. So in Barry Cornwalls Ballade The Stormy Petrel, die der österreichische Komponist Sigismund Ritter von Neukomm 1835 vertonte und im deutschen Sprachraum bekannt machte. Über den Albatros sind indes widersprüchliche Sagen im Umlauf. Meist gilt das Tier als Verkörperung der Seele eines ertrunkenen Seemanns, weshalb es Unglück bringt, es zu töten. Aus diesem Aberglauben, vielleicht aber auch aus der Vorstellung, mit ein bisschen Magie für guten Wind sorgen zu können, entwickelte sich unter Matrosen der seltsame Brauch, einen Albatros im Flug zu fangen und wieder freizulassen. In Samuel Taylor Coleridges Ballade vom alten Seemann (The Rime of the Ancient Mariner), einem der schönsten und einflussreichsten Gedichte der englischen Romantik, kommen all diese Vorstellungen zur Geltung und werden auf äußerst fantasievolle Weise neu interpretiert.
Die lange Ballade in sieben Teilen erschien in ihrer ersten Fassung 1798. Coleridges ursprüngliche Absicht war es, eine schlichte Schauermär über die Irrfahrten eines Mannes zu schreiben, der eine schreckliche Schuld auf sich geladen hat, sie an eine Zeitschrift zu verkaufen und damit eine mehrtägige Wandertour mit seinem Freund, dem Dichter William Wordsworth, zu finanzieren. Die Idee, das Töten eines Albatros zum eigentlichen Anlass der Odyssee des alten Seemanns zu machen, stammte tatsächlich von Wordsworth. Er hatte in dem Reisebericht des Freibeuters George Shelvocke, A Voyage Round the World by the Way of the Great South Sea (1726), über einen merkwürdigen Vorfall gelesen: Shelvockes Schiff, das weit in den Süden vorgedrungen war, wurde mehrere Tage von einem erschöpft wirkenden schwarzen Albatros verfolgt. Der Erste Offizier Simon Hatley beobachtete den Vogel mit großer Sorge und hielt den hartnäckigen Verfolger für ein böses Omen. Das unheimliche Gefühl wurde bestärkt durch widrige und stürmische Gegenwinde, sodass Hatley schließlich zu der Überzeugung kam, den Vogel erschießen zu müssen.
Coleridge übernahm die Tat, aber nicht das Motiv. Zunächst griff er auf den viel älteren Mythos zurück, demzufolge der Albatros die Seele eines Matrosen birgt:
Und schließlich schoss ein Albatros
Quer durch die Nebelschwaden;
Als wär er eines Christen Geist,
Wir grüßten in Gottes Namen.
Der Vogel erweist sich als hilfreicher Geist, der das im Eis des Südpolarmeeres gefangene Schiff zu befreien vermag und für günstigen Wind zu sorgen scheint. Der Seemann erschießt das zahme Tier aus einer Laune heraus, woraufhin ihn seine Kameraden verfluchen:
Und ich beging eine böse Tat,
Die ihnen Unheil verhieß:
Sie sagten, ich schoss den Albatros,
Das Tier, das den Wind wehen ließ.
Sie sagten, du Narr, du tötetest gar
Das Tier, das den Wind wehen ließ!
Obwohl der günstige Wind noch eine Weile anhält, gerät das Schiff bald in eine Kalme, wo grässliche Meeresungeheuer hausen, und die Matrosen, die dem alten Seemann die Schuld an ihrer Notlage geben, hängen ihm anstelle des Kruzifixes den toten Albatros um den Hals. Nach langer Zeit sichtet die Crew ein Segel am Horizont, das Rettung verheißt. Tatsächlich handelt es sich um ein gespenstisches Skelettschiff, auf dem der Tod und seine Frau Nachtmahr Untot um das Schicksal der Seeleute würfeln. Sie müssen alle sterben – alle, bis auf den alten Seemann, der zum Weiterleben verdammt wird wie der rastlos umherziehende Brudermörder Kain oder der sagenhafte Ewige Jude. Coleridge hatte schon in jungen Jahren geplant, Verserzählungen über diese biblischen Gestalten zu schreiben, und verarbeitete das Motiv des verfluchten Wanderers nun in seiner Ballade. Im Unterschied zu diesen uralten Geschichten findet der alte Seemann einen Weg zur Erlösung. Er begreift, dass alle Geschöpfe, sogar die Monstren der Kalme, eine eigene Schönheit besitzen und von ihrem Schöpfer geliebt werden:
Ich sah im Schatten meines Schiffs
Die Pracht der Seeungeheuer:
Blau, Samtschwarz und glänzend Grün,
Und jede Spur des Tanzes schien
Ein Blitz aus goldenem Feuer.
Die Erkenntnis erlöst ihn von dem Schandmal, dem toten Albatros, der nun von seinem Hals abfällt und im Meer versinkt. Elementargeister fahren daraufhin in die Körper der toten Matrosen und lenken das Schiff zurück in die Heimat des alten Seemanns, der gezwungen ist, seine Geschichte weiterzuerzählen und die Menschen Ehrfurcht vor der Schöpfung zu lehren:
Das beste Gebet ist die Liebe
Zu Allem, ob groß oder klein;
Denn Gottes Liebe zu Allem
Kann jedem teilhaftig sein.
Die Botschaft der Ballade hat ihre Wurzeln im christlichen Glauben Coleridges, der als Sohn eines gebildeten Landpfarrers in Devonshire aufwuchs. Doch der Grundgedanke, dass Gott seine Schöpfung liebt, findet sich eigentlich in allen mystischen Auslegungen der Weltreligionen: in den Gedichten des Sufi-Dichters Rumi ebenso wie in der jüdischen Kabbala.
Die Ballade vom alten Seemann ist jedoch viel mehr als ein christlich-mystisches Gedicht. Coleridge gelang die Erschaffung eines neuen Mythos, der seine Kraft aus unzähligen älteren, sowohl antiken als auch folkloristischen und biblischen Mythen bezog. Sein Einfluss auf nachfolgende Autoren, die sich mit dem Meer und der Seefahrt beschäftigten, ist kaum zu überschätzen. Man kann davon ausgehen, dass in so gut wie jedem englischsprachigen Roman, der nach 1798 geschrieben wurde und auch nur andeutungsweise Leben, Arbeit und Mythen der Matrosen thematisiert, irgendwo ein Zitat oder eine versteckte Anspielung auf den Albatros und seinen verfluchten Mörder auftaucht. Mary Shelley erwähnt ihn in ihrem Frankenstein (1818); sie hatte die Ballade als kleines Mädchen noch aus dem Mund des Dichters gehört, der bei ihrem Vater William Godwin zu Gast war, und sich eigens hinter dem Sofa versteckt, um Coleridges Vortrag nicht zu versäumen. Herman Melville erwähnt ihn in Moby-Dick (1851) und schreibt: »Bedenke den Albatros: woher rühren jene Wolken spiritueller Verwunderung und bleichen Entsetzens, in welchen dieses weiße Phantom in all jenen Vorstellungen dahinsegelt? Nicht Coleridge schleuderte als erster diesen Zauberbann; sondern Gottes großer, unbestechlicher Hofpoet, die Natur!«
Melville schildert in einer Fußnote, wie sehr ihn der Anblick eines Albatros in den Bann zog, als er auf einer Seereise zum ersten Mal einen solchen erblickte: »Durch seine unaussprechlichen, befremdlichen Augen hindurch erhaschte ich, so dünkte mich, einen Blick auf Geheimnisse, welche Gott erfaßten.« Im Roman fängt der Kapitän das Tier mit einer Wurfleine, befestigt ein Lederbillet mit Schiffsnamen, Datum und Koordinaten und macht so das Wunderwesen zu einem prosaischen Postboten.
Samuel Coleridge hatte im Alter von fünfundzwanzig Jahren, als er seine Ballade verfasste, noch nie das Deck eines Schiffes betreten. Sein gesamtes Wissen stammte aus Reisebüchern, die er, zusammen mit Fachliteratur aus allen möglichen Bereichen, stapelweise verschlang. Hinzu kamen Geschichten, die er zufällig aufschnappte, wie jene von dem unheimlichen Skelettschiff, das dem Albtraum seines Freundes John Cruikshank entsprang. Coleridge hatte während seiner Schulzeit und seines Studiums jedoch auch Kontakt zu echten Seefahrern: William Wales zum Beispiel, ein Mathematikprofessor an einer Londoner Knabenschule, war mit James Cook gesegelt und erzählte von seinen Abenteuern. Er lud auch andere Seeleute ein, um Vorträge vor seinen Schützlingen zu halten und ihnen so eine lebensnahe Bildung zu vermitteln. Einer dieser Redner war ein von Wind und Wetter gegerbter Pelzhändler der Hudson Bay Company namens Samuel Hearne. Er berichtete den atemlos lauschenden Schülern von seinen Erlebnissen als Kadett der Royal Navy während des Siebenjährigen Krieges und von seinen Reisen in die Arktis, seiner Suche nach der Nordwestpassage und seinen monatelangen Wanderungen mit nordamerikanischen Indianern, um eine entlegene Kupfermine zu finden. Jahre später las Coleridge Hearnes spannenden Reisebericht A Journey from Prince of Wales’s Fort in Hudson’s Bay to the Northern Ocean (1795). In diesem Buch wird ein Massaker an einem friedlichen Indianerstamm geschildert, und es wurde spekuliert, dass diese ungeheuerliche Bluttat und Samuel Hearnes daraus folgende Schuldgefühle eine wichtige Inspiration für die Ballade vom alten Seemann darstellten, in der es ebenfalls um Schuld und die Suche nach Vergebung geht. Dies erscheint jedoch fraglich, wenn man bedenkt, wie viele andere historische und mythische Gestalten als Vorbild für die literarische Figur infrage kommen.