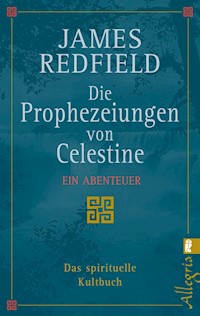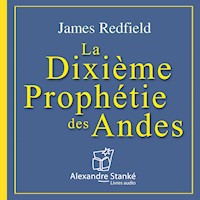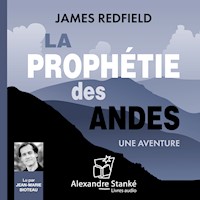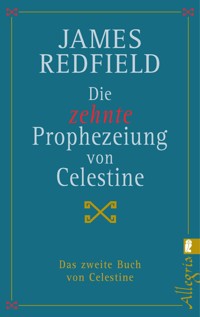
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mit einer neuen, in sich abgeschlossenen Erzählung nimmt James Redfield in diesem Buch die Geschichte von Celestine wieder auf und schickt seine Leser auf die atemberaubende Suche nach der zehnten Prophezeiung, in der ein neuer Schlüssel zum Überleben der Menschheit verborgen ist. Die Geschichte der zehnten Prophezeiung ist eine Parabel voller verblüffender Erkenntnisse, die unseren Blickwinkel erweitern und unserem Leben einen neuen Sinn geben können. James Redfield lässt die Vision einer neuen Spiritualität vor unseren Augen auferstehen, die uns verändern kann... und vielleicht sogar die ganze Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
James Redfield
Die zehnte Prophezeiung von Celestine
Aus dem Amerikanischen von Mascha Rabben
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Allegria im Ullstein Taschenbuch Herausgegeben von Michael Görden Aus dem Amerikanischen übersetzt von Mascha Raben Titel der Originalausgabe THE TENTH INSIGHT. HOLDING THE VISION Erschienen bei Warner Books, Inc., New York, NY
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Januar 2005 9. Auflage Oktober 2012 © der deutschsprachigen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005 © der deutschsprachigen Ausgabe Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München 1996 © der Originalausgabe by James Redfield 1996 Umschlaggestaltung: FranklDesign, München Titelabbildung: Shivananda Ackermann eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-8437-0788-6
Widmung
Für meine Frau und Inspiration Salle Merrill Redfield
Anmerkung des Autors
Diese Abenteuergeschichte ist eine Parabel, wie auch Die Prophezeiungen von Celestine, ein Versuch, den spirituellen Gesinnungswandel in unserer Zeit zu beschreiben. In beiden Büchern ging es mir in erster Linie darum, eine neuartige Lebensanschauung zu vermitteln, ein sogenanntes Realitätsbild, in dem bislang ungewöhnliche Wahrnehmungen, Gefühle und Phänomene eine tragende Rolle spielen, weil ich und viele andere inzwischen zu der Überzeugung gelangt sind, daß diese Wahrnehmungsweisen unser Dasein beim Übergang in das dritte Jahrtausend in zunehmendem Maße bestimmen.
Meiner Ansicht nach besteht unser größter Irrtum in der Annahme, daß die menschliche Spiritualität bereits hinlänglich verstanden und etabliert worden ist. Der gesamten Kulturgeschichte kann man entnehmen, daß sich unser Wissen und unsere Fähigkeiten unaufhörlich fortentwickelt haben. Nur individuelle Meinungen bleiben festgelegt und dogmatisch. Die Wahrheit ist dynamischer, weitaus lustvoller, und wenn es uns gelingt, die alten Vorstellungen loszulassen, entdecken wir neue Wahrheiten, die sich im Zusammenhang mit anderen Sichtweisen ebenfalls ständig weiterentwickeln und Formen annehmen, die irgendwann klar genug sind, um eine entscheidende Wende im Leben eines Menschen auszulösen.
Wir gehen einen gemeinsamen Weg, bei dem jede Generation eindeutig auf den Leistungen der vorangegangenen aufbaut, nur ist uns das Ziel dieses Weges entfallen. Heute wird jeder von uns herausgefordert, sich daran zu erinnern, wer er oder sie in Wirklichkeit ist und was wir gemeinsam auf dieser Erde hervorbringen wollen. Ich sage nicht, daß es leicht sein wird, bin jedoch fest davon überzeugt, daß wir jedes Hindernis und jede persönliche Schwierigkeit überwinden können, wenn wir das Beste von allen herkömmlichen Traditionen erhalten und unserem Gespür für das Wunderbare und Schicksalhafte folgen.
Damit will ich das Ausmaß der Probleme, mit denen die Menschheit noch fertig werden muß, in keiner Weise trivialisieren, sondern nur darauf hinweisen, daß alle auf ihre ureigene Art mit der Lösung dieser Probleme verknüpft sind. Wenn wir bewußt bleiben und das Mysterium des Lebendigseins gebührend würdigen, wird uns klar, daß wir uns am richtigen Platz und in genau der richtigen Position befinden,… um alles zu verändern.
James Redfield, Frühjahr 1996
Danksagung
Ich möchte jedem, der an der Entstehung dieses Buches beteiligt war, sehr herzlich danken, besonders Joann Davis von Warner Books für ihre fortlaufende Betreuung und Albert Gaulden für seinen guten Rat. Und nicht zuletzt meinen Freunden in den Blue Ridge Mountains, die das Feuer niemals erlöschen lassen.
Danach sah ich,
und siehe, eine Tür war auf getan im Himmel,
und die erste Stimme,
die ich mit mir hatte reden hören
wie eine Posaune, die sprach:
Steig herauf, ich will Dir zeigen,
was nach diesem geschehen soll.
Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen.
Und siehe, ein Thron stand im Himmel,
und auf dem Thron saß einer.
Und der da saß, war anzusehen
wie der Stein Jaspis und Sarder;
und ein Regenbogen war um den Thron,
anzusehen wie ein Smaragd.
Und um den Thron
waren vierundzwanzig Throne,
und auf den Thronen
saßen vierundzwanzig Älteste,
mit weißen Kleidern angetan.
Und ich sah einen neuen Himmel
und eine neue Erde;
denn der erste Himmel
und die erste Erde sind vergangen.
OFFENBARUNG DES JOHANNES
Bildliche Vorschau
Ich trat an den Rand des Felsvorsprungs und blickte gen Norden auf die Landschaft unter mir. Vor mir ausgebreitet lag ein weitläufiges Bergtal der Appalachen von sechs bis sieben Meilen Länge, ungefähr fünf Meilen Breite und von atemberaubender Schönheit. Ein Ruß schlängelte sich längs durch das Tal, an grünen Flächen offenen Wiesenlands vorbei und zwischen dichten, herbstlich bunten Wäldern hindurch. Dies waren alte Wälder mit Bäumen, die Hunderte von Metern in die Höhe ragten.
Ich warf einen kurzen Blick auf die handgezeichnete Landkarte in meiner Hand. Alles in diesem Tal entsprach der Darstellung genau: die steile Klippe, auf der ich jetzt stand, der Pfad, der ins Tal hinabführte, die Wiesen und der Fluß, selbst die sanft anschwellenden Hügelketten im Hintergrund. Es mußte sich um den Platz handeln, den Charlene auf ihrer flüchtigen Skizze dargestellt hatte. Aber was hatte sie dazu bewogen? Das Stück Papier war in ihrem Büro gefunden worden. Aber warum war Charlene so plötzlich verschwunden?
Mehr als ein Monat war vergangen, seit Charlene ihre Kollegen in dem Forschungsunternehmen, wo sie arbeitete, zum letztenmal kontaktiert hatte, und als Frank Carter, ein enger Mitarbeiter, endlich auf die Idee gekommen war, mich anzurufen, klang seine Stimme deutlich alarmiert.
»Wir wissen, daß sie gern ihre eigenen Wege geht«, hatte er gesagt. »Aber so lange ist sie noch nie verschwunden, schon gar nicht, wenn sie feste Termine mit langjährigen Klienten hatte. Da stimmt etwas nicht.«
»Wie kamen Sie darauf, mich anzurufen?« fragte ich.
Daraufhin beschrieb er den Inhalt eines Briefes, der in Charlenes Büro gefunden worden war. Ich hatte ihn vor Monaten an Charlene geschickt, um ihr meine Erlebnisse in Peru zu schildern. Carter erklärte, daß ein Zettel dabeigelegen habe, auf dem mein Name und meine Telefonnummer standen.
»Ich rufe jeden Bekannten von ihr an, dessen Nummer ich finden kann«, fügte er hinzu. »Aber bis jetzt weiß scheinbar keiner, was los ist. Aus dem Brief ging hervor, daß Sie mit ihr befreundet sind, und so habe ich gehofft, Sie hätten vielleicht etwas von ihr gehört.«
»Tut mir leid«, sagte ich. »Ich habe seit vier Monaten nicht mehr mit ihr gesprochen.«
Während ich die Worte aussprach, kam es mir selbst unwahrscheinlich vor, daß inzwischen soviel Zeit vergangen sein sollte. Kurz nach dem Eintreffen meines Briefes hatte Charlene eine längere Nachricht auf meinem Anrufbeantworter hinterlassen, in der sie ihre Erregung über die Entdeckung der Erkenntnisse zum Ausdruck brachte und die Geschwindigkeit hervorhob, mit der sich dieses Wissen jetzt offenbar verbreitete. Dann fiel mir ein, daß ich Charlenes Botschaft zwar mehrfach angehört, sie aber nie zurückgerufen hatte, weil ich meinte, es auf später verschieben zu können – auf den nächsten Tag vielleicht, oder den übernächsten, wenn ich innerlich bereit dazu wäre. Ein solches Gespräch, so meinte ich, verlangte eine klare Zusammenfassung des Inhalts und ausführliche Erklärungen zum Manuskript, und dazu benötigte ich noch etwas Zeit zum Nachdenken, denn ich hatte die Ereignisse noch nicht verdaut.
In Wahrheit war mir der Sinn der Prophezeiungen natürlich weiterhin nur teilweise verständlich. Sicher, die Fähigkeit, mich mit einer inneren, spirituellen Energie zu verbinden, war mir erhalten geblieben, was ein großer Trost war, wenn ich daran dachte, daß meine Liebesaffäre mit Marjorie endgültig beendet war und ich den größten Teil meiner Zeit nun allein verbrachte. Auch hatte ich weiterhin die Fähigkeit, meine Eingebungen, Träume und die Leuchtkraft eines Raumes oder einer Landschaft bewußt zu erleben. Dennoch war die Tatsache, daß schicksalhafte Fügungen sich von Natur aus nur sporadisch ergeben, zum Problem für mich geworden.
Ich konnte mich beispielsweise mit Energie auffüllen und damit die momentan dringlichste Frage in meinem Leben aufspüren, worauf mir gewöhnlich ein klares Bild eingegeben wurde, das mir zeigte, was ich tun und wohin ich mich wenden sollte, um der Antwort auf die Spur zu kommen. Aber selbst wenn ich meinen Eingebungen entsprechend gehandelt hatte, geschah nur selten etwas Bedeutungsvolles, und ich konnte beim besten Willen keine Botschaft oder sonderliche Fügung wahrnehmen.
Dies galt speziell in Fällen, wo die Intuition mir aufgetragen hatte, einen Bekannten zu besuchen, einen Freund oder jemanden, mit dem ich häufig zu tun hatte. Hin und wieder entdeckten wir dann vielleicht einen neuen Ansatzpunkt des gemeinsamen Interesses, aber ebenso häufig wurde meine Initiative trotz stärkster Energiezufuhr von meiner Seite rundweg abgeschmettert, oder – noch schlimmer – unser anfänglicher Eifer entgleiste und wurde schließlich unter einer Flut unberechenbarer Irritationen und Gefühle begraben.
Solche Fehlschläge hielten mich zwar nicht davon ab, den Prozeß fortzuführen, doch war mir inzwischen klargeworden, daß etwas fehlte, wenn ich die Erkenntnisse auf lange Sicht in die Praxis umsetzen wollte. In Peru war ich vom Strom der Ereignisse getragen worden und hatte zumeist spontan reagiert – mit einer Art von Urvertrauen, das aus nackter Verzweiflung geboren wird. Wieder daheim angekommen und mit meiner gewohnten Umgebung konfrontiert, nicht selten von ausgesprochenen Skeptikern umgeben, kam mir offenbar die notwendige Erwartungshaltung abhanden bzw. der feste Glaube, daß meine Eingebungen wirklich zu etwas führen könnten. Womöglich hatte ich einen bedeutenden Teil des Wissens wieder vergessen … oder noch gar nicht entdeckt.
»Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll«, hatte Charlenes Kollege gesagt. »Ich glaube, sie hat eine Schwester irgendwo in New York. Sie wissen nicht zufällig, wie man sie erreichen kann? Oder kennen Sie irgend jemanden, der ihre Nummer wissen könnte?«
»Es tut mir leid«, wiederholte ich. »Ich habe keine Ahnung. Charlene und ich haben gerade erst begonnen, unsere alte Freundschaft wieder aufzuwärmen. An ihre Verwandten erinnere ich mich nicht, und wer ihre jetzigen Freunde sind, weiß ich auch nicht.«
»Also, ich glaube, ich melde die Sache jetzt der Polizei, es sei denn, Sie haben einen besseren Vorschlag.«
»Nein, aber ich glaube, das lassen wir lieber noch. Gibt es sonst noch irgendwelche Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort?«
»Nur eine Art Skizze; möglicherweise eine Ortsbeschreibung. Es ist schwer zu sagen.«
Später hatte er mir die besagten Papiere aus Charlenes Büro per Fax geschickt, darunter auch die flüchtige Zeichnung von sich kreuzenden Strichen und Zahlen mit vagen Markierungen am Rand. Und nachdem ich in meinem Schreibzimmer die Ziffern der Zeichnung mit den Nummern der Landstraßen in einem Straßenatlas verglichen hatte, stieß ich auf ein Gebiet weiter südlich, das der Skizze exakt zu entsprechen schien.
Kurz darauf hatte ich Charlene plötzlich sehr deutlich vor mir gesehen: dasselbe Bild, das sich mir damals in Peru schon aufgedrängt hatte, als ich von der Existenz einer Zehnten Erkenntnis hörte. War ihr Verschwinden in irgendeiner Weise mit dem Manuskript verknüpft?
Ein leichter Windhauch strich über mein Gesicht, und ich ließ meinen Blick erneut über die Landschaft unter mir schweifen. Ganz links in der Ferne, am äußersten Westrand des Tales, konnte ich eine Reihe von Hausdächern ausmachen. Das mußte die Stadt sein, die auf Charlenes Zeichnung mit einem Gewirr von Strichen angedeutet wurde. Während ich zur Straße zurücklief und in meinen Wagen kletterte, steckte ich das Papier wieder in meine Westentasche.
Die Stadt selbst war winzig – eine Einwohnerzahl von zweitausend Seelen, wie man dem Schild bei der ersten und einzigen Ampel des Ortes entnehmen konnte. Die Mehrzahl der Geschäftsgebäude lag an der einzigen Hauptstraße, die am Ufer des Flusses entlangführte. Ich rollte an der Ampel vorüber, entdeckte kurz darauf ein Motel unmittelbar am Waldrand, wo sich ein Eingang in das dahinterliegende Naturschutzgebiet befand, und steuerte den Wagen in eine Parklücke direkt vor einem Anbau mit Restaurant und Bar. Mehrere Leute gingen soeben in das Restaurant, unter ihnen ein hochgewachsener Mann mit brauner Haut und pechschwarzem Haar, der einen gewaltigen Rucksack trug. Er drehte sich zu mir um, und für einen Moment hatten wir Blickkontakt.
Ich stieg aus, schloß das Auto ab und beschloß dann, einer Ahnung folgend, zuerst einmal in das Restaurant zu gehen, bevor ich ein Zimmer im Motel buchte. Drinnen waren fast alle Tische leer – ein paar Männer in Wanderkluft hockten an der Bar, und die kurz vor mir angekommene Gruppe hatte in einer Eßnische Platz genommen. Niemand beachtete meinen suchenden Blick; erst als ich weiter in den Raum vordrang, trafen meine Augen erneut mit denen des dunkelhaarigen Mannes zusammen. Er bewegte sich auf das hintere Ende des Raumes zu, lächelte unbestimmt, hielt meinem Blick für eine weitere Sekunde stand und trat dann durch den Rückausgang ins Freie.
Ich folgte ihm. Er stand etwa sechs Meter vor mir und beugte sich über seinen Rucksack. Seine Kleidung bestand aus Jeans, einem Cowboyhemd und Stiefeln; ich schätzte ihn auf etwa fünfzig Jahre. Hinter ihm warf die späte Nachmittagssonne lange Schatten auf die hohen Bäume und das Gras, und kaum hundert Meter weiter begann der Fluß seine Reise hinunter ins Tal.
Er lächelte, schaute zu mir auf und sagte: »Na, bist du auch ein alter Pilger?«
»Ich suche nach einer Freundin von mir«, begann ich. »Irgendwie kommt es mir vor, als könnten Sie mir helfen.«
Er nickte bedächtig und studierte dabei eingehend meine Erscheinung. Beim Nähertreten stellte er sich als David Lone Eagle vor und erklärte mir dann, als wäre die Information von unmittelbarer Bedeutung, daß er ein direkter Nachfahre der Indianer sei, die dieses Tal ursprünglich besiedelt hatten. Nun erst fiel mir die lange Narbe in seinem Gesicht auf; sie erstreckte sich von seiner linken Augenbraue bis hinunter zum Kinn. Die einstige Verletzung hatte den Augapfel offenbar nur haarscharf verfehlt.
»Wie wär‘s mit einem Kaffee?« sagte er langsam. »In dem Saloon da servieren sie zwar gutes Perrier, aber lausigen Kaffee.« Mit einer Kopfbewegung deutete er auf eine Stelle nahe am Fluß, wo ein kleines Zelt zwischen drei üppigen Pappeln stand. Da sich Dutzende von Spaziergängern in der Nähe aufhielten und den Weg entlangwanderten, der über eine Brücke in den Nationalpark führte, schien mir keine sonderliche Gefahr zu bestehen.
»Sehr gern«, sagte ich. »Trinken wir einen Kaffee.«
An seinem Rastplatz angekommen, setzte David einen kleinen Gaskocher in Gang, füllte einen Topf mit Wasser und setzte ihn auf das Feuer.
»Wie heißt deine Freundin?« fragte er schließlich.
»Charlene Billings.«
Er hielt inne, schaute mich durchdringend an, und während unsere Blicke aufeinandertrafen, schob sich ein deutliches Bild von ihm aus einer anderen Zeit vor mein inneres Auge. Er war jünger, in eine Hirschledertracht gekleidet und saß vor einem prasselnden Lagerfeuer. Die Streifen einer Kriegsbemalung zogen sich über sein Gesicht. Um ihn herum hatte sich ein Kreis von Menschen versammelt, die meisten davon Indianer, aber auch zwei Weiße, eine Frau und ein schwergewichtiger Mann. Es war eine heftige Diskussion im Gange. Einige wollten Krieg führen; andere sprachen sich für eine friedliche Lösung des Konflikts aus. Ungeduldig fuhr er dazwischen und verspottete die Friedensstifter. »Wie könnt ihr nur so naiv sein?« herrschte er sie an. »Nachdem wir ein ums andere Mal belogen und betrogen worden sind?!«
Die weiße Frau schien seinen Ingrimm zu verstehen, bat ihn aber flehentlich darum, sie ausreden zu lassen. Sie war ganz sicher, daß ein Krieg verhindert und das Tal vor Angriffen geschützt werden könne, solange die spirituelle Medizin nur stark genug sei. Er schmetterte ihr Argument mit einem Satz ab, wies alle in der Runde zurecht und sprang auf sein Pferd, um davonzureiten. Die meisten der Anwesenden folgten ihm.
»Du hast einen guten Riecher«, verkündete David plötzlich und riß mich damit aus meinem Traum. Er breitete eine handgewebte Decke zwischen uns aus und bot mir einen Platz darauf an. »Ich habe von ihr gehört.«
Dann blickte er mich fragend an.
»Ich mache mir Sorgen um Charlene«, erklärte ich. »Niemand weiß, wo sie abgeblieben ist, und nun möchte ich sicherstellen, daß alles in Ordnung mit ihr ist. Außerdem müssen wir miteinander reden.«
»Über die Zehnte Erkenntnis?« fragte er lächelnd.
»Woher weißt du das?«
»Nur eine Vermutung. Nicht jeder, der in dieses Tal kommt, fühlt sich allein von der Schönheit des Waldes angezogen. Viele sind hier, um über die Erkenntnisse zu sprechen. Es heißt sogar, daß die Zehnte irgendwo hier verborgen ist. Einige behaupten sogar zu wissen, was in der Zehnten Erkenntnis steht.«
Er wandte sich ab und hängte eine mit Kaffee gefüllte Teekugel in das brodelnde Wasser. Etwas an seinem Tonfall verriet mir, daß er mich prüfen wollte, wahrscheinlich, um herauszufinden, ob ich wirklich der war, der ich zu sein vorgab.
»Wo ist Charlene?« fragte ich.
Sein Finger deutete in Richtung Osten. »Im Wald. Ich habe deine Freundin nie gesprochen, aber eines Abends habe ich mitbekommen, wie sie sich in dem Restaurant vorgestellt hat, und seitdem habe ich sie noch ein paarmal gesehen. Zum letztenmal vor ein paar Tagen; sie wanderte allein durch das Tal, und so, wie sie bepackt war, würde ich sagen, daß sie wahrscheinlich noch immer draußen in der Wildnis ist.«
Ich blickte in die angedeutete Richtung. Aus meiner momentanen Perspektive wirkte das Tal gigantisch, erstreckte sich in unabsehbare Weiten.
»Hast du eine Ahnung, wo sie hingegangen sein könnte?«
Er starrte mich einen Moment lang an. »Wahrscheinlich in Richtung Sipsey Canyon. Das ist die Schlucht, wo sie eine der Öffnungen gefunden haben.« Mit wachen Augen beobachtete er meine Reaktion.
»Öffnungen?«
Er lächelte geheimnisvoll. »Ja, du hast richtig gehört: die Öffnungen in den Dimensionen.«
Ich neigte mich vor, denn ich erinnerte mich an mein Erlebnis in den Ruinen von Celestine. »Wie viele wissen inzwischen schon davon?«
»Nur sehr wenige. Bis jetzt handelt es sich lediglich um Gerüchte, Informationsbruchstücke und ansonsten reine Intuition. Keiner hat bisher irgendein Schriftstück in die Hand bekommen. Die meisten suchen hier nach der Zehnten Erkenntnis, weil sie synchronistisch an diesen Platz geführt werden und weil sie sich ernsthaft bemühen, die ersten neun Erkenntnisse zu verwirklichen, auch wenn sie sich darüber beschweren, daß die Fügungen sie eine Zeitlang eindeutig leiten und dann irgendwann einfach aufhören.« Er lachte kurz auf und fuhr fort: »Aber an dem Punkt befinden wir uns alle, nicht wahr? Bei der Zehnten Erkenntnis geht es um ein Verständnis der Gesamtheit dieser Überlieferungen – die Wahrnehmung rätselhafter Fügungen, das wachsende spirituelle Bewußtsein auf Erden, das Verschwinden von Dingen, wie es in der Neunten Erkenntnis beschrieben wird … All das wird von dem höheren Standpunkt der anderen Dimension erklärt, damit wir begreifen, warum alles so und nicht anders verläuft, und mit mehr Einsatz daran teilnehmen können.«
»Und woher willst du das wissen, David?« gab ich zurück.
Er warf mir einen stechenden Blick zu und herrschte mich an: »Ich weiß es!«
Einen weiteren Moment lang blieb sein Ausdruck grimmig, dann erhellte sich sein Gesicht unvermittelt, und er griff nach dem Topf, um den Kaffee in zwei Becher zu gießen. Nachdem er mir einen Becher in die Hand gedrückt hatte, begann er von neuem: »Meine Vorfahren haben seit Tausenden von Jahren in diesem Tal gelebt und immer geglaubt, daß dieser Wald eine heilige Stätte ist, ein Ort auf halbem Wege zwischen der oberen Welt und der mittleren Welt hier auf Erden. Mein Volk hat gefastet und das Tal auf der Suche nach Visionen durchwandert. Wir haben um Einblick in unsere innewohnenden Talente gebeten, um Medizin, um den Weg, der uns vorherbestimmt ist.
Mein Großvater hat mir von einem Schamanen erzählt, der einem weit entfernten Stamm angehörte. Dieser Schamane hat meinen Leuten beigebracht, wie sie einen Zustand der Reinheit, so nannte er es, erreichen können. Genau von diesem Platz hier hat er meine Leute ausgesandt, nur mit einem einzigen Messer ausgerüstet, und ihnen gesagt, daß sie so lange laufen sollen, bis die Tiere ihnen ein Zeichen geben, dem sie folgen müßten, bis sie das erreicht hätten, was wir ›die heilige Öffnung zur oberen Welt‹ nennen. Hatten sie genügend Verdienste erworben, sich also von ihren niederen Gefühlen gereinigt, dann hieß es, daß sie durch die Öffnung zu unseren Vorfahren hindurchgelassen würden, in ein Reich, wo sie sich nicht nur an die eigenen Visionen erinnern könnten, sondern auch an die globale Vision.
Nun ja, das hatte natürlich ein Ende, als der weiße Mann kam. Mein Großvater selbst wußte bereits nicht mehr, wie man dort hingelangt, und ich weiß es auch nicht. Wir müssen alles noch einmal herausfinden, wie jeder andere auch.«
»Du bist hier, weil du nach der Zehnten suchst, nicht wahr?« fragte ich.
»Ja … natürlich! Obwohl ich anscheinend nichts anderes fertigbringe, als den alten Bußgang zu gehen und mich in Vergebung zu üben.« Seine Stimme war wieder schärfer geworden, und es kam mir mittlerweile vor, als spräche er mehr zu sich selbst als zu mir. »Sobald ich einen entscheidenden Schritt tun will, stoße ich auf einen Teil in mir, der die Bitterkeit und den Zorn über das, was meinem Volk angetan wurde, nicht überwinden kann. Und eine Besserung unserer Lage ist auch nicht abzusehen. Wie ist es möglich, daß man uns das Land stiehlt, uns abschlachtet und schließlich unsere ganze Lebensweise vernichtet?! Warum wird so etwas zugelassen?«
»Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert«, murmelte ich.
Er starrte auf den Boden und grunzte plötzlich amüsiert. »Das glaube ich dir. Und trotzdem packt mich die nackte Wut, wenn ich daran denke, wie dieses Tal verhunzt worden ist.«
Er schwieg und zeigte dann unvermittelt auf seine linke Gesichtshälfte. »Meine Narbe ist dir sicher gleich aufgefallen. Den Kampf, bei dem das passiert ist, hätte ich ohne weiteres vermeiden können. Ein paar Cowboys aus Texas hatten etwas zuviel getrunken, und ich hätte mich abwenden können. Aber die Wut hat es mir nicht erlaubt.«
»Steht dieses Tal denn nicht zum größten Teil unter Naturschutz, genau wie der Wald?« fragte ich.
»Ungefähr die Hälfte davon, nördlich des Flusses, aber die Politiker drohen unentwegt mit einem Verkauf der Ländereien, oder wenigstens damit, es zur Nutznießung und Besiedelung freizugeben.«
»Und was ist mit der anderen Hälfte? Wem gehört die?«
»Früher war dieses Gebiet zum größten Teil im Besitz von Einzelpersonen, aber seit neuestem versucht ein Konzern aus dem Ausland die Grundstücke nach und nach aufzukaufen. Wir wissen nicht, wer dahintersteckt, nur daß manchen Grundbesitzern hier schon gewaltige Summen angeboten worden sind.«
Er blickte zur Seite und begann dann von neuem: »Mein Problem ist, daß ich die letzten dreihundert Jahre verändern möchte. Ich finde es eine Unverschämtheit, daß die Europäer dieses Land besiedelt haben, ohne die geringste Rücksicht auf die bereits anwesenden Völkerstämme zu nehmen. Das ist schlichtweg kriminell. Ich wollte, es wäre anders gekommen – als läge es in meiner Gewalt, die Vergangenheit zu berichtigen. Unsere Lebensanschauung war wertvoll. Wir hatten etwas über den Wert des Erinnerns gelernt. Das war die bedeutende Botschaft meines Volkes, und wir hätten sie den Europäern vermittelt, wenn sie zugehört hätten. «
Während er sprach, entstanden erneut Bilder in meinem Geiste. Zwei Menschen – ein älterer Indianer und dieselbe weiße Frau wie zuvor – sprachen miteinander am Ufer eines kleinen Baches. Hinter ihnen lag ein unberührter, dichter Wald. Nach einer Weile kamen weitere Indianer dazu und lauschten der Unterredung.
»Wir können diese Wunden heilen!« insistierte die Frau.
»Ich fürchte, unser Wissen reicht nicht aus«, widersprach der Indianer, aber sein Gesichtsausdruck verriet höchsten Respekt vor der Frau. »Die meisten anderen Häuptlinge sind bereits weggezogen.«
»Das sehe ich nicht ein. Denke an unsere früheren Unterredungen! Du selbst hast gesagt, daß wir alles heilen können, wenn der Glaube stark genug ist.«
»Ja«, antwortete er. »Aber dieser Glaube ist eine Gewißheit, und diese entspringt dem Wissen um das, was sein soll. Die Vorfahren wissen es, aber unter uns weilen nicht mehr genug Lebende, die dieses Wissen erlangt haben.«
»Ist es nicht möglich, das Wissen jetzt noch zu erlangen?« rief die Frau in einem flehenden Ton. »Wir müssen es wenigstens versuchen!«
Meine Gedanken wurden unterbrochen, als mehrere uniformierte Forstbeamte auftauchten, die sich auf der Brücke auf einen älteren Mann zubewegten. Er hatte kurzgeschnittene graue Haare und trug Anzughosen zu einem gestärkten Oberhemd. Es schien, als zöge er ein Bein beim Gehen leicht nach.
»Siehst du den Mann da mit den Forstleuten?« fragte David.
»Ja«, sagte ich. »Was ist mit ihm?«
»Den sehe ich hier schon seit zwei Wochen herumlaufen. Sein Vorname ist Feyman, soweit ich weiß. Den Nachnamen habe ich noch nicht mitgekriegt.« David beugte sich zu mir vor und raunte, als würde er mir zum ersten Mal vollauf vertrauen: »Hör zu, da ist etwas sehr Merkwürdiges im Gange. Seit ein paar Wochen kommt es mir vor, als würden die Forstschutzleute alle Wanderer zählen, die den Nationalpark betreten. Das haben sie noch nie getan, und gestern erzählte mir jemand, daß sie das Ostende des Waldes vollkommen abgesperrt haben. Da hinten gibt es Plätze, die zehn Meilen von der nächsten Straße entfernt sind. Du kannst dir vorstellen, daß kaum ein Mensch jemals so weit in die Wildnis hineinläuft. Manche von uns haben sehr merkwürdige Geräusche aus dieser Richtung wahrgenommen.«
»Was für Geräusche?«
»Eine Art Dissonanz. Aber die meisten können den Ton nicht hören.«
Unversehens war er aufgesprungen und baute sein Zelt ab.
»Was ist denn los?« fragte ich.
»Ich kann hier nicht länger bleiben«, entgegnete er. »Ich muß ins Tal gehen.«
Kurz darauf unterbrach er seine Tätigkeit und schaute mich durchdringend an. »Hör mal«, sagte er. »Ich muß dir was sagen. Der Mann auf der Brücke, dieser Feyman … Ich habe deine Freundin ein paarmal mit ihm zusammen gesehen.«
»Und? Was haben die beiden getan?«
»Nur miteinander gesprochen, aber ich sage dir, da stimmt etwas nicht.« Er wandte sich ab und packte weiter zusammen.
Ich sah ihm einen Moment lang schweigend zu. Ich hatte keine Ahnung, was ich von dieser Situation halten sollte, doch fühlte ich, daß er recht hatte, wenn er davon ausging, daß Charlene irgendwo dort unten im Tal war. »Warte«, sagte ich schnell. »Ich hole meine Ausrüstung und komme mit, wenn es dir recht ist.«
»Nein«, antwortete er ohne Zögern. »Dieses Tal muß jeder Mensch alleine erfahren. Ich kann dir jetzt nicht weiterhelfen. Ich muß meine eigene Vision finden.« Ein schmerzlicher Ausdruck lag auf seinem Gesicht.
»Kannst du mir bitte beschreiben, wo dieser Canyon ist?«
»Du folgst dem Flußlauf für ungefähr zwei Meilen. Dann stößt du auf einen kleinen Gebirgsbach, der von Norden kommt und in den Ruß mündet. Diesem Bach folgst du für eine weitere Meile. Er führt dich direkt zum Eingang von Sipsey Canyon.«
Ich nickte und wandte mich zum Gehen, aber er packte mich am Arm.
»Weißt du«, sagte er leise, »du kannst deine Freundin wiederfinden, wenn du deine Energie anhebst. Im Tal gibt es bestimmte Plätze, die dir dabei behilflich sein können.«
»Die Öffnungen in den Dimensionen?« fragte ich.
»Genau. Dort kannst du die Perspektive der Zehnten Erkenntnis einnehmen, aber um solche Plätze zu finden, mußt du die wahre Natur deiner Intuitionen verstehen und begreifen, wie diese geistigen Bilder aufrechterhalten werden können. Achte auf die Tiere ringsumher, dann erinnerst du dich vielleicht daran, was du in diesem Tal zu suchen hast… und warum wir alle hier zusammenkommen. Aber sei vorsichtig, und paß auf, daß die Forstleute dich nicht beim Betreten des Waldes beobachten.« Er dachte einen Moment nach. »Ein Freund von mir treibt sich ebenfalls in der Wildnis dort herum, sein Name ist Curtis Webber. Wenn du Curtis triffst, dann sag ihm, daß du mit mir gesprochen hast und daß ich ihn irgendwann finden werde.«
Er schenkte mir ein kaum merkliches Lächeln, dann wandte er sich wieder dem Zeltabbau zu.
Zu gern hätte ich ihn gefragt, was er mit seiner Anspielung auf die wahre Natur der Intuition und das Beobachten der Tiere gemeint hatte, aber er vermied jeden Augenkontakt und konzentrierte sich einzig auf das Zusammenpacken.
»Danke«, sagte ich.
Er winkte vage mit einer Hand.
Leise schloß ich die Tür des Motelzimmers hinter mir ab und schlüpfte hinaus in das Mondlicht. Die kalte Luft und die innere Anspannung ließen meinen Körper erschauern. Was veranlaßte mich eigentlich, hier herumzulaufen? Es gab weder Beweise für Charlenes Aufenthalt in diesem Tal noch Anhaltspunkte für Davids Argwohn. Und doch hatte ich ein Gefühl im Bauch, daß etwas nicht stimmte. Ich hatte stundenlang hin und her überlegt, ob ich den Sheriff des Ortes benachrichtigen sollte. Aber was hätte ich ihm sagen sollen? Daß eine Bekannte von mir vermißt wurde und jemand gesehen hatte, wie sie sich freiwillig in den Wald begab, wo sie nun vielleicht in Gefahr schwebte, wobei all dies lediglich auf einer vagen Skizze beruhte, die meilenweit entfernt von hier gefunden worden war? Für eine systematische Durchsuchung des gesamten Nationalparks würden Hunderte von Beamten gebraucht, und mir war klar, daß die Polizei ein solches Unternehmen ohne stichhaltige Gründe gar nicht erst in Angriff nehmen würde.
Ich blieb stehen und warf einen Blick auf den dreiviertel vollen Mond, der sich über die Baumwipfel erhob. Mein Plan war, den Fluß ein kleines Stück östlich von der Forstwache zu überqueren und dann den Wanderweg ins Tal zu nehmen. Ich war davon ausgegangen, daß der Mond mir den Weg beleuchten würde; ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, daß sein Licht alles im Umkreis von etwa hundert Metern gut sichtbar machte.
Ich ging am Rand des Restaurants entlang und lief zu der Stelle, wo David campiert hatte. Keine Spur mehr von seinem Rastplatz. Er hatte sogar trockene Blätter und Tannennadeln auf den Boden gestreut, um jeden Hinweis auf seinen Rastplatz zu verwischen. Wollte ich meinem Plan folgen, mußte ich etwa vierzig Meter im freien Blickfeld der Forstwache hinter mich bringen. Das Gebäude lag jetzt direkt vor mir. Durch ein Seitenfenster erkannte ich zwei uniformierte Beamte; sie waren in ein Gespräch vertieft. Dann stand einer der Ranger von seinem Sitz auf und nahm den Telefonhörer ab.
Ich duckte mich, streifte meinen Rucksack über die Schultern, lief durch den aufgewühlten Kieselsand das Flußufer hinunter und platschte dann ins Wasser, wo mir zahlreiche glatte Felsbrocken und verrottete Baumstämme als Fußbrücke dienten. Ringsumher toste das Orchester der alarmierten Baumfrösche und Grillen. Ich blickte mich noch einmal zu den Beamten um; sie unterhielten sich miteinander, offenbar ohne mein Vorüberschleichen bemerkt zu haben. An der tiefsten Stelle reichte mir das Wasser bis zu den Oberschenkeln, aber ich hatte den kaum fünfzehn Meter breiten Strom in wenigen Sekunden überquert und Deckung in einem kleinen Tannengehölz genommen.
Vorsichtig bewegte ich mich ostwärts, bis ich den Wanderweg gefunden hatte, der ins Tal hinabführte. Weiter nach Osten hin verlor sich der Pfad in undurchdringlicher Dunkelheit, und als ich in diese Richtung starrte, stiegen erneut Zweifel in mir auf. Was mochte es mit jenem mysteriösen Geräusch auf sich haben, das David solche Sorgen bereitete? Worauf würde ich in dieser Finsternis dort draußen noch stoßen?
Dann schüttelte ich die Angst ab. Selbstverständlich mußte ich weitersuchen, was nicht hieß, daß ich keine Kompromisse machen durfte. So marschierte ich nur eine halbe Meile weit und bog dann ein gutes Stück vom Wege ab, direkt in das Dickicht des Waldes hinein, um eine Stelle zu finden, wo ich mein Zelt aufschlagen und den Rest der Nacht verbringen konnte. Ich war heilfroh, meine nassen Stiefel ausziehen und trocknen lassen zu können. Es war sicher klüger, bei Tageslicht weiterzugehen.
Als ich im Morgengrauen erwachte, dachte ich an Davids kryptische Bemerkung über das Aufrechterhalten meiner Intuitionen. Noch während ich dort im Schlafsack lag, überprüfte ich mein eigenes Verständnis von der Siebten Erkenntnis und dachte speziell an die Einsicht, daß das Zusammentreffen von Fügungen einer bestimmten Struktur folgt. Diese Erkenntnis erklärt, daß wir die Kontrolldramen aus unserer Vergangenheit aufgeben müssen und daraufhin imstande sind, die bis dahin vernachlässigten unterschwelligen Fragen über unsere spezielle Situation klarer wahrzunehmen, wie Fragen über unsere Karriere, unsere Beziehungen, wo wir uns niederlassen sollen und was uns auf unserem Weg weiterbringt. Danach müssen wir jedoch weiterhin wach bleiben, damit uns durch Ahnungen, Eingebungen, Gefühlsregungen ein Eindruck über die Richtung vermittelt wird, in die wir gehen sollen, oder was wir tun und mit wem wir sprechen sollen, um eine Antwort zu erhalten.
An diesem Punkt angelangt, müßte sich, laut Manuskript, eine Fügung ereignen, die hinreichend erklärt, warum wir den Drang verspürt haben, ausgerechnet diesen Weg zu gehen – eine Fügung, die unsere ursprüngliche Frage in ein neues Licht rückt und uns auf wundersame Weise weiterbringt. Was würde das »Aufrechterhalten« der Intuitionen zu diesem Prozeß beitragen?
Ich schälte mich aus meinem Schlaf sack, öffnete die Zeltklappe und spähte nach draußen. Da mir nichts Ungewöhnliches auffiel, kroch ich hinaus in die frische Herbstluft und stapfte zum Fluß zurück, wo ich mein Gesicht im kalten Wasser wusch. Danach packte ich meine Sachen und marschierte weiter gen Osten, kaute an einem mitgebrachten Granola-Frühstücksriegel und hielt mich ansonsten so gut wie möglich hinter den hohen Bäumen verborgen, die das Flußufer säumten.
Nach etwa drei Meilen überkam mich eine spürbare Welle der Angst und Nervosität; mein Körper fühlte sich auf der Stelle so erschöpft an, daß ich mich hinsetzte und den Rücken gegen einen Baumstamm lehnte, um meine Konzentration auf die Umgebung zu richten und innere Kraft zu sammeln. Der Himmel war wolkenlos; die Strahlen der Morgensonne tanzten durch die Baumwipfel und rings um mich her auf den Boden. Mein Augenmerk fiel auf eine kleine, etwa drei Meter von mir entfernte Grünpflanze mit gelben Blüten, und so konzentrierte ich mich auf ihre Schönheit. Das Pflänzchen stand bereits im vollen Sonnenlicht und erschien mir gleich viel leuchtender, sein Blattwerk war von noch satterem Grün als zuvor. Seine Blüten trieben mir eine Duftwolke entgegen, die sich mit dem modrigen Geruch alten Laubs und schwarzer Erde vermischte.
Gleichzeitig drang von den Bäumen weit oben im Norden der Schrei mehrerer Krähen an mein Ohr. Die Stärke und Fülle dieses Krächzens war erstaunlich, aber seltsamerweise konnte ich den genauen Aufenthaltsort der Vögel nicht ausmachen. Während ich mich auf das Lauschen konzentrierte, drangen Dutzende von anderen Geräuschen zum erstenmal vollauf in mein Bewußtsein: der morgendliche Chor der Singvögel in den Bäumen über mir, das Brummen einer Hummel zwischen den Gänseblümchen am Fluß, das Gurgeln des Wassers, wenn es auf Steine und herabgefallene Äste prallte … und noch etwas – kaum vernehmbar –, ein tiefes, dissonantes Summen. Ich stand auf und blickte mich um. Was war das für ein Geräusch?
Rasch setzte ich meinen Rucksack wieder auf und wanderte nach Osten. Das Rascheln meiner Tritte auf dem toten Laub zwang mich, hin und wieder stehenzubleiben und mit größter Intensität hinzuhorchen, um dieses Summen weiterhin wahrnehmen zu können. Es war eindeutig da. Vor mir wich der Wald jetzt einer Wiesenlandschaft, und ich wanderte für etwa eine halbe Meile durch bunt blühende Wildkräuter und kniehohes Salbeigras. Der Wind strich in sanften Wellen über die Spitzen der Gräser, und als ich fast an den Ostrand der Wiese gekommen war, sah ich einige Brombeerbüsche neben einem umgestürzten Baum wuchern. Die Büsche kamen mir märchenhaft schön vor, und so trat ich näher, um sie genauer zu betrachten. Dabei drängte sich mir die Vorstellung auf, daß sie mit reifen Brombeeren beladen waren.
Während ich ein paar der wenigen tatsächlich vorhandenen Beeren pflückte, hatte ich ein intensives Gefühl des Dejä vu. Meine Umgebung kam mir plötzlich so vertraut vor, als wäre ich schon einmal in diesem Tal gewesen, als hätte ich hier schon einmal Brombeeren gepflückt. Wie konnte das möglich sein? Ich setzte mich auf einen umgefallenen Baumstamm und steckte mir die schwarzblauen Früchte langsam in den Mund. Unterdessen stieg ein weiteres Bild in mir auf: ein kleiner Bergsee, mit kristallklarem Wasser gefüllt, und im Hintergrund mehrere Wasserfälle, die über terrassenförmige Felsplatten in den See stürzten. Auch dieser Ort schien mir seit langem vertraut zu sein, jedenfalls in meiner Vorstellung. Erneut beschlich mich ein Angstgefühl.
Ohne Vorankündigung sprang ein Tier geräuschvoll aus dem Gebüsch heraus und rannte, während ich erschreckt zusammenzuckte, etwa zehn Meter in Richtung Norden, um dann abrupt stehenzubleiben. Da sich die Kreatur in dem hohen Gras verborgen hielt, hatte ich keine Ahnung, um welches Tier es sich handelte. Ich konnte seinen Weg lediglich anhand der Bewegungen im Gras verfolgen. Nach einigen Minuten rannte es ein paar Meter nach Süden zurück, verhielt sich wieder sekundenlang regungslos und hastete dann zehn oder zwanzig Meter nordwärts, um wieder innezuhalten. Es mußte sich wohl um ein Kaninchen handeln, obwohl sein Verhalten mir sehr sonderbar vorkam.
Ich behielt die Stelle, wo ich das Tier zum letztenmal ausgemacht hatte, für weitere fünf oder sechs Minuten im Auge, dann machte ich mich behutsam auf den Weg dorthin. Als ich bis auf zwei Meter an die Stelle herangekommen war, sprang es auf und floh weiter nach Norden. Kurz bevor es in der Ferne verschwand, konnte ich gerade noch den weißen Schwanz und die Hinterläufe eines riesigen Karnickels erkennen.
Schmunzelnd ging ich weiter und folgte dem Wanderweg in Richtung Osten, ließ die Graslandschaft hinter mir und kam in ein dichtbewachsenes Waldgebiet. Dort angelangt, entdeckte ich einen schmalen Wasserlauf, der von links in den Ruß mündete. Das mußte der Bach sein, den David mir beschrieben hatte, soviel stand fest. Von hier aus sollte ich mich nun nach Norden wenden, doch gab es leider keinen Fußweg, der in die Richtung führte, und, schlimmer noch, das Unterholz zu beiden Seiten des Baches war ein undurchdringliches Geflecht von Nesseln und Dornenhecken, durch das ich mich noch nicht einmal mit einem Buschmesser hätte kämpfen können. Also mußte ich die ganze Strecke zurück zu der Wiese laufen, um einen Umweg zu finden.
Ich marschierte am Waldrand entlang zurück und hielt Ausschau nach einer Lücke im unwegsamen Unterholz. Zu meinem Erstaunen gelangte ich schließlich wieder an genau die Stelle, wo das Kaninchen seine Spuren im Gras hinterlassen hatte, und folgte dieser Spur, bis ich den Bach wiedergefunden hatte. Hier wich das Dornengewirr teilweise zurück, so daß ich mir einen Weg in ein Waldstück mit höheren, älteren Baumbeständen bahnen konnte, durch das ich dem Bachlauf direkt nach Norden folgte.
Nach einem Fußmarsch von etwa einer Meile sah ich die Ausläufer eines Gebirges in der Ferne auftauchen, die sich zu beiden Seiten des Baches erhoben. Als ich näher herangekommen war, wurde mir klar, daß diese Hügel eine Schlucht bildeten und daß weiter vorn der scheinbar einzige Zugang zu diesem Canyon lag.
Dort angelangt, setzte ich mich neben einen wilden Hickorybaum und inspizierte die Landschaft. Zu beiden Seiten des Baches erhoben sich die über zwanzig Meter hohen Kalksteinwände steil in die Luft und bildeten eine tiefe, von ringförmigen Hügelketten umgebene Schlucht von vielleicht zwei Meilen Breite und mindestens vier Meilen Länge. Die erste halbe Meile war mit spärlichem Buschwerk und harten Gräsern bewachsen. Ich dachte an den Summton und lauschte für die nächsten fünf oder zehn Minuten mit gespitzten Ohren, aber er hatte offenbar ausgesetzt.
Schließlich holte ich meinen kleinen Butankocher aus dem Rucksack und zündete den Brenner an, füllte eine kleine Pfanne mit Wasser und schüttete den Inhalt einer Tüte gefriergetrockneten Gemüses hinein. Eine Weile rührte ich in der Pfanne und betrachtete die Dampfschwaden, die sich kräuselnd in die Luft erhoben und mit dem nächsten Windhauch wieder verschwanden. Bilder stiegen vor meinem inneren Auge auf: wieder der gleiche See und die Wasserfälle. Doch diesmal war ich persönlich anwesend und kletterte die Felsen hinauf, als wollte ich jemanden begrüßen. Ich schüttelte die Vision ab. Was sollte ich damit anfangen? Diese Bilder wurden immer aufdringlicher. Erst hatte ich David in einer anderen Zeit gesehen, jetzt diese Wasserfälle.
Eine Bewegung im Canyon schreckte mich auf. Mein Blick richtete sich auf den Bach und hinter ihm auf einen einzelnen Baum in etwa neunzig Metern Entfernung, der bereits fast alle Blätter verloren hatte. Jetzt war er übersät mit schwarzen Vögeln, die wie übergroße Krähen aussahen. Einige flatterten gerade zu Boden. Es mußte sich wohl um die Vögel handeln, deren Krächzen mir vorher schon aufgefallen war. Während ich sie ins Auge faßte, erhob sich die ganze Schar unvermittelt in die Luft und umkreiste den Baum mit theatralischem Geschrei. Wie zuvor stand die Lautstärke ihres Geschreis in keinem Verhältnis zu ihrer Entfernung; sie klangen viel näher.
Ein Brodeln und Zischen lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf den Kocher. Überquellende Gemüsebrocken tropften in die Flamme. Mit einem Handtuch packte ich den Griff der Pfanne, mit der anderen Hand drehte ich das Gas aus. Nachdem sich das Brodeln beruhigt hatte, setzte ich den Kocher erneut in Gang und warf einen Blick zurück auf den Baum. Die Krähen waren verschwunden.