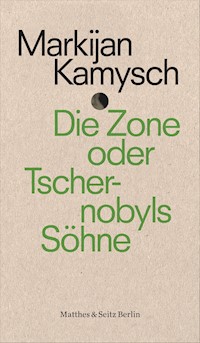
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: punctum
- Sprache: Deutsch
Markijan Kamysch ist der Sohn eines sogenannten Liquidators, der zu den Rettungs- und Aufräumtrupps gehörte, die nach dem Reaktorunfall die Schäden vor Ort beseitigten. Seit 2010 führt Kamysch illegale Ermittlungen in der Sperrzone von Tschernobyl durch. Beinahe ein Jahr hat er mittlerweile in dem strahlenverseuchten Gebiet um das Atomkraftwerk und die nahe gelegene Stadt Prypjat verbracht und seine Erlebnisse aufgezeichnet. Sein Buch ist das einzigartige literarische Dokument einer Erkundung, für die er seinen Leib riskiert. Als Sohn eines 2003 an den Folgen der Strahlenkrankheit verstorbenen Ersthelfers gehört er der »Generation Tschernobyl« an. Der Ort, der das Leben seiner Familie und das einer ganzen Gesellschaft änderte, ist für ihn »ein Land des Friedens, gefroren und zeitlos«, in dem er eine Art von Freiheit erlebt, die in den Gefängnissen einer total konsumistischen und nihilistischen Gesellschaft zu einem Raum der Utopie geworden ist. Wie ein Blinder findet er sich dort zurecht und nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise zum »exotischsten Ort der Welt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
punctum 021
Markijan Kamysch
Die Zone oder Tschernobyls Söhne
Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe
Mit Fotografien von Markijan Kamysch
Für Flamingo
Inhalt
Heiß, braun gebrannt und nackt
Ein wundervolles Märchen in der Neujahrsnacht
Campari
Polesian Zen
Hallo, Zone! Leb wohl
Angestachelt vom Optimismus utopischer Parolen und den Furzideen einer grotesken sowjetischen Gigantomanie, formten wir unseren Traum. Auf der Jagd nach dessen Erfüllung fanden wir das Füllhorn – die Energie des friedlichen Atoms, Wunderwaffe der Volkswirtschaft und Leitstern auf dem Weg in die knallrote kommunistische Zukunft. Berauscht von der eigenen Größe, im lichten Glauben an das Gute, bauten wir in der Sowjetunion ein Atomkraftwerk nach dem anderen.
Tschernobyl war eines der leistungsstärksten. Die dazugehörige Stadt Prypjat wuchs und konnte sich sehen lassen, gepflegte Hochhäuser ragten auf, über den Dächern prangten stolz gigantische Transparente, auf den beschaulichen Spielplätzen tobten Kinder.
Ein Supermarkt und ein Restaurant wurden eröffnet, und Annoncen wie Tausche Wohnung in Odessa gegen Wohnung in Prypjat erstaunten niemanden. In der Einöde Polessiens wirkte die Kraftwerksstadt wie eine Utopie aus dem All: schnelles Wachstum, steigender Wohlstand und bombastische Perspektiven. In Planung war sogar eine Uferpromenade mit Brücken, Laternen und ländlicher Idylle. Schon waren weitere Reaktorblöcke im Bau, am Horizont winkten Glück und Freude in Reinform.
Bis irgendwann der vierte Reaktorblock in die Luft flog und alles im Arsch war. Tschernobyl, der Stern Wermut, war, wie in der Offenbarung beschrieben, vom Himmel gefallen, und von nun an war die Gegend ein giftiger Smaragd im Edelsteindiadem Polessien. Ein verkatertes Erwachen nach langen Jahren süßer Träume. Das Gesetz der Grube: Man braucht ewig, um sich herauszuarbeiten, abgestürzt ist man blitzschnell.
Tapfere Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, kühne Hubschrauberpiloten kippten Brom und Blei in den Höllenschlund. Todesmutige Liquidatoren schaufelten reinen Herzens den verseuchtesten Schutt der Welt weg, errichteten den Sarkophag und verschwanden.
Sie verschwanden, nachdem sie ihre Strahlendosis, Gesundheitsprobleme, Krebs und ihren Tschernobyl-Ausweis der Kategorie 1, 2 und so weiter bekommen hatten. Ihre Kinder bekamen das Recht, kostenlos von einem Ferienlager ins andere zu tingeln und in der Schule den Namen Tschernobyl-Opfer zu tragen. Das Land bekam ein Gebiet von der Größe Luxemburgs, das für Menschen unbewohnbar war.
Die Stadt Prypjat und die umliegenden Orte wurden sofort evakuiert. Die Sperrzone wurde mit Stacheldraht umzäunt, und Soldaten fuhren Patrouille. In Schützenpanzerwagen machten sie Jagd auf Plünderer, doch die wilden Neunziger verbreiteten mehr Schrecken als der Reaktor, und der Zaun um die Zone bekam Löcher.
Zu jener Zeit kamen auch die ersten Illegalen: Abgerissene Alkonauten schleppten Konserven aus den Kellern in den verlassenen Dörfern, flüchteten vor den Patrouillen, nur um eine Woche später wiederzukommen, festgenommen zu werden und keinesfalls mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. In der Sperrzone wimmelte es von Draufgängern, Pennern, Deserteuren, Plünderern und entlaufenen Knastbrüdern. Sie versteckten sich monatelang in den Dörfern, knabberten faulige Äpfel und träumten davon, den Widrigkeiten der Welt ein für alle Mal zu entkommen. Die Sperrzone war damals tatsächlich der gefährliche Ort, von dem die Regenbogenpresse heute schreibt.
Hippies gab es auch. In der Zeitung tauchten hin und wieder Meldungen über die Blumenkinder auf. Sie planschten ausgelassen in den Flüssen, wurden von der Miliz aufgegriffen und mit der strengen Auflage davongejagt, es nie, nie, nie wieder zu tun. Auch die Kiewer Kleinkriminellen schauten vorbei – um in den Prypjater Wohnungen die Wanduhren abzuhängen und später auf dem Andreas-Hügel zu verticken. Sie fixten und hatten Knarren dabei. Dann verschwanden sie, ausgebrannt vom Speed und seinen Flashs, und wurden ganz normale Familienmenschen: kleine Geschäftsleute und fürsorgliche Väter all derer, die heute mit ihren Frühstücksfotos Instagram & Co. zumüllen.
Es gab auch Einzelgänger. Sie hinterließen keine Spuren und tranken guten Kognak. Sie angelten um der lieben Sonne am hellen Himmel willen. Dass die Sperrzone unbewohnt war und sie geschnappt werden konnten, juckte sie nicht. Irgendwann war die Generation der Katastrophenkinder groß. Für sie ist die Zone der Entfremdung ein Land der Stille und der stehen gebliebenen Zeit.
Ich bin einer von ihnen.
•
Was ist die Tschernobyl-Zone heute? Für die einen ist es eine schreckliche Erinnerung aus einer halbvergessenen Kindheit, einer glücklichen sowjetischen Jugend, als das Leben binnen weniger Tage in die Brüche ging, man sich plötzlich mit all seinen Nachbarn in einem Evakuierungsbus wiederfand und auf der Suche nach einer neuen Bleibe die Fahrt ins Ungewisse antrat. Für andere ist die Zone radioaktive Scheiße, die sie im Mai 1986 wegschaufelten. Für die Nächsten ist es eine Terra incognita voller Mythen über Zombies und Soldaten in dunkelgrünen Panzern. Für wieder andere heißt Zone: geführte Touren, auf denen dreiste Geschäftemacher mit pathetischen Reden Katastrophentouristen abzocken. Für die Nächsten ist es die Kulisse eines Computerspiels mit harten Männern, die Kalaschnikows tragen, Schmalzfleisch aus Dosen essen und im morgendlichen Nebel der Sümpfe Verbände auf Schusswunden legen. Und für wieder andere ist alles ganz schlimm, für sie ist die Sperrzone der Schauplatz des Horrorfilms Chernobyl Diaries.
Bei mir ist es noch schlimmer. Für mich ist die Zone ein Ort der Entspannung. Ein Ersatz für das Meer, die Karpaten, die Berghalden, die Türkei mit ihren Kaskaden von Cocktailgläsern. Mehrere Male im Jahr fahre ich verbotenerweise dorthin. Stalker, Wanderer, Outcast, Idiot, nennt mich, wie ihr wollt. Keiner bemerkt mich, aber ich bin da. Ich existiere. Fast so wie die ionisierende Strahlung. Wie das aussieht? Ich packe meinen Rucksack, fahre bis zum Stacheldraht und verliere mich im Dämmer der Waldstreifen, Lichtungen und Fichtendüfte Polessiens, ich verschwinde im betörenden Dickicht und lasse mich von niemandem finden, unter keinen Umständen.
Wenn ich hier von Stalkern rede, dann nicht von Leuten, die in Luftschutzkellern von lokaler Bedeutung nach Gasmasken von Kindern suchen, nicht von Leuten, die versiffte Bauruinen in Schlafstädten fotografieren. Hier geht’s um andere Typen. Um junge Frauen und Männer, die einfach ihren Rucksack schultern und im kalten Regen in die verlassenen Städte und Dörfer ziehen, in denen man sich mit billigem Wodka betrinken, mit leeren Flaschen Scheiben einschlagen, richtig laut fluchen und andere Sachen anstellen kann, die die Städte der Lebenden von den Städten der Toten unterscheiden. Es geht um Leute, die sich nicht vor radioaktiver Strahlung fürchten und sich nicht davor ekeln, aus verseuchten Bächen und Seen zu trinken. Um Leute, die von den Prypjater Dächern herab erstklassige Aufnahmen machen, die später im National Geographic und in Forbes abgedruckt werden.
•
Manchmal denke ich, dass es uns gar nicht gibt, dass diese vierzig Personen, die immer wieder im Sumpfland von Tschernobyl unterwegs sind, womöglich gar nicht mehr da sind. Irgendwann hat es uns mal gegeben, aber wir haben uns längst in den Sümpfen verloren, sind zu Wasserlinsen, Binsen und Sonnenlicht zerfallen. Wir geistern durch die Moore.
Nicht einmal die Fliegen nehmen von uns Notiz, sie umkreisen uns, surren und fliegen weiter. Wir sind ein matter Abglanz des Fernsehmythos in den Köpfen unserer Landsleute, nicht mehr als Ammenmärchen von Radioaktivität, Zombies und Kälbern mit drei Köpfen. Im trüben nächtlichen Dunkel suchen wir stundenlang nach einem Pfad durch die wilden Moore, und tagsüber waten wir hüfthoch durch Blutegel.
Ich bin gerade zurück. Meine letzte Woche war ein einziger Lauf durch die Dunkelheit, ein besorgtes Ausschauhalten nach Scheinwerfern und glimmenden Kippen. Es gab Hoffnung auf eine Liege ohne Matratze und eiskaltes Wasser aus einem zugefrorenen Fluss, auf Frost und unterdrückten Durst. Es gab eine Patrouille, die ich im letzten Moment bemerkte. Und Gras: brüchiges, trockenes, gelbes Gras. Ich schlief fest und lief am nächsten Morgen weiter nach Norden, tauchte ein in Träume, in eine wundervolle Landschaft aus verlassenen Häusern, Kanälen und landwirtschaftlichen Anlagen.
Die Finger verwechseln die Buchstaben auf der Tastatur, der Cursor rast über den Bildschirm, und der Geschmack des Snickers und der Pepsi, die ich mir am Busbahnhof Polessien in Kiew schnell noch organisiert habe, passen nicht zur Realität. Nur ein Schluck Helles kann meine Lebensgeister wieder wecken. Von null auf hundert.
Für Donnerstagmorgen acht Uhr gar nicht schlecht. Das gönne ich mir heute mal. Solche Momente kennt doch jeder. Die Archäologen nennen das »Post-Expeditions-Syndrom«, die Geologen so ähnlich. Alle Berufe, deren Arbeitsprozesse eine Trennung von der Zivilisation mit sich bringen, haben eine Bezeichnung für diesen Zustand. Was ich mache, kann man allerdings kaum Beruf nennen. Aber darüber denke ich im Moment nicht weiter nach. Ich will jetzt nur zwei Sachen: ein gutes Bier und ein gutes Steak.
Womit soll ich beginnen? Vielleicht mit ein paar guten Ratschlägen: Packt euch nie den Rucksack bis zur Vierzig-Kilo-Marke voll. Geht nie für dreißig Tage auf Tour und nehmt ja nie zu den vierzig Konservenbüchsen auch noch ein monströses Schlauchboot mit. Ich sage mir das ständig, aber ich bin ein Masochist.
Manchmal muss das sein. Wenn du für drei Tage in die Zone gehst, denkst du immer: Jetzt geht’s ja bald wieder zurück. Wenn du fünf Tage unterwegs bist, bedauerst du es, dass du nur zwei Tage in Prypjat warst. Gehst du für eine ganze Woche, denkst du: Hätte ich doch wenigstens noch einen Tag. Egal wie lange du unterwegs bist, wiederholst du wie ein Mantra ein und denselben Gedanken: In acht Stunden muss ich es von Prypjat bis zum Stacheldrahtzaun schaffen. Halb sechs muss ich an der Haltestelle stehen, dann kommt die Marschrutka, keiner verpfeift dich, die Bullen machen dich nicht an, von wegen du bist aus den Wäldern um Tschernobyl gekommen. Du hast es immer eilig. Bis auf den Moment, wenn du den Rucksack absetzt und durch ein verlassenes Dorf an der Grenze zu Belarus gehst und noch drei Tage bleiben willst. Dann hast du es nicht eilig. Dieses Mal lässt du dir Zeit. Das wird eine denkwürdige Tour. Und eine sehr lange.
Du siehst die nächtlichen Asphaltstraßen, die Gerippe der Freileitungsmasten und die verlassenen Dörfer, märchenhaft im nächtlichen Nebel. Tagsüber liegt bleierne Starre über dem Land, nachts fallen feuchte Schwaden auf die Erde herab und spinnen alles in ein Netz aus grauen Schatten ein. Nichts kann die Schwaden vertreiben, nichts kann ihnen etwas anhaben, es gibt nur das Licht der Stirnlampen, das Band der Milchstraße und das Strahlen unzähliger Sterne.
•
An diese krassen Zeiten in meiner irren Jugend werde ich zurückdenken, wenn ich einst leberkrank darniederliege … Ich treibe mich zwischen kaputten Stühlen, den kalten Eingeweiden verlassener Häuser, zwischen verlorenem Leben und herrenlosen Relikten herum. Ich erklimme alle Gipfel dieser dämlichen Zone: die Dächer von Prypjat, die Antennen von Tschernobyl 2, den höchsten Punkt des fünften Reaktorblocks, einen Hochstand und das Gerippe eines umgekippten ausgeschlachteten Busses. Womit soll ich denn nun beginnen? Mit dem strömenden Regen.
Diese Sintflut werde ich nie vergessen. Wir alle sind schon im Regen unterwegs gewesen. In einem Regen, der das Atmen schwer macht, und jeder erinnert sich an einen Guss, der alle anderen Güsse in den Schatten gestellt hat.
Es zog mich mal wieder nach Prypjat. Es war mitten in der Nacht, und ich kam an den Abzweig zum fünften Reaktorblock. Dort gabelt sich die Straße, es ist der perfekte Parkplatz für einen Streifenwagen, um solche wie mich zu schnappen. Stalker, Shatalker, Illegale, Wanderer, Ausflügler – der Name tut nichts zur Sache. Ich spitzte die Ohren und schlich auf Zehenspitzen weiter, bis ich auf die Streife stieß – direkt vor meiner Nase. Bloß gut, dass es zwei Uhr nachts war und die Jungs in ihrem Wagen süß schlummerten. Dahinter war nur noch die Straße nach Prypjat. Und der strömende Regen.
In schwarzen Schwaden hing das Gewitter in der nächtlichen Luft und schickte heftige Blitze über den Himmel. Rechts war das Atomkraftwerk, ganz nah, höchstens einen Kilometer entfernt. Direkt hinter dem Abluftkamin des vierten Reaktorblocks schlug ein Blitz ein. Dann noch einer. Damals stand der alte Schlot noch, dem alle Illegalen jetzt nachweinen, weil er abgerissen wurde, rücksichtslos haben sie das Symbol unserer Streifzüge zerstört, vor dessen Kulisse unsere Jugend auf den Dächern von Prypjat ins Land ging.
Was ist das Wichtigste in der Zone? Genau, der Schlot. Das Phallussymbol aller Katastrophen. Stinkend und verschwitzt kommst du bei den kalten Prypjater Plattenbauten an, verschaffst dir Zugang zu einer Wohnung, sammelst die herumliegenden Stühle ein, setzt den Rucksack ab, haust dich auf ein Sofa und starrst lange auf einen Punkt im orangeroten Flackern der Kerze. Du machst Kakao, gehst auf den Balkon, steckst dir eine Camel an und schaust in den früheren Innenhof, der sich in Dschungel und undurchdringliches Dickicht verwandelt hat. Du nickst ein, und eine halbe Stunde später weckt dich ein Kälteschauer, du schleppst dich mit letzter Kraft zu deinem Schlafsack und kriechst angezogen hinein. Du klappst ab und schnarchst megalaut, eine echte Herausforderung für die Standfestigkeit dieses klapprigen Gerippes von Hochhaus. Du träumst vom Schlot. Dann wachst du auf und hast Lust auf einen Schluck Schnaps. Lust auf einen ordentlichen Schluck Schnaps und einen Happen Schmalzfleisch.
Also kletterst du auf irgendeins der Prypjater Dächer, holst eine Pulle aus deinem Faltrucksack, und schon kann’s losgehen. Du legst die Brote mit Streichwurst auf die Dachpappe, schenkst ein und die Leute, die du einen halben Tag lang durch die Tschernobyl-Sümpfe bis hierher mitgeschleppt hast, werden plötzlich die nettesten und liebenswürdigsten Menschen der Welt. Connecting people …
In diesen einmaligen Momenten überkommen dich Nostalgie, Poesie und was nicht sonst noch alles. Du glotzt auf die innigen Strahlen der glutroten Scheibe ganz im Westen, die Sonne sinkt, und dann bist du doch wieder bei diesem verdammten Abluftkamin. Du denkst an die Zeit zurück, als er mit seinen roten Lämpchen am schwarzen Himmel blinkte, als er müden Herumtreibern nachts im tiefsten Dickicht Orientierung bot. Die Leute liefen über die menschenleeren Landstraßen, sahen den Schlot und wussten, dass es nicht mehr weit bis nach Prypjat war, dass bald Häuser kommen würden. Dann hat man ihn abgerissen. Unser Ein und Alles. Sleep well, dear Schlot.
Als mich dieser sintflutartige Regen ereilte, stand der Schlot noch. Das war 2012: Weltende, Fußball-EM und endlose Streifzüge durch die Zone. In jener Nacht blitzte es im Sekundentakt, ich rannte, und die dicken Regentropfen prasselten auf meine Jacke. Ich hoffte nicht mehr auf einen trockenen Abend in einer Wohnung, einen leckeren Tee mit zwei Löffeln Zucker, den ich mir vor dem Schlafengehen schnell noch auf dem Campingkocher kochen würde. Ich hoffte auch nicht mehr auf einen trockenen Schlafsack. Ich hoffte nur noch, nicht zu ertrinken. Aber als ich an den Stadtrand von Prypjat kam, soff ich langsam ab.
Ich keuchte im Regen, kämpfte mich unter den Strommasten gegen den böigen Wind voran. Alle fünf Sekunden donnerte es direkt neben mir, Blitze zerrissen das Himmelsschwarz mit ihren bläulichen Adern. Binnen zwei Minuten war ich nass bis auf die Haut, die Regenjacke aus Deutschland – angeblich wasserdicht – taugte nichts. Es war, als hätte ich in Kleidung das Kiewer Meer durchquert, als hätten sämtliche Teilnehmer der Ice Bucket Challenge gleichzeitig ihren Eimer mit eiskaltem Wasser über meinem Kopf ausgekippt.





























