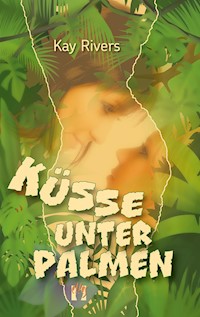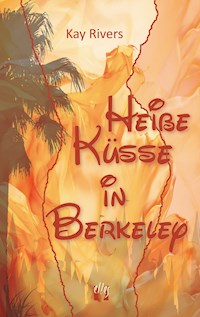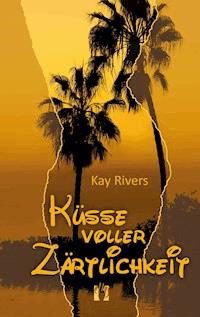8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marianas Traumberuf: Ärztin. Marianas Familie: Bostoner Brahmanen, die absolute High Society. Marianas Realität: Heiraten und Kinder kriegen. Das wird von der High Society von ihr erwartet. Selbst mittellos, scheint ihr fast nichts anderes übrig zu bleiben, als sich zu fügen. Ein Ehemann für sie ist schon ausgesucht, und die Hochzeit wird geplant. Nach vier Jahren Studium in Los Angeles kehrt sie widerwillig nach Boston zurück und wird als Erstes auf einen Wohltätigkeitsball geschleift, wo sie Robyn trifft – faszinierend, geheimnisvoll, anziehend . . . aber auch recht unverschämt und frech. Nachdem der Ball ein unerwartetes Ende nimmt – die Gesellschaft wird dreist ausgeraubt –, zeigt Robyn sich sehr verständnisvoll und kümmert sich um Mariana. Und schon am nächsten Tag steht sie wieder vor Marianas Tür. Beide fühlen, dass da etwas ist, doch eine Verbindung scheint wegen Marianas baldiger Hochzeit unmöglich . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kay Rivers
DIEBE MIT LIEBE
Roman
© 2024édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-386-9
Coverfoto:
1
»Hast du alles?«
Während Mariana über ihr Bett gebeugt dastand, um ihren Koffer zu packen, wurde sie von hinten von einer Stimme überfallen.
»Hab ich.« Lächelnd richtete sie sich auf und drehte sich um. »Hast du Angst, du musst mir ein dickes Paket nachschicken?«
»Das täte ich doch unheimlich gern.« Marianas Mitbewohnerin Shirley, mit der sie sich in den letzten vier Jahren ein Zimmer im Studentenwohnheim des Pomona-Colleges geteilt hatte, grinste sie an. »Und ich komme dich sowieso bestimmt bald besuchen, da im kalten Boston.« Sie schüttelte sich. »Dann kann ich alles, was du vergessen hast, mitbringen.«
Mariana lachte. »Soweit ich mich erinnere, bist du die Vergessliche von uns beiden. Deshalb nimmst du das wohl auch von allen anderen an.«
»Ja, ja, Frau Doktor.« Shirley rollte die Augen. »Du bist so perfekt, dass keiner an dich rankommt.«
»Beides falsch.« Mit einer liebevollen Geste umarmte Mariana sie. »Ich bin noch keine Frau Doktor, und perfekt bin ich schon gar nicht. Stell mich nicht immer so auf ein Podest.«
»Ich werde dich vermissen.« Shirley drückte sie. »Nach vier Jahren habe ich mich echt an dich gewöhnt.«
»Während es am Anfang schwierig war.« Hell lachte Mariana auf und strahlte Shirley mit ihren leuchtend graugrünen Augen an, die einen wunderbaren Kontrast zu ihrem kastanienbraunen Haar bildeten. »Wir beide im selben Zimmer . . .«
»Nur weil du so furchtbar ordentlich bist. Etwas Chaos würde dir guttun.« Herausfordernd blinzelte Shirley sie an.
»Dein Chaos, meinst du?« Mit einem lächelnden Kopfschütteln wandte Mariana sich von ihr ab und wieder ihrem Bett und ihrem Koffer zu. »Das ist das Einzige, was ich nicht vermissen werde.«
Diese vier Jahre waren erst der Anfang ihrer Ausbildung zur Ärztin gewesen. Sie wollte Menschen helfen, deshalb hatte sie sich für diesen Weg entschieden, aber er war lang und anspruchsvoll. Die Medical School, das Medizinstudium an einer Universität, nach dessen Abschluss das M.D., Doktor der Medizin, am Ende ihres Namens stehen würde, konnte man erst absolvieren, wenn man zuvor schon ein vierjähriges Studium in einem anderen Fach abgeschlossen und darin seinen Bachelor erworben hatte.
Diesen Bachelor hatte sie nun, aber jetzt ging es erst richtig los. Noch einmal vier Jahre Medical School, dann weitere Jahre als Assistenzärztin in einem Krankenhaus, und danach erst konnte sie sich als Ärztin bezeichnen und selbstständig arbeiten. Eine eventuelle Facharztausbildung, noch ein paar Jahre, musste sie zu diesem Zeitpunkt noch anhängen, wenn sie das wollte.
Und das wollte sie. Sie wollte alles lernen, was sie nur lernen konnte, um anderen Menschen zu helfen.
»Dass du dir das antun willst . . .« Shirley ließ sich auf ihr eigenes Bett fallen und sah Mariana beim Packen zu. »Ich bin froh, dass ich jetzt endlich fertig bin und nie mehr zu irgendwelchen Vorlesungen muss. Wenn meine Familie nicht darauf bestanden hätte, hätte ich noch nicht mal das hier gemacht.«
»Ich weiß.« Mariana wandte sich kurz zu ihr um und schmunzelte. »Aber schon als kleines Kind habe ich davon geträumt, Ärztin zu werden. Ich wollte nie etwas anderes.«
»Tja, jedem, wie es ihm gefällt.« Shirley zuckte die Schultern. »Ich freue mich jetzt auf die erste Party nach langer Zeit, die nicht auf dem Campus stattfindet.« Sie grinste und strampelte auf dem Rücken liegend kindisch mit den Beinen, als könnte sie es gar nicht erwarten.
»Und auf deinen Verlobten, nehme ich an?«, fügte Mariana mit leicht gehobenen Augenbrauen hinzu.
»Na ja . . .« Shirley runzelte die Stirn. »Er ist ganz in Ordnung.«
Mariana seufzte. »Warum sagst du es ihnen nicht?«
Gleichgültig winkte Shirley ab. »Ach, du weißt doch, wie es ist. Familie . . . Sie denken, er ist der perfekte Ehemann für mich. Unsere Familien kennen sich schon ewig. Wir stammen aus denselben Kreisen . . .« Sie atmete tief durch. »Und er ist ja auch ein netter Kerl. Mehr wie ein Bruder. Aber sooo langweilig!« Sie illustrierte das, indem sie ausgiebig gähnte.
»Ich fand ihn sehr nett, wenn er dich hier besucht hat«, meinte Mariana, während sie eine Bluse faltete.
»Ja, genau.« Mit einem Satz sprang Shirley auf. »Nett. Das ist er. Nett. Aber mehr eben auch nicht. Was ich mir wünsche . . .«, sie seufzte, »ist Aufregung und Abenteuer. Ein Mann, der mich von den Füßen reißt, wenn ich ihn nur ansehe, wenn ich nur an ihn denke.« Sie seufzte wieder. »Wie ein Pirat, der mit geblähten Segeln davonrauscht. Mit mir am Bug neben sich. Meine Haare fliegen im Wind –«
Mariana lachte. »Entweder hast du zu viele historische Romane gelesen oder zu viele alte Filme gesehen.«
»Ist deine Familie denn damit einverstanden, dass du jetzt noch Jahre an Ausbildung ans College dranhängst und nicht heiratest?«, fragte Shirley mit schiefgelegtem Kopf. »Sie haben doch sicher auch längst jemanden für dich ausgesucht.«
Mariana verzog das Gesicht. »Das hätten sie gern. Aber ich habe mich bisher noch mit keinem einverstanden erklärt.«
Shirley lachte. »Du bist da einfach viel zurückhaltender als ich. Hast du denn gar keine Lust auf . . . hm . . . gewisse Dinge?«
»Dazu muss man nicht verheiratet sein«, sagte Mariana.
»Ja, klar, ich bin auch keine Jungfrau mehr.« Grinsend stolzierte Shirley durchs Zimmer. »Aber trotzdem ist es anders, wenn man verheiratet ist.«
»Nur weil er dein Ehemann ist?«, entgegnete Mariana zweifelnd.
»Wer hat denn gesagt, dass er der Einzige sein muss, für diese . . . gewissen Stunden?« Mit einem kecken Blinzeln sah Shirley sie an.
Für sie schien alles schon geregelt zu sein. Von der Ehe bis zum Ehebruch. Bevor sie überhaupt verheiratet war. Was nicht passte, wurde eben passend gemacht.
»Ich will erst meine Ausbildung abschließen.« Mariana wusste genauso, was sie wollte, aber in völlig anderer Hinsicht. »Das hat Vorrang. Über alles andere kann ich später nachdenken.«
Mit einem entschiedenen Gesichtsausdruck klappte sie ihren Koffer zusammen, und die Schlösser schnappten mit einem endgültigen Geräusch zu.
2
»Bist du da?« Eine Frau in mittleren Jahren, die so respektabel aussah, dass man immer das Gefühl hatte, man müsste sich vor ihr verneigen, steckte den Kopf zur Tür herein und sah Robyn an, die hinter ihrem Schreibtisch saß.
»Bin ich?« Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte Robyn zurück.
»Es ist Mrs. Dilling«, erläuterte Marcia, ihre Sekretärin.
»Na dann . . .« Robyn lächelte und stand auf.
Marcia nickte und drehte sich um, hielt einladend die Tür auf. »Bitte, Mrs. Dilling.«
»Ms. Reardon!« Eine Frau kam hereingerauscht, der man ansah, dass sie vermutlich noch nie hinter einem Schreibtisch gesessen hatte. Jedenfalls nicht, um zu arbeiten.
»Mrs. Dilling.« Robyn kam hinter ihrem Schreibtisch hervor und hielt ihr die Hand hin. »Wie schön, Sie zu sehen.«
»Ich musste Sie sehen!« Sybil Dilling ließ ihre Hand nur hoheitsvoll in die von Robyn fallen und sie dann dort liegen, als erwartete sie, dass Robyn sie küssen würde.
Fast hätte Robyn geschmunzelt, aber sie unterdrückte es, weil sie wusste, dass Sybil Dilling nicht den entferntesten Sinn für Humor hatte. Deshalb legte sie nur ihre zweite Hand auf die von Mrs. Dilling und sah ihr tief in die Augen. »Was ist denn so dringend?«
Sybil Dilling rauschte weiter auf einen Sessel in der Ecke des Büros zu und ließ sich hineinfallen. »Sie müssen mich retten!«
»Aber immer gern.« Jetzt tatsächlich ein wenig schmunzelnd, weil Sybil es nicht sehen konnte, ging Robyn zu ihr und ließ sich in dem Sessel ihr gegenüber nieder. »Etwas zu trinken? Kaffee? Oder einen Sherry?«
Bevor Sibyl überhaupt antworten konnte, öffnete sich die Tür und Marcia kam mit einem Tablett herein. Sie hatte alle Wünsche von Mrs. Dilling schon vorausgesehen und sowohl Kaffee, Gin Tonic als auch Sherry auf dem Tablett versammelt, ebenso einen Whiskey. Der war aber eher für Robyn.
Sie stellte das Tablett auf dem niedrigen Tisch zwischen den Sesseln ab und verteilte die Sachen so, dass die Damen sich selbst bedienen konnten. Dann nahm sie das Tablett wieder an sich. »Brauchen Sie sonst noch etwas?«, fragte sie zuvorkommend.
»Nein, danke«, sagte Robyn und lächelte ihr zu. »Das ist perfekt.«
Marcia nickte und ging zur Tür, verließ das Zimmer.
»Sie ist wirklich perfekt, nicht wahr?«, bemerkte Sibyl, während sie der hinausgehenden Marcia kurz hinterherblickte. »Wo haben Sie sie gefunden? Ich habe noch nie eine Sekretärin wie sie gesehen. Die bei meinem Mann«, sie verzog das Gesicht, »sind höchstens halb so alt.«
»Ich lege Wert auf Erfahrung«, erklärte Robyn gelassen, ließ zischend eine ganze Menge Soda in ihren Whiskey fließen und lehnte sich dann zurück.
»Das ist das richtige Stichwort.« Sibyl schnappte sich den Gin Tonic und nahm gierig einen Schluck, als wäre sie kurz vorm Verdursten. »Erfahrung. Die brauche ich. Ihre Erfahrung für meine Wohltätigkeitsveranstaltung nächste Woche.«
Robyn lächelte leicht verwundert. »Ich dachte, Sie hätten den Auftrag an Smithers vergeben.«
»Habe ich auch.« Sibyl Dilling verzog das Gesicht. »Aber er lässt mich hängen.«
»Eine Woche vor der Veranstaltung?« Befremdet hob Robyn die Augenbrauen.
»Ja. Ist das nicht ungeheuerlich?« Es war klar ersichtlich, dass das für Sibyl Dilling an Majestätsbeleidigung grenzte. Wobei Mrs. Dilling die Majestät war. »Er hatte die älteren Rechte, verstehen Sie? Sie sind ja noch nicht so lange in der Stadt –«
In Boston gehörte man erst dazu, wenn man hier geboren war und möglichst auch schon viele Generationen von Vorfahren hier begraben hatte. Neu Zugezogene wurden fast wie Aussätzige behandelt.
»Aber selbstverständlich verstehe ich das.« Verbindlich beugte Robyn sich vor. »Wie kann ich helfen?«
»Mrs. Wynton hat so von Ihnen geschwärmt«, setzte Sibyl an. »Wie Sie das Dinner zu Ehren des Richters organisiert haben . . .«
»Es war mir eine Ehre.« Robyn verbeugte sich leicht und versteckte ihr amüsiertes Lächeln dann hinter ihrem Whiskeyglas.
Wortspiele wie überhaupt Anspielungen jeglicher Art verstand Mrs. Dilling im Allgemeinen nicht. Sie war nicht wegen ihres Verstandes geheiratet worden, sondern wegen ihres Geldes.
Seit sie vor einem halben Jahr nach Boston gekommen war, hatte Robyn viele Veranstaltungen organisiert, und auf einer davon hatte sie Mrs. Dilling getroffen.
Im Gegensatz zu ihrem heutigen Verhalten hatte sie Robyn damals ignoriert und von oben herab behandelt. Sie betrachtete Leute, die Veranstaltungen organisierten, aber nicht zur obersten Gesellschaftsschicht gehörten, als Dienstboten.
Heute wollte sie etwas von Robyn, und deshalb legte sie eine andere Platte auf. Möglicherweise hatte sie das schon morgen wieder vergessen. Oder spätestens nach der Veranstaltung nächste Woche. Oder wenn die Rechnung fällig wurde.
Aber das interessierte Robyn nicht. Sie wusste, wie sie Leute wie Mrs. Dilling nehmen musste. Und wenn sie sie brauchten, strichen sie ihr um den Bart, als hätte sie einen.
Das war alles, worauf es ankam. Dass Robyns Name in den Kreisen genannt wurde, die hier in der Stadt das Sagen hatten. Dadurch bekam sie die Aufträge, auf die sie aus war.
»Sie müssen mich retten!«, wiederholte Sibyl jetzt ihren Ausruf und leerte ihr Gin-Tonic-Glas, als wäre es Wasser. »Sonst bricht alles zusammen!«
»Das wird es nicht«, versicherte Robyn ihr auf die ihr eigene überzeugende Art. »Sie wollen, dass ich mich darum kümmere?«
»Würden Sie das für mich tun?« Sibyl griff nach dem Kaffee, der vor ihr stand, nahm einen Schluck, entschied sich dann jedoch für den Sherry. Wenn sie die Wahl hatte, waren ihr alkoholische Getränke immer lieber als nicht-alkoholische. »Ich wäre Ihnen ewig dankbar!«
Damen der Gesellschaft wie Sibyl Dilling hatten nie ein Problem damit zu lügen. Es war ihnen schon in den Genen ihrer reichen Vorfahren mitgeliefert worden, die ihr Geld oft nicht mit besonders ehrbaren Unternehmungen verdient hatten.
Dankbarkeit gehörte nicht zu ihren hervorstechendsten Eigenschaften. Sobald sie bekommen hatten, was sie wollten, vergaßen sie sofort, wer dafür verantwortlich war, und rechneten jeden Erfolg nur sich selbst an.
Misserfolge schoben sie gern anderen zu, ob sie dafür verantwortlich waren oder nicht. Auf jeden Fall war es für sie wichtig, selbst immer gut dazustehen.
»Wie könnte ich Sie im Stich lassen?« Robyn stellte ihr Glas zurück auf den Tisch und breitete leicht die Arme aus. »Verfügen Sie über mich.«
So etwas hörte Sibyl immer gern. Ein zufriedenes Lächeln überzog ihr Gesicht. »Dann kann ich alles einfach Ihnen überlassen?«
»Mit Vergnügen.« Diesmal hatte eher Robyn eine hoheitsvolle Attitüde, als sie zustimmend den Kopf neigte. »Verlassen Sie sich ganz auf mich.«
»Sie sind meine Lebensretterin!« Sibyl sprang auf. »Jetzt muss ich aber weiter. Mein Friseurtermin wartet schon. Und dann die Schneiderin.« Abschätzig verzog sie das Gesicht. »Sie ist so unfähig. Das Kleid für nächste Woche ist immer noch nicht fertig.«
Vermutlich lag das nicht an der Schneiderin, sondern an Mrs. Dilling, aber solche Aussagen kommentierte Robyn nie. Das brachte Menschen wie Sibyl Dilling nur durcheinander, und dann reagierten sie unberechenbar.
Erneut nahm Robyn Sibyls Hand in ihre beiden, als Sibyl sie ihr reichte. »Machen Sie sich keine Sorgen«, versicherte sie ihr mit einer Stimme, die nichts als warme Anteilnahme verriet, egal was sie innerlich dachte. »Es wird alles gutgehen nächsten Donnerstag.«
»Ich verlasse mich auf Sie.« Sibyl ging zur Tür.
Und wehe, ich lasse dich im Stich wie Smithers, dachte Robyn. Dann kann ich mir gleich einen Sarg kaufen. Diese Überlegungen behielt sie jedoch wie immer für sich.
Sie folgte Sibyl, öffnete die Tür für sie und lächelte ihr völlig harmlos zu.
»Cheerio!«, flötete Mrs. Dilling und segelte durch die Tür, die Robyn ihr aufhielt, hinaus.
»Die hast du ja mal wieder um den Finger gewickelt.« Das war Marcias Kommentar. Sie hatte nur abgewartet, bis Mrs. Dilling draußen auf dem Gang war. »Konnte sie dich bis jetzt nicht nicht leiden?«
Gleichmütig zuckte Robyn die Achseln und lachte. »Du weißt, wie diese Leute sind. Besser als ich.«
»Ja, das weiß ich.« Marcia trat zu ihr. »Sollen wir etwas Besonderes vorbereiten für diese Veranstaltung? Was meinst du?«
»Nein.« Robyn schüttelte den Kopf. »Ruf einfach nur Smithers an und frag ihn, was er schon vorbereitet hat. Vielleicht können wir uns ein bisschen Arbeit sparen. Ich möchte den Auftrag so durchziehen, wie er es gemacht hätte.«
»Gut.« Marcia nickte. »Ich sage den anderen Bescheid. Keine Extras.«
»Hmhm.« Mit einem bestätigenden Blick sah Robyn sie an. »Keine Extras. Alles ganz normal.«
3
Mai in Boston.
Mariana fröstelte ein wenig, als sie das erste Mal seit vier Jahren wieder die kalte Luft spürte.
»Hey! Hey! Hier bin ich!« Wildes Winken und lautes Rufen lenkte ihre Aufmerksamkeit auf eine Gestalt, die wie ein Hampelmann immer wieder hoch und runter sprang.
»Jackie.« Ein Lächeln schlich sich in Marianas Mundwinkel, und sie steuerte mit ihrem Gepäckkarren auf ihre Kindheitsfreundin Jacqueline zu.
»Hallo! Herzlich willkommen zu Hause!« Jackies Augen strahlten sie begeistert an, bevor sie Mariana um den Hals fiel.
Zu Hause . . . Das empfand Mariana nicht unbedingt so, obwohl sie in Boston aufgewachsen war.
Sollte ein Zuhause nicht etwas sein, in dem man sich wohlfühlte? An das man gern dachte und in das man gern zurückkehrte? Wenn das ein Zuhause war, hatte Mariana keins oder Pomona war das eher als Boston.
Aber das war nicht mehr möglich. Dorthin konnte sie nicht mehr zurück, weil ihre Ausbildung dort abgeschlossen war. Das war der Deal gewesen. Vier Jahre Freiheit in Pomona und danach Harvard, das Medizinstudium in Boston.
Dass sie ihre Mutter überhaupt dazu gebracht hatte, war schon fast so eine Art Wunder. Sie hatte gewollt, dass Mariana von Anfang an nach Harvard ging, sich gar nicht von Boston wegbewegte. Was für andere ein Traum war, an der Eliteuni Harvard zu studieren, war für Mariana mehr eine Art Albtraum.
Aber nun musste sie es tun. Ihr PreMed-Studium war abgeschlossen, sie konnte sich nicht mehr drücken.
»Erzähl.« Immer noch aufgeregt strahlte Jackie sie an. »Wie war es in Pomona?«
Lächelnd schüttelte Mariana den Kopf. »Das weißt du doch. Du hast mich sogar dort besucht. Und wir haben regelmäßig telefoniert.«
»Du weißt schon, was ich meine.« Während sie gemeinsam den Karren mit dem Gepäck zu Jacquelines Auto schoben, hakte Jackie sich mit einem Arm in Marianas ein. »Hast du jemanden . . .«, sie klimperte mit den Wimpern, »kennengelernt? Davon hast du nie etwas erzählt.«
»Weil es nichts zu erzählen gab.« An Jackies Wagen angekommen ließ Mariana den Griff des Gepäckkarrens los und aktivierte damit die Bremse. »Machst du mal auf?«
»Du warst vier Jahre da.« Ein Piepen zeigte an, dass Jackie den Wagen geöffnet hatte. »Vier Jahre!« Jacqueline hätte auch sagen können eine Ewigkeit, es hätte genauso geklungen.
»Und?« Mariana schob den ersten Koffer in den Kofferraum.
»Und?«, fragte Jackie entgeistert zurück. »Was heißt denn hier und? Vier Jahre lang kannst du ja wohl nicht allein gewesen sein. Es sind in der Highschool ja schon immer alle um dich herumgeschwirrt.«
Ätzend, dachte Mariana. Denn in Boston hatte jeder gewusst, wer sie war, aus welcher Familie sie stammte. Unter anderem deshalb war sie an der Highschool so beliebt gewesen.
Aber sie war auch ein netter Mensch. Das vergaß sie manchmal. Im kalifornischen Pomona auf der anderen Seite der USA, Tausende von Kilometern entfernt an der Westküste, hatte ihre Bostoner Ostküstenfamilie nur vergleichsweise wenig gezählt. Und sie war dort genauso beliebt gewesen wie zuvor an der Bostoner Highschool.
»Shirley wollte mich fast nicht gehen lassen, falls du das meinst.« Sie schmunzelte ein wenig.
»Shirley war deine Mitbewohnerin!« Jackie warf die Arme in die Luft. »Du weißt ganz genau, dass ich das nicht meine!«
»Ich weiß, was du meinst.« In Marianas Kopf spielten sich ein paar Szenen ab, die sich auf das bezogen, was Jackie meinte. »Aber da war nichts. Nichts Ernstes. Sonst hätte ich dir das erzählt.«
»Vier Jahre lang?« Jackie schmollte ein wenig, als sie sich hinters Steuer setzte. »Da war bestimmt was. Du willst es mir nur nicht erzählen. Bin ich nicht mehr deine beste Freundin?«
»Doch, natürlich.« Liebevoll lächelte Mariana sie an. »Aber ich kann nichts erzählen, wenn da nichts war.«
»Nie im Leben!« Obwohl sie jetzt am Steuer saß und das eigentlich hätte festhalten sollen, da sie über den Parkplatz zum Ausgang fuhr, warf Jackie erneut die Arme in die Luft. »Nicht mal ein One-Night-Stand?«
»Wie war es denn bei dir?« Ganz gezielt beschloss Mariana, den Spieß umzudrehen, um Jacqueline von dem Thema abzubringen, das sie so interessierte. »Wer ist es diese Woche?«
Jackie seufzte. »Derselbe wie vorige. Und wie vor einem Monat. Er ist einfach . . . hinreißend.« Ihre Augen verdrehten sich fast vor Entzücken.
»Soll ich lieber fahren?« Mariana hatte wirklich Bedenken, ob Jackie in diesem Zustand in der Lage war, einen Wagen zu steuern.
»Nein, nein, schon gut.« Tatsächlich griff Jackie nun mit beiden Händen fest zu. »Es hat ja sowieso keinen Sinn. Er hat keinen Penny.«
»Das ist nicht das Wichtigste«, widersprach Mariana.
»Das sagst du.« Schnell warf Jacqueline einen Blick zu ihr. »Weil du so viel hast, dass du dir darum keine Gedanken machen musst.«
»Ich . . .«, entgegnete Mariana betont, »habe gar nichts. Meine Mutter hat das Geld.«
»Spielt keine Rolle«, meinte Jackie schulterzuckend. »Du kannst haben, so viel du willst.«
»Nur unter bestimmten Bedingungen«, widersprach Mariana. »Wenn ich das tue, was meine Mutter von mir verlangt.«
»Ich wünschte, ich hätte noch eine Mutter.« Auf einmal klang Jacquelines Stimme nicht mehr so fröhlich.
»Tut mir leid.« Entschuldigend lächelte Mariana sie an. »Ich hätte das nicht sagen sollen.«
»Doch, doch. Schon gut.« Auch Jacqueline lächelte ihr mit einem kurzen Seitenblick zu. »Du kannst ja nichts dafür, dass –« Mitten im Satz unterbrach sie sich selbst und starrte nur noch auf die Straße.
Es war schon merkwürdig, wie die Dinge auf der Welt verteilt waren, dachte Mariana. Jackie hatte sehr gute Eltern gehabt, sehr liebevolle Eltern, denen wirklich etwas an ihr lag.
Ganz im Gegensatz zu Mariana, die eine Mutter hatte, der höchstens etwas an ihr selbst lag, der einzigartigen (ihrer eigenen Ansicht nach) Amanda Elizabeth Bradlee Fulton, an niemand anderem. Am allerwenigsten an ihrer Tochter. Außer wenn sie sie irgendwo vorführen und mit ihr angeben konnte. Wenn sie genau das tat, was ihre Mutter wollte, und das brave Kind spielte.
Doch wie liebevoll sie auch immer gewesen waren, Jacquelines Eltern waren beide von einem betrunkenen Mistkerl totgefahren worden, der es nicht wert war, dass man sich überhaupt mit ihm beschäftigte.
Ihm war nichts passiert oder nur ein paar Kratzer. Er konnte den Rest seines bedeutungslosen Lebens weiterführen, wahrscheinlich, bis er hundert war. Und dabei vielleicht noch einer Menge anderer Leute Schaden zufügen, die ebenso unschuldig waren wie Jackies Eltern.
Gerecht war die Welt nicht, das konnte man zumindest daraus lernen.
Da Jackies Eltern noch sehr jung gewesen waren, noch nicht einmal vierzig Jahre alt, hatten sie noch nicht mit einem so frühen Tod gerechnet. Vor allem beide gleichzeitig. Deshalb hatten sie Jackie nicht viel hinterlassen.
Ihr Vater war zu jenem Zeitpunkt gerade dabei gewesen, sich eine eigene Firma aufzubauen. In die hatte er alles Geld gesteckt, das die Familie besaß, plus noch ein paar Kredite.
Die Firma war nach seinem Tod den Bach runtergegangen. Das Geld war futsch. Und die Kredite hätte Jackie am Hals gehabt, wenn sie das Erbe angenommen hätte.
Das hatte sie nicht getan, doch dadurch hatte sie auch das Haus verloren, in dem sie ihr ganzes Leben lang gelebt hatte, in dem sie aufgewachsen war. Die Universität konnte sie auch nicht mehr bezahlen. Sie hatte ihr Studium aufgeben müssen und arbeitete jetzt in einer Boutique als schlecht entlohnte Verkäuferin auf Provisionsbasis.
Das winzige Einkommen ermöglichte ihr gerade einmal, die viel zu hohe Miete für ein genauso wie ihre Geldmittel winziges Zimmer in der Stadt zu bezahlen. Danach blieb ihr kaum mehr etwas zum Essen übrig.
Dennoch hatte ihre Familie, die Familie Caron de Beaumarchais, immer zu den angesehensten der Stadt gehört, und das war ihr geblieben. Geld zu haben war in Boston wichtig, aber noch wichtiger war es, einen Namen zu haben.
Damit sie einmal aus diesem muffigen Zimmer herauskam, hatte Mariana ihr ein Ticket nach Pomona geschenkt, sodass Jackie sie besuchen konnte. Das war ihr erster Urlaub seit Jahren gewesen.
Aber es war, wie es war. Marianas Mutter hätte niemals zugelassen, dass sie Jackie regelmäßig unterstützte, obwohl das bei dem Vermögen von Marianas Familie ein Pappenstiel gewesen wäre.
Man sprach nicht über Geld, aber haben musste man es. Das wurde einfach vorausgesetzt. So wurde Jackie weiterhin zu Bällen eingeladen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnte. Darüber dachte niemand nach.
»Du willst mir also nichts erzählen«, nahm Jackie das Thema wieder auf, das sie am meisten interessierte, und schmunzelte von der Fahrerseite zu Mariana herüber. »Wenn du so ein stilles Wasser bist, steckt meistens etwas dahinter.«
Lachend schüttelte Mariana den Kopf. »In diesem Fall nicht. Ich habe mich in Pomona hauptsächlich auf mein PreMed-Studium konzentriert. Das war schon Arbeit genug. Ich hatte kaum Zeit für etwas anderes.«
»Du bist einfach zu gut für diese Welt.« Jackie schmunzelte. »Wie kann ein Medizinstudium wichtiger sein als . . .«, sie machte eine bedeutungsvolle Pause, »die Liebe?« Erneut verdrehte sie die Augen.
»Pass auf die Straße auf!« Automatisch griff Mariana ans Lenkrad. Als Jackie wieder auf die Straße schaute, lächelte sie. »Wie geht es Simon denn? Hat er den Job bekommen, für den er sich beworben hatte?«
»Noch nicht. Aber wir hoffen, das wird noch was. Im Gegensatz zu mir hat er ja ein abgeschlossenes Studium.« Jacqueline seufzte. »Leider ist er einer dieser altmodischen Typen, die meinen, sie könnten nicht heiraten, bevor sie ihre Frau nicht ernähren können.« Schulterzuckend fügte sie hinzu: »Mir wäre das ja egal. Irgendwie würden wir es schon schaffen.«
»Ihr könntet doch wenigstens zusammenziehen. Dann müsstet ihr nicht zwei Wohnungen bezahlen«, schlug Mariana vor.
»Mein Zimmer in der Stadt ist nun wirklich zu klein für zwei«, erklärte Jacqueline stirnrunzelnd. »Und er wohnt draußen auf dem Land. Wie soll ich von da zu meinem Job kommen?«
»Mit dem Auto?« Mariana hob die Augenbrauen.
»Mit dem hier?« Jackie lachte. »Das gehört mir nicht. Das habe ich mir nur geliehen, um dich abzuholen.«
Freundschaftlich legte Mariana eine Hand auf Jacquelines Arm. »Ich hätte mir doch ein Taxi nehmen können.«
»Dann hätte ich dich aber vielleicht gar nicht gesehen vor dem Ball«, sagte Jackie.
Marianas Mundwinkel fielen herunter. »Ach ja, der Ball«, murmelte sie auf einmal verdrossen.
»Bitte, bitte . . .« Flehend blickte Jackie sie an. »Lass ihn nicht ausfallen. Ich habe mich so darauf gefreut. Das ist das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass ich wieder auf einen Ball gehen kann.« Sie seufzte. »In einem uralten Ballkleid, weil ich mir kein neues leisten kann.« Schon schmunzelte sie wieder, strahlte auf einmal fast übers ganze Gesicht. »Aber das wird mich nicht am Tanzen hindern. Die ganze Nacht!«
Ihre Begeisterung konnte Mariana zwar nicht teilen, aber sie musste unwillkürlich lächeln. »Wenn das so ist, dann muss ich ja wohl auch kommen«, gab sie gutmütig nach.
4
»Sind die Vorbereitungen abgeschlossen?« Robyn warf einen forschenden Blick in die Runde. »Haben wir alles im Griff?«
Ein halbes Dutzend Augenpaare sah sie an, vier Männer und zwei Frauen.
»Keine Fragen mehr?«, fuhr Robyn fort. »Der Ablauf ist klar?«
Die meisten nickten. Ein jüngerer Mann schien jedoch noch unsicher. »Was ist mit den Hilfskellnern?«, fragte er. »Wer ist für den Nachschub zuständig?«
»Wenn du nicht allein klarkommst, frag Marcia.« Robyn nickte ihm aufmunternd zu. »Sie wird immer irgendwo sein und weiß über alles Bescheid.«
Er schien erleichtert. Allein wäre ihm die Verantwortung wohl zu viel gewesen.
»Und ich bin ja auch noch da«, fügte Robyn beruhigend hinzu. »Eine von uns beiden wirst du immer finden.«
»Alles klar, Boss.« Er straffte die Schultern und setzte eine zuversichtliche Miene auf. »Meinetwegen kann’s losgehen.«
Robyn schmunzelte. »Da bin ich ja froh«, bemerkte sie leicht ironisch. »Dann an die Arbeit!« Sie klatschte in die Hände. »Gebt euer Bestes und dann setzt noch einen drauf!«
Motiviert begab sich die Truppe in den Saal. Vielleicht etwas zu motiviert. Auch das konnte zu unliebsamen Überraschungen führen.
Mit gerunzelter Stirn schaute Robyn ihnen nach.
»Wird schon gutgehen.« Das war Marcia, die da plötzlich an ihrer Seite war. Wie so oft erschien sie wie aus dem Nichts. Ein guter Geist, der immer wusste, wo er gebraucht wurde. »Mach dir keine Sorgen.«
»Ich mache mir keine Sorgen.« Robyn sah sie an. »Aber vielleicht ist Harry doch noch nicht so weit.«
»Ich werde ein Auge auf ihn haben«, versprach Marcia. »Aber ich glaube, er schafft es.«
»Und ich glaube dir, wenn du das sagst.« Vertrauensvoll lächelte Robyn sie an. »Du hast auch schon Mrs. Dilling schwer beeindruckt. Wodurch wir den Auftrag für diesen Ball hier bekommen haben. Das wäre vorher gar nicht möglich gewesen.«
»Ich glaube eher, du hast sie beeindruckt«, widersprach Marcia. Sie seufzte. »Und Smithers hat sich darüber hinaus selbst das Wasser abgegraben. Eine Sibyl Dilling lässt man nicht im letzten Augenblick sitzen. Sie erzählt es allen ihren Freundinnen, und man ist in der Bostoner Gesellschaft erledigt.«
»Selbst so ein alteingesessenes Geschäft wie das von Smithers.« Bedauernd schüttelte Robyn den Kopf. »Dabei ist seine Frau krank geworden, und er musste sich um sie kümmern. Wollte sich um sie kümmern. Hat das über seine Geschäftsinteressen gestellt. Was ja für ihn spricht. Diese Leute kennen wirklich keinerlei Loyalität.«
Marcia lachte. »Oh doch! Die ihrem Geld gegenüber. Glaub mir, die hängen mehr an ihrem Schmuck als an ihren Ehegattinnen und -gatten. Die sind meist ja sowieso nicht ihre eigene Wahl gewesen. Geld heiratet Geld. Etwas anderes kommt überhaupt nicht infrage.«
»Komische Gesellschaft«, meinte Robyn. »Ich bin ja nicht gerade auf Rosen gebettet gewesen, als ich aufgewachsen bin, aber so etwas . . .« Sie schüttelte den Kopf. »Ich dachte immer, reiche Leute sind anders. Die können sich doch alles leisten, müssen sich keine Gedanken um den täglichen Lebensunterhalt machen. Da könnten sie sich doch um die wirklich wichtigen Dinge kümmern. Andere Menschen zum Beispiel.«
»Das tun sie ja.« Marcia zuckte die Schultern. »Deshalb veranstalten sie solche Wohltätigkeitsbälle wie diesen hier. Damit beruhigen sie ihr schlechtes Gewissen.«
Zweifelnd zog Robyn die Augenbrauen hoch. »Haben sie überhaupt eins?«
»Ja, du hast recht«, nickte Marcia. »Sie haben keins. Niemand von denen fühlt sich für jemanden verantwortlich, der kein Geld hat. Oder keinen Namen. Mit dem sie nicht von Kindheit an in ihrer vergoldeten Wiege gespielt haben. Diese Art Bälle werden nur veranstaltet, um das eigene Image zu pflegen. Um vor den anderen Wohlbetuchten gut dazustehen. Deshalb muss einer auch immer prächtiger sein als der andere.«
»Und das Geld geht dann von den Spenden ab, die das Ganze einbringt.« Robyn lachte hohl auf. »Bleibt da für die armen Leute überhaupt noch was übrig, für die das eigentlich sein soll?«
»Soll es ja nicht«, sagte Marcia. »Das ist nur Fassade. In Wirklichkeit tun sie das nur für sich selbst.« Sie zuckte die Achseln. »Aber das ist nicht unser Problem. Wir sollten uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern.« Sie warf einen fragenden Blick auf Robyn. »Gibt es noch etwas, worum ich mich kümmern muss?«
»Ich glaube nicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.« Robyn verzog ein wenig das Gesicht. »Wenn Harry nicht die Nerven verliert.«
»Wird er nicht.« Marcia war da offenbar zuversichtlicher als Robyn. »Wir haben schließlich alles x-mal besprochen.«
»Aber vielleicht will er sich beweisen.« Immer noch war Robyn skeptisch. »Dann schießt er über das Ziel hinaus, und schon sitzen wir in der Klemme.«
»Da kenne ich noch jemanden, auf den das mal zugetroffen hat«, blinzelte Marcia sie an. »Und sie hat es auch gelernt.«
»Ja, ich weiß. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.« Robyn lachte. »Du bist die Beste, Marcia!«
»Ich weiß.« An Selbstbewusstsein mangelte es Marcia nicht. »Aber du bist auch nicht schlecht. Kannst dich langsam sehen lassen.«
Robyns Mundwinkel zuckten. »Besser wohl nicht.«
»Doch«, widersprach Marcia. »Du hast schließlich Saaldienst. Damit du alles im Auge behalten kannst. Und zur richtigen Zeit richtig reagieren.«
»Natürlich.« Robyn nickte. »Das werde ich schon hinkriegen.«
»Daran habe ich keinen Zweifel.« Ein Lächeln überzog Marcias Gesicht. »Mrs. Dillings Veranstaltung war da schon eine gute Generalprobe. Und obwohl sie das selbstverständlich als das Highlight der Saison betrachtet hat, ist das hier das wirkliche Highlight. Der absolute Knaller. Alles, was Rang und Namen und natürlich Geld hat, wird hier sein. Die Damen werden sich mit Schmuck behängen, der unbezahlbar ist.«
»Noch mehr als bei Mrs. Dilling kann ich mir fast nicht vorstellen«, sagte Robyn. »Da sahen sie doch alle schon aus wie Weihnachtsbäume.«
Marcia lachte. »Sehr teure Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume aus Gold, Diamanten und Platin.«
»Muss es ja auch geben«, meinte Robyn lässig, grinste jedoch dabei. »Worüber sollten sich diese Leute sonst zu Weihnachten freuen? Sie haben ja schon alles.«
»Mehr als das«, bestätigte Marcia nickend. »Und sie wissen es noch nicht einmal. Für sie ist das alles selbstverständlich.« Sie machte eine kleine Pause. »Bis sie es verlieren.«
»Damit rechnen sie bestimmt nicht«, sagte Robyn. »Sonst wäre hier mehr Sicherheitspersonal.«
»Sie denken, sie brauchen das nicht. Die Gäste sind ja handverlesen«, nickte Marcia. »Hier kommt niemand rein, dessen Familie sie nicht schon seit hundert Jahren kennen.«
»Außer uns.« Robyn lachte.
»Ja, außer uns.« Marcia schürzte die Lippen. »Aber jetzt sollten wir uns an die Arbeit machen und schauen, dass alles glattläuft. Sonst gibt es schon am Anfang einen Skandal, weil das Buffet nicht rechtzeitig eröffnet wird.«
»Na, so etwas wollen wir diesen Leuten ja nicht zumuten«, scherzte Robyn. »Sie könnten glatt verhungern.«
»Eben«, stimmte Marcia ebenso unernst zu. »Dann müssen wir die Penner auf den Straßen bitten, einen Wohltätigkeitsball für die oberen Zehntausend von Boston zu veranstalten.«
Robyn lachte laut auf. »Zumindest könnten wir das Catering organisieren.«
»Und noch eine ganze Menge andere Sachen wie hier auch«, setzte Marcia fort. »Dann mal los.«
»Ja, dann mal los«, zitierte Robyn sie und folgte ihr mit einem Blick auf das riesige Herrenhaus, das aus einem Film hätte stammen können, hinein.
5
»Willst du die Klunker heute Abend alle tragen?«
Mariana warf nur kurz einen Blick zu Jackie hinüber, die vor dem Spiegeltisch in Marianas Schlafzimmer stand und eine der Ketten aus Marianas Schmuckschatulle durch ihre Finger gleiten ließ, und schmunzelte. »Du willst dir etwas ausleihen? Bitte, bedien dich.«
»Darf ich wirklich?« Jackies Augen leuchteten ungläubig auf.
»Natürlich darfst du. Du siehst doch selbst, es ist viel zu viel für mich.« Auffordernd lächelnd nickte Mariana ihr zu. »Nimm, was du magst.«
»Nur für heute Abend«, versicherte Jackie ihr hastig. »Direkt nach dem Ball bekommst du alles wieder zurück.«
»Keine Eile.« Mariana ging zu ihrem Kleiderschrank hinüber. »Du hast viel mehr Spaß an diesen Sachen als ich. Genieß das ruhig, solange du willst.«
»Aber die Dinger sind sauteuer.« Jackie hatte gleich zwei Ketten und ein Collier übereinander auf ihren Hals gelegt und betrachtete sich im Spiegel. »Wenn ich eins verliere, könnte ich das nie bezahlen.«
»Müsstest du auch nicht«, sagte Mariana. »Ist alles versichert.«
Immer wieder wechselte Jacqueline die Schmuckstücke an ihrem Hals aus. »Ich kann mich nicht entscheiden.« Ihre Augen strahlten Mariana an, dann wieder sich selbst im Spiegel. »Am liebsten würde ich sie alle tragen.«
Mariana lachte. »Dann tu’s doch.«
»Ach nein.« Auf einmal wirkte Jackie fast schüchtern. »Was würden dann die Leute sagen?«
»Das hat dich doch noch nie gekümmert.« Überrascht blickte Mariana sie an.
Etwas unentschlossen legte Jackie den Schmuck auf die Platte vor dem Spiegel zurück. »Ich weiß nicht. Jeder weiß doch, dass ich mir so etwas nicht leisten kann. Nicht . . . mehr.«
»Und wenn?« Mit schnellen Schritten war Mariana bei ihr, griff nach dem Collier und legte es ihr um den Hals. »Ich kann es mir leisten. Und ich bin deine Freundin.«
»Großzügig warst du schon immer.« Jackie lächelte sie im Spiegel an. »Auch als ich es noch nicht nötig hatte.« Ihr Lächeln erstarb.
»Denk nicht mehr daran.« Mariana strich ihr übers Haar. »Ich möchte nicht allein zu diesem Ball gehen, das weißt du.«
»Ich tue dir also einen Gefallen?« Ein leises Lächeln schlich sich in Jacquelines Mundwinkel zurück.
»Ja, das tust du.« Mariana griff nach einer der anderen Ketten und hob sie hoch. »Das ist doch alles sowieso nur Tand.«
»Teurer Tand«, sagte Jacqueline. »Den sich die meisten Leute nicht leisten können.«
»Ich schenke ihn dir.« Beinah abschätzig schaute Mariana auf ihr Schmuckkästchen und auf den Schmuck, der jetzt daneben lag. »Alles, wenn du willst.«
»Ich mag ja arm sein, aber eine Diebin bin ich nicht.« Auf einmal schmunzelte Jacqueline. »Denn so käme ich mir dann vor. Für heute Abend«, sie entschied sich endlich für das Collier und legte es endgültig an, »werde ich aber gern so tun, als würde mir das alles gehören.«
»Tu das.« Mariana schmunzelte auch. »Wenigstens ein Mensch, der Spaß an diesen Dingen hat. Irgendwie tun mir die armen Dinger fast immer schon leid, weil ich mir nichts aus ihnen mache.«
»Ach, ihr armen lieben Brillanten . . .« Jackie lachte, während sie über die glitzernden Steine an ihrem Hals strich und in den Spiegel sah. »Heute werdet ihr niemandem leidtun. Und ich mir auch nicht.«
Als sie am Abend beide gemeinsam den Ballsaal betraten, richteten sich alle Blicke auf sie. Mariana selbst ließ ebenfalls ihre Blicke über die Anwesenden schweifen. Nachdem sie so lange auf dem College fortgewesen war, war das heute das erste Mal, dass sie sie alle wiedersah.
Vieles erschien ihr auf einmal fremd, die Menschen wie auch der Anlass. Und doch freute sie sich zu ihrer eigenen Überraschung tatsächlich ein wenig, wieder hier zu sein. Denn manches wirkte beruhigend vertraut. Auf ganz andere Art vertraut als das College, ihre Freunde und Mitstudenten dort.
Sie hätte auch hier im Osten aufs College gehen können, auf die altehrwürdige Harvard-Universität in Cambridge bei Boston, wie es in ihrer Familie immer üblich gewesen war und wie es alle von ihr erwartet hatten, aber sie hatte so weit weg von hier weggewollt wie möglich. Wenigstens für eine Weile. Weiter als von der Ostküste an die Westküste ging es fast nicht.
An der Westküste, in Kalifornien, war das Leben wesentlich freier. Denn der Bostoner Snobismus war sprichwörtlich. Diejenigen, die sich zu den ersten Familien zählten – was sich für Außenstehende vielleicht harmlos anhörte, aber ungefähr das gleiche bedeutete wie zur königlichen Familie –, sprachen immer noch einen Dialekt, der mehr an britisches Englisch als an amerikanisches erinnerte. Und genauso abweisend und steif wie die Briten verhielten sie sich auch, wenn sie jemanden trafen, der nicht aus ihren Kreisen und aus Boston stammte.
In Pomona hatte Mariana kaum etwas anderes als T-Shirts und kurze Hosen oder leichte Sommerkleider getragen. Hier hätte sie sich darin totgefroren. Sowohl wegen des Wetters als auch wegen der Menschen.
An diesem Abend wurde alles aufgefahren, was in Boston Rang und Namen hatte, und weder T-Shirts noch kurze Hosen waren hier erlaubt. Hier herrschte der alte Dresscode für Galas und Bälle dieser Art: Abendkleid für die Damen und Frack für die Herren.
Dadurch sahen alle Männer wie Pinguine aus und einige der Frauen wie Papageien. Vermutlich Zugezogene, die nicht zu den alten Familien Bostons gehörten. Die meisten wirkten allerdings einfach nur elegant und gediegen, wie es für die oberen Zehntausend von Boston angemessen war.
Für junge Mädchen und junge Frauen wie Mariana und Jacqueline waren helle Farben angesagt, von Weiß bis hin zu allen Schattierungen von Pastell. Applikationen darauf konnten auch einmal in der Augen- oder Haarfarbe der Trägerin gehalten sein. Wobei rothaarige, grünäugige Trägerinnen die Nase vorn hatten. Sie hatten mehr Möglichkeiten, sich von den anderen abzusetzen.