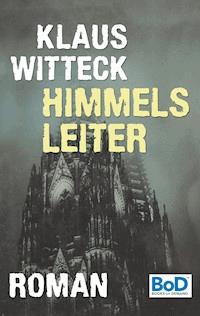Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Florenz im Jahre 1497. Vor drei Jahren sind die Medici gänzlich aus der Stadt vertrieben worden, Florenz ist eine Republik geworden. Aber die Geschicke der Stadt werden nicht nur durch die Signoria bestimmt, sondern ganz nachdrücklich auch von Girolamo Savonarola, Dominikaner und Prior im Kloster von San Marco. Er geißelt die Eitelkeiten, lässt Tand und Luxus auf der Piazza della Signoria verbrennen und wettert gegen die Freizügigkeit der Künste. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt. In dieser Situation blicken zwei junge Baronessen traurig aus dem Fenster des väterlichen Palastes. Sie sind Zwillinge, beide wunderschön und gleichen sich wie ein Haar dem anderen. Eine Langeweile hat sie ergriffen; denn sie leiden darunter, dass sie nicht ausfliegen dürfen aus ihrem goldenen Käfig, nicht in die Stadt, nicht auf den Markt von San Lorenzo. Da kommt Filomena auf eine Idee: Sie wollen sich ein Spiel ausdenken, das sie vielleicht aus ihrer goldenen Gefangenschaft befreit: Jemand soll kommen und herausfinden, worin sie sich unterscheiden. Den Unterschied aber kennen nur sie alleine, der Ausgang des Spiels ist ebenso ungewiss wie riskant. Jemand, vielleicht Lodovico. Er ist ein junger Maler und kommt soeben aus Prato, um in die Werkstatt des berühmten Botticelli einzutreten. In San Marco wartet sein Vetter auf ihn, selber Maler, aber wegen eines Fehltritts vor kurzem in das Kloster eingetreten. Unter dem Fenster der Mädchen kommt es zu einem aufregenden Gespräch, und dieses Gespräch ist der Anfang für einen delikaten Auftrag im Palazzo Ricasoli, außerdem der Anfang für viele andere galante Entwicklungen. Bald ist auch Federigo mit von der Partie, Lodovicos Vetter und in San Marco nur unter dem Namen Fra Bartolommeo bekannt. Unterdessen spitzen sich die Verhältnisse in der Stadt zu. Nicht nur tadelt Savonarola die Florentiner wegen ihrer Unmoral, zum Schluss greift er auch den Borgia-Papst in Rom an. Wir erleben ein turbulentes Jahr in Florenz, mit der prächtigen Feier von San Giovanni, mit der Pest, mit dem Scheiterhaufen der Eitelkeiten. Die vier jungen Leute werden mitten hineingezogen in diesen Strudel einer bewegten historischen Epoche. Ein »kleines Kammerspiel auf der Vorbühne zum großen Welttheater«, so Luca Landucci, stadtbekannter Apotheker und Erzähler dieser Geschichte. Am Schluss warten zwei Fragen auf eine Antwort: Wie geht es aus, das Spiel zwischen den vier jungen Leuten? Welches Schicksal ist dem Prior von San Marco beschieden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Türkei, Sommer 2004. Zwei Mädchen steigen in unseren Bus, sechzehn, kaum siebzehn Jahre alt, wunderschön, lachende Gesichter, schweres, blondes Haar, aber zum Verwechseln ähnlich. Ich kann überhaupt keinen Unterschied feststellen, ich bin nur wie betört von diesem Wunder der Natur. Vierzehn Tage kann ich das Mirakel nun betrachten, aber einen Unterschied finde ich nicht heraus. Bei Gelegenheit frage ich ihre Mutter, ob sie denn ihre Töchter überhaupt unterscheiden könne. Mit einem hintergründigen Lächeln erwidert sie, das könne sie schon. Als wir nach Hause fliegen, ist die Idee für die folgende Geschichte geboren.
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zweites Buch
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Letztes Kapitel
ERSTES BUCH
Erstes Kapitel
Weißt du«, sagte Filomena eines schönen Sonntagnachmittags im Mai, »das Leben in der Stadt bringt auch nicht mehr Abwechslungen als das auf dem Lande. Sicherlich finden wir es aufregend, die Nächte hier wach am Fenster zu verbringen und die armen Wesen zu beobachten, die mit ihrem kleinen Bündel zum Findelhaus huschen und dabei so vorsichtig und behutsam sind, damit nur niemand sie entdecke. Aber wir entdecken sie, nicht wahr? Und wir kommen uns dabei so durchtrieben und so verworfen vor, dass wir dies schon für ein aufgeregtes Leben halten. Beim Tag, wenn die Serviten aus der Annunziata zum Dom pilgern, ist es die andere Richtung, und so lernen wir, dass man eine Straße herauf- und heruntergehen kann. Das ist ein wunderbarer Zeitvertreib!«
Beatrice, im Schatten des Zimmers bei einer Stickerei sitzend, schaute zu ihrer Schwester auf, die vor dem Kreuz des offenen Fensters stand. Sie nahm die Schwester nur als Silhouette wahr; denn blendend stand die Sonne auf der ockerfarbenen Wand des Palazzo auf der anderen Straßenseite.
»Filomena, meine herzliebe Schwester, das ist nun wieder einmal dein unbändiges Wesen. Nimm dir eine Nadelarbeit wie ich und lasse deine Gedanken nicht über die Straße schweifen. Gebiete ihnen Raum, dass sie dich nicht verführen in ein Land, welches du da unten doch nicht sehen kannst. Sondern sei fein still und warte auf das, was das Schicksal für dich bestimmt hat. Sicher, es wäre schön, wenn wir wieder da draußen sein könnten auf der Straße nach Prato, und der Wagen hätte einen Schaden, der junge Mann auf seinem Pferd käme wieder, dann würde er erst dich und dann mich anschauen, dann wieder dich, und dann würde er sagen: ›Allmächtiger Gott, dass du so etwas schaffen konntest, dafür bist du gepriesen in alle Ewigkeit!‹ Dabei würde er es nicht bewenden lassen, sondern er würde, nun ja, du weißt.«
Dabei seufzte Beatrice tief, ließ ihre Hände in den Schoß sinken und schaute an ihrer Schwester vorbei auf die ockerfarbene Wand, als müsse dort unweigerlich die Schrift erscheinen. Filomena schaute ihre Schwester liebevoll an und wusste, dass man selber schreiben musste, um eine Schrift zu sehen. Die Ähnlichkeit der Zwillinge war überwältigend und hatte bis zu diesem Tage nicht nur jenen jungen Mann auf der Straße nach Prato aus der Fassung gebracht. Beide besaßen ein langes, seidiges Haar, das glänzte, als wäre es aus neu getriebenem Kupfer, ihre Stirnen waren hoch und von einem makellosen Glanz, darunter zwei Brauen wie zwei zarte Striche aus dem Pinsel des größten Malers ihrer Vaterstadt, die braunen Augen hell und wach, jene von Filomena ein wenig mehr ins Spöttische spielend, während Beatrice eine leichte Zurückhaltung erkennen ließ. Wer wollte diesen Unterschied schon bemerken, wenn er die Mädchen nicht näher kannte? Die Nasen gerade und ebenmäßig, mit einem kleinen Schatten darunter, der Mund wie eine reife Kirsche, der viel Verwirrung unter den jungen Männern stiften konnte, wenn er geschlossen war, und bedenkliche Unbeherrschtheiten, wenn er sich öffnete. Zu der letzten Gefühlslage trug nicht wenig das stets abenteuerliche Dekolleté ihrer Kleider bei, und darin unterschieden sich Filomena und Beatrice nicht um ein Jota. So weit ging Beatrices Zurückhaltung schließlich nicht. Freilich gab es Unterscheidungsmerkmale, die nicht auf der Hand lagen, aber diese hatte ein Mann noch niemals entdeckt, auch der junge Mensch auf der Straße nach Prato nicht.
Filomena setzte nach.
»Nun, siehst du, meine geliebte Schwester, auch du bist auf der Landstraße, auch du bist es leid, den ganzen Tag von rechts nach links und von links nach rechts zu schauen. Das ist doch kein Leben für zwei Mädchen von fast zwanzig Jahren! Ich will hier heraus. Gleich morgen werde ich den Vater bitten, uns auf den Markt von San Lorenzo zu lassen, die Giannetta soll uns begleiten, und über den Pomeranzen und Limonen wird sich doch vielleicht auch noch etwas anderes entdecken lassen!«
Der Markt von San Lorenzo! Und zwei Mädchen ganz alleine dort, ohne männliche Begleitung! Wie konnte sich Filomena nur zu solch’ kühnen Plänen versteigen! Freilich, schön wäre es doch. Man ginge durch die Gassen der Buden, befühlte eine Frucht, ließe ein seidenes Tuch durch die Hände gleiten, ließe sich vom Ingwer und Koriander abmessen und genösse die Blicke der Menschen, insonderheit der jungen Männer, die ihre Hüte ziehen und »Gott zum Gruße« sagen würden. Und manch’ einer wäre dabei, der über das Doppelwunder der Natur wieder einmal Mund und Augen aufsperren würde. Das war ein herrlicher Gedanke für Beatrice, und inständig umarmte sie ihre Schwester, die an ihren Stuhl herangetreten und niedergekniet war.
»Nicht wahr, Beatrice, du kommst mit? Wir gehören doch zusammen, eines kann ohne das andere nicht sein. Das kann ich mir gar nicht ausdenken.«
»Nein, ich auch nicht. Du kennst jeden meiner Gedanken, und so geht es mir mit den deinen. Was wird nur sein, wenn wir einmal diese Männer heiraten müssen?«
»Diese Männer! Weißt du noch ihre Namen?«
»Der eine hieß Anichino, und seine Familie hat einen Palazzo in der Via de’ Tornabuoni, der war für dich. Und der für mich ...«
»Der hieß Calandrino, und sein Vater ist der Kommandant oben in Fiesole. Unser Vater hat wahrlich gut gewählt.«
»Ohne uns zu fragen! Was sind wir doch arme Mädchen! Und bis dahin sperren sie uns ein in diesen goldenen Käfig. Ach Filomena, glaubst du nicht manchmal, es wäre doch schöner gewesen, als ein Mann auf die Welt gekommen zu sein?«
Filomena ging zu dem großen Schrank, in dessen Mitteltür ein Kristallspiegel eingelassen war.
»Sicher, mein Schatz, manches spricht dafür, ein Mann zu sein. Aber manches spricht auch dagegen. Komm’ einmal her zu mir, dass ich es dir erkläre!«
Dabei streckte sie ihre Hand aus, und Beatrice folgte ihr, erhob sich aus ihrem Sessel und schmiegte sich in den Arm ihrer Schwester. Beide schauten sie in den Spiegel, in dem das helle Licht der Straße zurückgeworfen wurde. Was sahen sie? Sie sahen sich selbst, in dieser betörenden Doppelgestalt, deren Unterscheidungsmerkmal noch keinem Mann bekannt war, sie sahen sich nicht zum ersten Mal auf diese Weise, und sie wussten, dass sie schön waren, schön jede einzelne für sich, aber alle Sinne verwirrend, wenn ihre Schönheit sich verdoppelte. Sanft strich Filomena über den Arm ihrer Schwester und fragte:
»Möchtest du jetzt ein Mann sein, meine geliebte Schwester? Oder ist es nicht vielleicht doch schöner, eine Frau zu sein?«
Beatrice lehnte ihren Kopf an denjenigen ihrer Schwester, ohne einen Blick von dem Spiegel zu wenden. Mit der Linken umfing sie ihre Hüfte und gestand:
»Wir wären undankbar, wenn wir das verleugneten.«
Lange standen sie so in das eigene Spiegelbild versunken, während sich ein erster Schatten auf der Wand des Palazzo zeigte. Schließlich drehte Filomena die Schwester sanft zu sich und gab ihr einen kaum merklichen Kuss auf die Lippen. Dann sagte sie:
»Und du wirst meinen Antrag beim Vater unterstützen? Denn was hätten wir von unserer Schönheit, wenn niemand sie sehen würde?«
»Die Schönheit auf den Markt tragen! Filomena, das ist doch gar zu vulgär! Doch so hast du es nicht gemeint. Ich weiß, wie du es gemeint hast. Aber der Vater, was der sagt, das weiß ich schon jetzt. Er würde die Brauen ziehen, würde erst dich und dann mich mustern und würde sagen: ›Beatrice, mein Kind, warum kannst du deine wilde Schwester nicht zähmen? Was wollt ihr denn auf dem Markt? Wollt ihr Mägde spielen? Alles wird doch besorgt und ist bereits im Haus. Was wollt ihr da auf dem Markt, Kinder?‹ Und dann würde er verschwinden und uns keine Antwort geben, vor allem aber würde er unsere eigene Antwort nicht abwarten; denn was wir wirklich auf dem Markt wollen, das weiß er, und das kann er uns nicht erlauben. Ach Filomena!«
»Ach Beatrice! Und so sind wir denn wieder nur auf unsere Bücher verwiesen, die uns ein Leben vorspiegeln, das wir selber nicht leben dürfen.«
»Aber dafür droht uns auch keine Gefahr von diesem sogenannten Leben.«
»Ängstigt dich diese Gefahr, mein Schatz?«
Beatrice seufzte tief. Sie hatte aus dem Boccaccio viele Geschichten gelesen, die ihr die Schamröte ins Gesicht getrieben hatten, und dann war sie froh gewesen über die Geborgenheit ihres Zimmers in der Via dei Servi, aus dem man fast gar nichts sah, nur die enge Straßenschlucht, die vom Dom zum Findelhaus führte. Aber hin und wieder kam ihr der Gedanke: Wenn diese Geschichten nun wahr wären, wenn sie sich ereignen könnten zwischen Ponte Vecchio und Piazza San Marco? Wenn sie selber dabei wäre, in einem Weinfass oder in einem Beichtstuhl, in einem Obstgarten oder in einer Wäschetruhe? Und dann hatte sie nicht schlafen können, hörte des Nachts den unruhigen Atem ihrer Schwester neben sich, wusste nicht, was richtig war und was falsch, was Tugend und was Sünde. Aber es war doch Literatur, und der Vater hatte sie empfohlen, an ihr sollten sie sich bilden. Mit der Zeit dämmerte es Beatrice, dass der Vater das Buch nie in den Händen gehabt haben konnte, sonst hätte er es seinen Töchtern nie ans Herz gelegt. Auf dem Scheiterhaufen der Eitelkeiten war es vor drei Monaten auch schon aufgeschichtet gewesen; also fand es auch die Billigung jenes Menschen nicht, vor dem sie eine solche Furcht und einen solchen Widerwillen hatte, wenngleich er es immer verstand, ihr Gewissen auf das Tiefste zu peinigen. Also, was sollte sie ihrer Schwester nun antworten? Sie entschied sich dafür, zu sagen, was ihr Herz fühlte.
»Sie ängstigt mich, Filomena, sie ängstigt mich so sehr, dass ich vor Schreck zusammenzucken würde, wenn das Leben nach mir griffe. Aber dann wieder finde ich diese Angst so süß und so verlockend, dass ich gar nicht abwarten kann, bis das Leben seinen Arm um meine Schultern legt. Das muss doch etwas sein, das Leben, wovon wir hier in unserem stillen Zimmer nicht einmal eine Ahnung haben.«
»Ich ahne es, Beatrice, und ich fühle es in allen meinen Adern! Es ist eine Sünde, dass man uns hier so einsperrt! Wir müssen hier heraus; denn das Leben kommt nicht zu uns in diesen dumpfen Käfig, wir selbst müssen zu ihm, wir müssen die Arme ausbreiten und sagen: ›Nimm mich, nimm mich ganz!‹ Ach Beatrice!«
»Ach Filomena!« Und Beatrice versuchte sich vorzustellen, wie es sein würde, wenn das Leben sie ganz, so ganz nehmen würde. Bei diesem Gedanken empfand sie eine verwirrende Unruhe in ihrem Schoß. An der gegenüberliegenden Wand stiegen die Schatten allmählich höher, als die beiden Mädchen wieder an das Fenster traten und auf die Straße hinunter blickten. Ein Dominikaner aus San Marco, die Kapuze weit über den Kopf gezogen, hastete lautlos in die Stadt hinein, vielleicht mit einem Auftrag an den Palazzo der Prioren, sonst war keine Menschenseele zu sehen. Schwer lastete der Sonntagnachmittag auf der Stadt. Er war träge und voller Langeweile, vielleicht konnte man in ihm auch schon die stumme Drohung des Sommers schmecken, der wieder nicht ohne neue Seuche abgehen würde. Dann müsste man wieder hinaus in die Villa auf dem Lande und auf die Kühle des Herbstes warten, während die armen Leute in den engen Borghi am Arno an den schwarzen Beulen erstickten. Filomena wollte daran nicht denken, jetzt war Mai, in einigen Monaten würden sie zwanzig Jahre alt werden, und bis dahin musste etwas geschehen. An die Verlobten dachte sie dabei im Traume nicht, eher im Gegenteil. Angestrengt suchte sie nach einer Idee, wie sie aus ihrem Gefängnis ausbrechen könnten. Dabei war es das angenehmste Gefängnis, das man sich für zwei junge Mädchen nur hätte ausdenken können. Der Palazzo Ricasoli war ein wunderbares und weitläufiges Haus, mit einer prächtigen Fassade zur Via dei Servi und einem schattigen Garten zur Via Larga hin. Wie viele Stunden hatten die Mädchen schon in diesem Garten zugebracht, über »das Leben« und »die Welt« phantasiert! Und wie besorgt war der Vater um seine beiden Juwelen, deren Wert er wohl zu schätzen und zu lieben wusste, weit mehr, als man es von Vätern seiner Generation erwarten durfte. Als sie aber aufwuchsen und in das »gefährliche Alter« kamen, wie man sich landläufig auszudrücken pflegte, war er bald mit seinem Latein am Ende, gab ihnen zu lesen, was seine Freunde ihm empfahlen, suchte einen Lehrer für sie, der für einen der glänzendsten Köpfe der Stadt galt, war zwei Verlobten nicht abgeneigt, die aus den besten Familien stammten, und hatte doch immer das unbestimmte Gefühl, dass er ihnen nicht geben konnte, was sie eigentlich verlangten und was ihnen nottat. Filomena, die ihren Vater ebenso liebte, wie es ihre Schwester tat, hätte also eigentlich keinen Grund gehabt, über Ausbruchspläne nachzudenken. Aber die Liebe zum Vater war eins, ein anderes war der Aufruhr in ihrer Brust. Jetzt musste es sein, jetzt oder nie! Sie musste ein Wagnis ausdenken für sich und die zaghafte Schwester zugleich, die für sich alleine diesen Schritt niemals wagen würde.
»Beatrice«, sagte sie, indem sie das gewaltige Kleeblatt des Domchors zu erblicken suchte, in welcher Richtung der weiße Mönch verschwand, »meine Schwester, ich weiß, was du denkst; denn ich denke es auch. Du denkst: ›Wenn diese Geschichten einmal wahr werden könnten, nur ein einziges Mal, und wenn wir mitten in ihnen steckten?‹ Nicht wahr, das denkst du?«
Beatrice schmiegte den Kopf an die Schulter der Schwester und nickte mit dem Kopf, so dass diese es wohl vernehmen konnte. Aber sie sagte kein Wort, dessen bedurfte es nicht; denn sie verstanden sich auch so. Außerdem wollte sie nicht etwas aussprechen, das zwiespältige Gefühle in ihr auslöste. Über die Straße fuhr ein kleiner Karren mit einem Esel davor, wohl ein Bauer, der durch die Porta San Gallo oder die Porta Pinti wieder nach Hause wollte. Die Sonne stand nur noch auf den höchsten Fenstern der Häuser. Filomena sah dem Karren nach, der die Straßenkreuzung erreicht hatte und sich nun entscheiden musste: Wollte er nach Fiesole oder Settignano? Als er nach links in Richtung San Marco abbog, sagte sie:
»Also, wir erfinden ein Spiel, und wenn es gelingt, sind wir mitten in der Welt unserer Träume. Es baut darauf auf, dass wir beide uns so ganz ähnlich sind, in Wesen, Aussehen, Charakter, und vielleicht sind wir uns auch darin ein bisschen ähnlich, dass wir vor den jungen Männern für schön gelten. Was denkst du?«
»Ich denke, dass dies erst der Anfang ist. Wie aber soll das Spiel vor sich gehen?«
»Sind wir uns denn so ganz ähnlich? Gleichen wir uns denn wie ein Haar dem anderen?«
Beatrice errötete ein wenig ob der Frage und erwiderte nichts. Vielmehr erinnerte sie sich der unschuldigen Spiele ihrer frühen Kindheit. Filomena fuhr fort:
»Und da setzt unser Spiel an. Wir suchen irgendeinen jungen Tölpel wie aus dem Decamerone, und dem sagen wir: Finde heraus, worin wir uns unterscheiden, und dann ....«
Hier wusste sie nicht weiter. Beatrice war warm geworden, hatte aber auch noch keine Lösung.
»Und dann, Filomena? Was dann? Nur, dass er das herausgefunden hat, das bedeutet noch nichts. Aber wie sollte er es auch herausfinden, bevor er das erhält, was erst nach deinem ›und dann‹ kommt? Im Vorhinein werden wir doch nicht zahlen, oder?« Im selben Augenblick schämte sie sich über ihre Ausdrucksweise.
»Wer spricht von ›zahlen‹, mein Schatz? Wir werden gar nicht zahlen. Er wird zahlen, und wenn er nicht zahlt, so hat er das Nachsehen.«
»Aber so wird das nie ein Spiel.«
Beide wussten nicht weiter, am wenigsten die wagemutige Filomena, die ihren Gedanken hatte schießen lassen, ohne zu bedenken, welches Ziel er erreichen sollte. So schauten sie wieder hinaus auf die Straße, die nun im tiefen Schatten lag. Könnte er nicht dort erscheinen und ihnen die Sache erleichtern? Ein Jüngling, ein wahrhafter Jüngling, das wäre doch etwas anderes als ein halb zu Ende gedachter Gedanke. Also war es unvermeidlich, dass er erschien.
Lodovico war schon seit dem Morgen unterwegs. Zehn Meilen hatte er zurückgelegt, um dieses Wunder des Erdkreises zu erreichen, die Stadt aller Städte. Wen er suchen sollte, das wusste er wohl, aber wie ihn finden in dieser großen Stadt, das wusste er nicht. Als er an der Porta al Prato seine Legitimation vorweisen musste, zeigten die Sbirren nur auf die alles überragende Kuppel des Domes und sagten: »Von da nach links!«, mehr wusste er nicht. Also hielt er unmittelbar auf die Kuppel zu, überquerte eine große Piazza mit einer herrlichen Klosterkirche an ihrer Nordseite, das musste sie sein, die Kirche, in welcher der angebetete Meister wirkte, hielt sich nach links, stieß abermals auf eine Kuppelkirche, die aber nicht der Dom sein konnte, irrlichterte durch das Gewirr der Gassen, ging vor, ging zurück, ohne etwas zu finden, so dass er schließlich dachte: ›Warum hast du nur dein Prato verlassen? Was willst du hier in diesem unsäglichen Gewirr? Niemals wirst du dich hier zurechtfinden.‹ Schließlich, als er großen Hunger und noch größeren Durst verspürte an diesem heißen Sonntagnachmittag im Mai, stand er dennoch auf einer Piazza, von der er sich niemals hätte träumen lassen. Instinktiv ging die Hand nach seinem Stift, um das zu zeichnen, was das Auge sah und der Verstand nicht begriff. Ein herrlicher, achteckiger Zentralbau, das Baptisterium, mit schwarz-weißer Inkrustation bis unter das Dach und hell schimmernden Bronzetüren, dahinter der mächtige Dom mit dem fünfgeschossigen Campanile zur Rechten, in dem sich die alte und die neue Zeit auf eine wundersame Weise begegneten, der tief gestaffelten Westfassade zur Linken, und dahinter, alles überragend, alles übertönend, die majestätischste Kuppel, die auf Gottes Erdkreis zu sehen war, mit dem Dekor der Wände wie am Baptisterium, darüber die acht mächtigen Rippen des Kuppelgewölbes mit dem Terracotta-Belag aus Siena als Füllung, und über allem thronend die göttliche Laterne mit dem goldenen Apfel und dem Kreuz: Santa Maria del Fiore. Lodovico war noch nie in Byzanz und noch nie in Rom gewesen, aber von einem Augenblick auf den anderen ward ihm eins zur unmittelbaren Gewissheit: Hier lag der Mittelpunkt der Welt! Wo anders könnte es Schöneres geben? Die fortgeschrittene Zeit des Tages verbot es ihm, seinen Stift zu gebrauchen; denn er musste noch zum Kloster San Marco, musste den Vetter finden, der ihm seine Kammer anweisen sollte. »Vom Dom nach links.« Zaghaft umschritt er den mächtigen Bau und bog schließlich in Höhe der Chorkuppeln in eine Straße ein, ein Schild nannte ihm ihren Namen: Via dei Servi. Die Straßenschlucht war eng, die Sonne stand nur noch auf den höchsten Zinnen der Palazzi. Aber er musste San Marco finden und Federigo, der mit seinem Ordensnamen Fra Bartolommeo hieß, das musste er an der Pforte sagen; denn einen Federigo della Scala würde dort wohl niemand kennen. Unsicher blickte er an den Fassaden der herrschaftlichen Häuser hinauf. Auch in Prato gab es Palazzi, aber das hier überstieg alles Vorstellbare. Stein auf Stein in Ebenmaß gehauen, eine Fassade an der anderen, und doch jede eine Individualität für sich selbst, in Höhe und Ausdehnung. Wenn man den Blick nach vorne richtete, so hatte man einen unmittelbaren Eindruck vom Phänomen der Zentralperspektive; denn dort hinten öffnete sich unfehlbar eine Piazza, und die Fassadenbänder strebten darauf zu, als seien sie vom Altmeister Brunelleschi selbst gezeichnet worden. Wieder ging die Hand nach dem Stift, doch da bemerkte Lodovico plötzlich, wie er aus einem Fenster des ersten Stocks beobachtet wurde. Zwei junge Gesichter, die sich schnell zurückzogen, als er sie bemerkte, so dass die rotblonden Haare flogen, zwei junge Gesichter wie in eins. Lange schaute Lodovico in das offene Fenster hinein, aber seine Frage blieb unbeantwortet. So ging er denn weiter. Über eine Straßenkreuzung erreichte er eine stille Piazza, die ihn faszinierte. Kein Mensch dort an diesem Spätnachmittag im Mai. Stattdessen drei wunderbare Gebäude, die den Platz auf drei Seiten umschlossen. Gerne hätte er sich dem Studium der offenen Loggien mit den eingelassenen Medaillons hingegeben, aber dafür war jetzt keine Zeit; denn er war noch nicht am Ziel. Die Mönche, die aus dem linken Kirchengebäude traten, trugen nicht das weiße Ordensgewand der Dominikaner, sondern ein schwarzes, und also stand er nicht vor San Marco. Zudem schien es, als sollte er hier nicht weiterkommen. Also entschloss er sicht, kehrt zu machen und auf dem Domplatz noch einmal nach dem Weg zu fragen.
So weit musste er nicht gehen; denn als er wieder an dem Palazzo mit dem offenen Fenster vorbeikam, standen die beiden Mädchen in der Fensteröffnung und schauten auf ihn herab. Ehrfürchtig zog er den Hut und grüßte schüchtern nach oben. Obwohl die beiden Gesichter im Schatten lagen, konnte Lodovico doch erkennen, dass sie von ebenmäßiger Schönheit waren und sich zudem zum Verwechseln glichen. Er war verwirrt und empfand ein stechendes Gefühl zwischen Herz und Hals. Der Durst hatte ihm die Kehle ausgetrocknet, so dass er kaum ein Wort herausbringen würde; dennoch entschloss er sich, die beiden Mädchen nach dem Weg zu fragen.
»Gott zum Gruße, meine gnädigen Fräulein. Darf ich Euch wohl um etwas bitten?«
Die beiden schauten sich an, dann beugte sich die eine ein wenig hervor und rief mit leicht erhobener Stimme:
»Aber was ist das denn für ein Benehmen, mein Herr, so mir nichts dir nichts zwei Damen anzureden, die von ungefähr am Fenster stehen? Ihr seid wohl nicht von hier und kennt nicht die Sitten dieser Stadt? Woher kommt Ihr denn und wohin wollt Ihr, da Ihr nur die Straße herauf- und herablauft?«
Lodovico war verblüfft. Das Mädchen, das wenig jünger als er selbst sein mochte, brachte seine Vorwürfe in einem Tone vor, der das genaue Gegenteil eines Vorwurfs zu sein schien, ihre Worte klangen eher wie die Einladung, nur ja mit seiner Anrede fortzufahren. Jetzt war auch wieder das Gesicht ihrer Schwester neben ihr, und obwohl Lodovico nicht sagen konnte, worin er bestand, nahm er doch sofort einen Unterschied zwischen den beiden war. In einem Bildnis müsste man das ausdrücken können, was ein unschuldiges Auge nicht sehen und nur das Auge eines Malers entdecken konnte. Er nahm die Ermutigung auf und entgegnete:
»Das ist mir ja eine schöne Verdrehung der Sitten, mein Fräulein! Ich dachte immer, es sei unschicklich für zwei junge Damen, am Fenster zu stehen und die Straße zu beobachten. So zumindest gilt es bei uns in Prato. Nun belehrt Ihr mich eines Besseren, und ich begreife: Nicht das ist unschicklich, sondern unschicklich ist es, zwei junge Damen im offenen Fenster zu betreffen. Meint Ihr es so?«
Filomena in ihrem wachen Sinn begriff sofort den Spott in dieser Erwiderung, aber sie nahm auch mit erschrecktem Erstaunen wahr, dass dieser junge Mensch auf eine Weise zu spotten verstand, die ihr unter die Haut ging. Sie wandte sich zu ihrer Schwester, und beide lachten Lodovico an.
»Ihr seid nicht auf den Mund gefallen, mein Herr, und soeben haben meine Schwester und ich beschlossen, Euch die Konversation mit uns zu erlauben.«
Lodovico, der längst Hunger und Durst vergessen hatte, grüßte mit gespielter Dankbarkeit nach oben.
»Aber sagt, Ihr kommt aus Prato?«
»Ich bin seit heute Morgen unterwegs.«
»Und was sucht Ihr hier in dieser Stadt?«
»Das Kloster San Marco; denn dort wartet mein Vetter auf mich, um mich unterzubringen.«
»Ein Mönch mit einer so kecken Sprache und ohne Ordensgewand?«
»Aber nein, mein Fräulein, mein Vetter ist Mönch dort, ich aber bin Maler und soll zu dem großen Botticelli in die Werkstatt. Bis ich dort unterkomme, kann ich im Kloster wohnen.«
Wieder schaute Filomena die Schwester bedeutungsvoll an, als wollte sie sagen: ›Das ist ja gleich um die Ecke!‹, und wandte sich dann wieder Lodovico zu:
»Aber warum kommt Ihr dann die Straße wieder zurück, wenn Ihr doch schon da wart?«
Er begriff nicht gleich.
»Ich war auf der Piazza dort. Aber dort war nicht San Marco, und weiter schien es nicht zu gehen.«
Filomena lachte.
»So schnell gebt Ihr auf, junger Mann, und geht der Sache nicht auf den Grund? Schaut nicht selber nach, ob es nicht doch weiter geht? Es geht öfter weiter, als man es denkt, wisst Ihr.«
»Und dort wäre es weiter gegangen?«
»Ja, dort auch. Nur einmal quer über den Platz der Allerheiligsten Verkündigung, dann nach links und wieder nach rechts, und Ihr seid bei den Dominikanern.«
»Verbindlichen Dank, mein Fräulein.« Er zog seinen Hut und hätte jetzt eigentlich wieder kehrt machen können. Das wäre aber schade gewesen; denn ein bisschen wollte er diese Begegnung noch ausdehnen. Das Gefühl zwischen Herz und Hals war mittlerweile ein wenig tiefer gerutscht, ohne dabei an Intensität verloren zu haben. Im Augenblick fiel ihm aber nichts Gescheites ein, und so stand er da auf der Straße mit dem Hut in der Hand, schaute nach oben und sagte nichts. Das zweite Mädchen kam ihm zu Hilfe, indem sie nach einer Weile fragte:
»Ihr seid Maler?«
»Wie mein Vater, mein Fräulein. Bei ihm habe ich gelernt, und nun soll ich hier in Florenz in der Werkstatt des großen Meisters arbeiten.«
»Wie heißt Ihr? Was könnt Ihr? Könnt Ihr freskieren?«
»Freskieren, die Tafeln bemalen, sie zurichten und Farben mischen, was Ihr wollt. Auch in Email habe ich mich schon versucht. Mein Name ist Lodovico, Lodovico Lotti aus Prato.«
»Nun, der Vater braucht dringend einen Fresco-Maler für die Sala. Denn dort geht es nicht weiter. Kommt morgen vorbei und lasst es Euch zeigen.«
Lodovico war hoch erfreut und dachte: ›Den beiden scheint die Sache auch nicht unangenehm zu sein. Da lässt sich doch vielleicht noch etwas machen. Allerdings, sie sind adelige Fräulein, da darf ich mir nicht zu viel versprechen.‹ Laut sagte er:
»Euer Ansinnen ehrt mich, mein Fräulein, aber wie Ihr nun wisst, bin ich ja mit einem Auftrag nach Florenz gekommen. Den muss ich erfüllen, ich werde morgen in der Werkstatt erwartet. Doch wenn es noch ein paar Tage Zeit hat ...«
»Auf nächsten Sonntag also! Und bis dahin nehmt Ihr immer den Weg durch diese Straße, obgleich man über die Via Larga besser nach San Marco kommt. Dann können wir besprechen, wie es weiter geht.«
Lodovico dachte: ›Wollen sie denn die ganze Woche hier im Fenster hängen und auf den armen Maler warten? Da müssen sie aber wirklich Not leiden. Also gut, sei nicht blöde, mein Junge, und lass’ dich darauf ein. Du kannst ja immer noch sehen, wie es geht.‹ Wieder sann er über den Unterschied zwischen den beiden Schwestern nach, kam aber zu keinem Ergebnis. Er versprach zu tun, wie die Mädchen ihn geheißen, und fragte nur noch nach dem Namen des Palazzo.
»Dies ist der Palazzo Ricasoli, er trägt den Namen unserer Familie. Der Vater ist der Barone Bettino, dies ist meine Schwester, und dies bin ich.«
»Ohne Namen, wie ich vermute.«
»Ohne Namen zunächst für Euch, mein Herr, das Weitere wird sich finden. Auch dies werden wir Euch erklären im Laufe der Woche.«
»Gibt es darum ein Geheimnis, Baronessa?« Lodovico spielte tiefste Besorgnis.
»Addio, Signor Lodovico. Bis auf morgen. Nun geht zu Eurem Vetter, bevor Ihr vor lauter Dunkelheit den Weg nicht mehr findet und auf ewig dazu verdammt werdet, in der Via dei Servi auf- und abzuschreiten.«
Damit schloss Filomena die beiden Flügel des Fensters, so dass ihm nichts anderes übrig blieb, als erneut sein Glück auf der Piazza Santissima Annunziata zu versuchen. Kaum waren die beiden Mädchen verschwunden, meldete sich auch wieder sein Körper und verlangte unbändig nach Speise und Trank.
Filomena stand mit dem Rücken zum Fenster und beobachtete, wie Beatrice eine Kerze anzündete.
»Was sagst du, mein Schatz? Ist das nicht ein Zufall? Wie gefällt er dir?«
»Er ist ein wenig keck, und seine Augen beobachten scharf. Diese Augen, so ein wenig zwischen Traum und Wirklichkeit. Aber ein Träumer ist er beileibe nicht und auch kein Tölpel, wie du ihn dir vorstelltest. Zwischen seinen Augen und seinen Händen ist etwas wie eine Spannung. Ich glaube, es ist ein gar kurzer Weg zwischen seinen Augen und seinen Händen. Ich will dir noch etwas sagen.«
»Nun?«
»Mit ihm ist nicht gut spielen. Da könnten wir leicht ins Hintertreffen geraten.«
»Pah!« Dieser Aufruf hatte viel Nachdruck und wenig Überzeugungskraft. Filomena konnte nicht umhin, sie musste die Beobachtungen ihrer Schwester bestätigen, und was schlimmer war: Sie konnte sich der verwirrenden Vorstellung nicht entziehen, dass vieles geschehen könnte auf diesem kurzen Weg zwischen seinen Augen und seinen Händen. Sie befand sich in einer seltsamen Aufregung, wovon ihr tiefer Atem Kundschaft gab, infolgedessen sich ihr Busen merklich hob und senkte. Aber von der Natur war ihr eine Gabe geschenkt, um sich aus solchen Lagen zu befreien: der Mutwille.
»Er wird mitspielen bei unserem Spiel, und wenn er kein Tölpel ist, so macht das Spiel noch dreimal so viel Spaß. Er wird mitspielen, das wollen wir doch einmal sehen!«
»Aber die Regeln! Wir waren doch noch gar nicht im Reinen mit den Regeln! Wir sind uns so ähnlich vor aller Welt, und wieder sind wir uns nicht ähnlich, aber das wissen nur wir und vielleicht die Giannetta. So, und weiter waren wir noch nicht. Wie wollen wir jetzt diesen Lodovico da in das Spiel bringen?«
»Mit seinen wachen Augen.«
»Und seinen flinken Händen.«
»Aber bei diesem Spiel nützen ihm die ersten so wenig wie die zweiten.«
Beatrice war da nicht mehr so sicher, aber sie ließ die Schwester reden.
»Bea, mein Gedanke geht so: Wir setzen den Ferragosto zum Termin. Bis dahin muss er herausfinden, worin wir uns unterscheiden. Wenn er es nicht kann, dann ...«
»Nun?«
Filomena überlegte einen Augenblick.
»Er ist Maler. Dann muss er ein Bild von uns malen, eins von dir und eins von mir, aber mindestens sechs Fuß auf zehn, und die kommen dann ins Treppenhaus, und wenn er begabt ist, werden alle Gäste staunen.«
»Ja, aber wenn er so begabt ist, dass er gewinnt, was dann?«
»Wie sollte er gewinnen? Er wird nicht gewinnen.«
»Nein, wird er nicht. Aber die Regeln müssen vollständig sein, also müssen wir sie aufstellen. Was dann?«
Jetzt brauchte Filomena etwas länger, um auf einen Gedanken zu kommen. Sie drehte sich zum Fenster und schaute auf die Straße. Dort sah sie, wie der Vater auf seinem Pferd herbeigeritten kam, sicher wieder von der Porta San Gallo. Gostanzo, ihr Reitknecht, folgte dicht hinter ihm. Gutheißen konnte sie das nicht, aber verurteilen konnte sie ihn auch nicht. Hier im Hause fehlte ihm, was ein Mann so dringend brauchte, das wusste sie aus dem Boccaccio, und das Haus an der Porta San Gallo besaß einen guten Ruf, den besten in der Stadt. Als der Vater und Gostanzo in den Hof ritten, drehte sie sich um zu ihrer Schwester und sagte mit Nachdruck:
»Er wird nicht gewinnen, er wird nie gewinnen, aber wenn er doch gewinnen sollte – weil du ja eine Vollständigkeit der Regeln verlangst – , dann laden wir ihn ein zu einem Urlaub auf dem Lande. Was hältst du davon?«
»Fila, das ist eine wunderbare Idee, und wenn wir denn zahlen müssen, dann brauchen wir gar nicht so viel zu zahlen, wie ich fürchtete, er aber wird es zu schätzen wissen, mit der Baronessa Filomena ...«
»... und mit der Baronessa Beatrice ...»
»... auf einem bequemen Landgut den Spätsommer zu verbringen. Glaubst du, dass der Vater das erlauben wird?«
»Großer Gott, Bea, wir haben etwas vergessen!«
»Anichino und Calandrino! Wie konnten wir das übersehen? Der Vater wird es nie erlauben. Diese beiden will er dort sehen, nicht einen Lodovico, einen Maler, der im Kloster schläft.«
»Aber unser Spiel ist doch so reizvoll. Möchtest du jetzt darauf verzichten?«
»Nein, Fila, ich möchte nicht. Wir spielen es, Vater hin, Vater her.«
»Denn der erlaubt sich schließlich auch gewisse Freiheiten. Soeben kam er wieder von der Porta San Gallo. Ich habe ihn gesehen mit Gostanzo.«
»Na also! Das gibt uns jedes Recht. Aber wir müssen es ihm ja gar nicht sagen; denn wir werden ja nicht verlieren, meine liebe Schwester, da sind wir uns doch ganz sicher, nicht wahr?«
Ganz sicher. Ganz sicher. Filomena wäre es fast lieber gewesen, sie würde das Spiel verlieren, so hoffnungslos verlieren, dass sie sich überlegen müsste, wie sie diesen jungen Menschen über die Wochen des Spätsommers unterhalten könnte. Und nun wollte sie sich fast gar nicht mehr vorstellen, dass sie beide hier gefangen waren, gefangen in einem goldenen Käfig und nicht hinaus konnten in die geheimnisvolle Stadt, die auf einmal so viele Verlockungen bot. Würde er wohl diesmal den Weg finden, dieser wunderliche, herrliche Tunichtgut mit dem altertümlichen Malerhut auf dem Kopf? Oder würde er gleich wieder die Straße zurückkommen? Dann müsste er aber herauf, in ihr Zimmer, sonst wäre er ja verloren da draußen. Er war diese große Stadt einfach nicht gewohnt, man musste ihn bewahren vor ihr, musste ihn einfach bei der Hand nehmen und sagen: ›Die Welt da draußen ist nichts für dich. Dort rennst du nur vergeblich durch die Straßen. Bleibe hier, bei mir, dann musst du nicht mehr suchen, und auch ich hätte ausgesucht.‹ Filomena seufzte tief, während sie sich vorstellte, wie es wäre, wenn er tatsächlich hier oben wäre, im Dämmerschein der Kerze, in dem ihre Schwester langsam zu einem unsichtbaren Nichts zergehen würde, wenn er hier bei ihr wäre, wenn er seinen Hut auf das Sofa legte und wenn er seine Hände wie zu einer Frage öffnete. Sie würde seinen Kopf umfangen und an ihre Brust pressen. Sie würde seinen Atem spüren, und dann würde er seine Hände auf die Wanderschaft gehen lassen, diese wunderbaren Malerhände, welche zu dem zartesten Strich fähig waren, dann würde er entdecken, worin sie sich von ihrer Schwester unterschied, würde Filomena entdecken, nur Filomena, die einzigartige Filomena, würde sie entdecken, würde sie nehmen, würde, würde, würde. Mit einer Heftigkeit, die Beatrice überraschte, wandte Filomena sich um und schaute auf die Straße. Sie war menschenleer und in tiefem Schatten. Nicht einmal ein Diener der Maria huschte vom Kloster zum Dom. Jetzt fiel die Dunkelheit schnell über die Stadt herein. Also hatte er gefunden, was er suchte. Und nun würden ihm die Hunde des Herrn diese Gedanken austreiben, diese Gedanken, die doch nur deine waren, arme Filomena, arme, reiche Filomena mit deiner Jugend und deiner ungestillten Sehnsucht. Aber sie würden es wohl nicht vollbringen; denn auch er war jung, auch er dachte solche Gedanken, auch er würde gerne seine Hände auf die Wanderschaft schicken. Doch er kannte dich ja noch gar nicht, Filomena. Du warst ihm eins mit deiner Schwester, wie konnte er da wissen, wo er suchen sollte, wen er suchen sollte? Auf der Straße war er jedenfalls nicht zu finden, und so drehte sich Filomena wieder um und fand das Gesicht ihrer Schwester im Schein der Kerze.
»Du bist mir noch eine Antwort schuldig, Fila.«
Filomena nickte und sagte:
»Lies mir doch noch einmal vor, was der Boccaccio über das Los der Mädchen schreibt.«
Beatrice war ein wenig verwundert und blickte die Schwester prüfend an. Dann ging sie zu dem kleinen Tisch, auf dem immer das Decamerone lag, schlug ohne langes Suchen die ersten Seiten auf und las:
Und obgleich das, was ich beitrage, um die Bedürftigen aufzuheitern oder zu trösten, wie wir es nennen wollen, nicht viel bedeuten will und kann, so bedünkt mich doch, man müsse es da am liebsten darbieten, wo die Not am größten ist, weil es dort am meisten Nutzen stiften und auch am wertesten gehalten werden wird.
Und wer wird wohl leugnen, dass es richtiger ist, diesen Trost, wie wenig oder wie viel er bedeuten mag, den holden Damen als den Männern zu spenden? Sie tragen voll Furcht und Scham die Liebesflammen im zarten Busen verborgen, und wie viel größere Gewalt geheime Gluten haben als offenbare, das wissen die, welche es erfahren. Überdies sind die Frauen, abhängig von Willen, Gefallen und Befehl ihrer Väter, Mütter, Brüder und Gatten, die meiste Zeit auf den kleinen Bezirk ihrer Gemächer beschränkt, und es ist unmöglich, dass sie immer heiter sein können, während sie den ganzen Tag fast müßig sitzen und im selben Augenblick, wollend und nicht wollend, widerstreitende Gedanken in sich beherbergen.
Entsteht nun in ihrem Gemüt aus den feurigen Wünschen des Herzens eine gewisse Schwermut, so muss diese zu ihrer großen Qual so lange darin verweilen, bis neue Gespräche sie wieder vertreiben, wobei ich noch nicht einmal erwähne, dass die Frauen weit weniger Kraft als die Männer haben, um das zu ertragen, was ihnen widerfährt.
»Das ist noch nicht ausgemacht!« rief Filomena unvermittelt.
»Was denn, meine liebe Schwester?«
»Dass wir Frauen weniger Kraft als die Männer haben. Das wollen wir ihnen doch einmal zeigen. Wir verlieren nicht, Bea, wir verlieren niemals! Jedenfalls nicht in diesem Spiel. Nicht gegen den Vater und nicht gegen den Maler. Allerdings ...«
»Allerdings«, ergänzte Beatrice, »müssen wir sowohl den einen als auch den anderen erst einmal in das Spiel hineinziehen.«
»Allerdings«, bestätigte Filomena. »Aber mit dem Vater fangen wir noch heute Abend an. Und mit dem Maler geht es morgen weiter. Er hat versprochen, jeden Tag durch unsere Straße zu gehen, also wird es nicht schwer sein, ihn anzusprechen.«
»Willst du den ganzen Tag Wache halten am Fenster?«
Filomena hätte schon den Wunsch gehabt, sie wäre sogar auf die Straße gelaufen, um zu rufen: ›Er kommt!‹, aber das ging natürlich nicht. Dann hatte sie eine Idee.
»Weißt du, morgens ist es zu früh. Da liegen wir noch im Bett, wenn er vorbeigeht. Aber abends, vielleicht um die sechste Stunde, dann beziehen wir unseren Posten, einmal die eine und dann die andere, und er wird auch wohl warten, wenn er das Fenster offen, aber keine von uns darinnen sieht. Was denkst du?«
In stiller Zustimmung umarmte Beatrice ihre Schwester, und so verließen sie ihr Zimmer, um dem Vater beim Abendessen die glückliche Botschaft verkünden zu können, dass ein Maler für das Fresko in der Sala gefunden war.
Zweites Kapitel
Lodovico war es peinlich, zur Unzeit an der Pforte vorgesprochen zu haben. Was wusste er von den Stundengebeten und dem Lebensrhythmus in einem Kloster? Der Bruder Pförtner hatte ihn geheißen, hier in der kleinen Halle zu warten, welche zwischen Klosterkirche, Pilgerherberge und Kreuzgang eingeklemmt war, bis das Vespergebet zu Ende sei. Vorher sei niemand zu sprechen, aber der Bruder Bartolommeo habe seinen Namen hinterlassen, sicherlich werde er nach ihm fragen, wenn er aus der Kirche komme. In die Klausur durfte er nicht hinein, aber aus der Halle konnte er einen Blick in die Arkaden des Kreuzgangs werfen, die sich Joch für Joch in klassischer Reinheit entwickelten. Lodovico begriff, dass die unbedingte Klarheit dieser Architektur nicht ohne Einfluss auf das Leben und Denken der Mönche bleiben konnte, und deutlich empfand er die Schönheit und den ruhigen Rhythmus des Gleichmaßes. Nun vermochte er zu begreifen, warum Federigo ins Kloster gegangen war, etwas, was er bisher nie verstanden hatte. Federigo, dieser Feuerkopf mit seinen hochfliegenden Plänen und seiner unbezähmbaren Leidenschaft. Federigo, der ein viel größerer Maler war als er selbst, dem es gegeben war, eine Madonna zu malen, dass ein junger Mensch sich unsterblich in sie verlieben musste bis an sein Lebensende. Federigo, der leider immer wieder und zuletzt auf eine skandalöse Art seine brennenden Träume mit der Wirklichkeit verwechselt hatte und tief schuldig geworden war. Vielleicht konnte er hier, an diesem Ort der Stille und der Regel, seine Sünde büßen und seine Ruhe finden. Lodovico wünschte dies inständig, noch inständiger aber wünschte er, dass der Vetter nun bald käme und sich um sein leibliches Wohl sorgte. Endlich wollte ihm scheinen, dass die Mönche beim Magnificat angekommen waren, so dass es nicht mehr lange dauern konnte. Seine Füße taten ihm weh, der Durst brannte, und der Hunger fraß ein Loch in seinen Leib. Es blieb ihm kaum noch die Kraft Für eine Erinnerung an die Begegnung in der Via dei Servi.
Endlich konnte er von seiner Bank in der kleinen Halle sehen, wie die Mönche aus der Kirche in den Kreuzgang strömten und sich in den Waschraum begaben, bevor sie zum Refektorium weitergingen. Schließlich kam auch Federigo, und er spähte den Kreuzgang hinab in die Halle, in der Lodovico auf ihn wartete. Ob er ihn sehen konnte bei diesem Licht, das wusste Lodovico nicht, aber Federigo hielt auf ihn zu und befahl dem Bruder Pförtner, die Gittertür zwischen dem Kreuzgang und der Halle zu öffnen. Dann lagen sie sich in den Armen, ohne Rücksicht auf ihren Stand und auf den Ort.
»Lodovico, du hast uns gefunden, du bist hier, bist in der großen Stadt, bist bei uns in San Marco. Der Herr segne dich, und er lasse jeden deiner Schritte wohl gelingen.«
»Amen«, sagte Lodovico. »Aber mein nächster Schritt wird unweigerlich in meinen Untergang führen, wenn ich nicht auf der Stelle etwas zu essen und zu trinken bekomme.«
Federigo schaute ihn an mit diesem Blick, den Lodovico an ihm fürchtete und den er zugleich bewunderte. Es war der Blick des Malers, der sein Modell durchdrang, damit er es auf die Holztafel bannen könne, dieser Blick, dem nichts verborgen blieb und in dem viel Gewalttätiges lag, ein Blick, dem niemand sich entziehen konnte. Die Menschen reagierten unterschiedlich auf diesen Blick. Manche verspürten Angst; manche fühlten sich in ihrer Seele ausgefunden; die Frauen, namentlich jene, welche ihm für seine Madonnenbilder gesessen hatten, verehrten diesen Blick in kaum gezügelter Leidenschaft, weil er ihnen so weh und so wohl tat. Mit Erschrecken nahm Lodovico wahr, dass dies auch der Blick des Inquisitors war, und voll banger Furcht fragte er sich, was in diesen zwei Jahren wohl aus Federigo geworden sein mochte. Dieser schaute ihn an und sagte mit einem spöttischen Lächeln:
»Nun, mein Herr Vetter, und bist du noch ein solcher Knecht des lieben Fleisches? Hast du keine Kraft, ihm zu widerstehen und zu sagen: ›Sei du stille! Ich gebiete über dich und nicht du über mich!‹?«
»Nein, die habe ich nicht, ich bin zwölf Stunden auf der Landstraße gewesen, und jetzt ist es genug. Wenn ihr nicht einen Patienten mehr auf der Krankenstube haben wollt, dann gib mir jetzt zu essen und zu trinken.«
Federigo sagte:
»Nun, dann komm, aber erwarte nicht die Festgelage der Hoffärtigen. Bedenke, dass du in einem Kloster bist und bei einem Bettelorden.«
Damit schob er Lodovico durch die Gittertür in den Kreuzgang, und dieser dachte: ›Jetzt bin ich in der Klausur. Herr im Himmel, darf ich denn hier überhaupt hinein?‹ Federigo fand nichts dabei und schärfte ihm ein, im Waschraum genau das zu tun, was auch er tat. So wusch denn Lodovico erst die Hände, dann das Gesicht, indem er murmelte wie der Vetter:
»Herr, nimm mich auf in den Kreis derer, die nicht würdig sind, das Brot zu brechen. Nimm mich auf und gedenke nicht der Sünden, die mir folgen. Und wie es dürstet der Hindin nach den versiegten Wassern, so dürstet meine Seele, o Gott, nach dir.«
Dies war wahrlich ein Spruch, der ihm aus dem Herzen kam. Als sie sich die Hände getrocknet hatten, führte ihn Federigo durch das Große Refektorium, nicht ohne dass sie die Aufmerksamkeit der Mitbrüder erregten, und sie setzten sich auf eine Bank in der tiefsten Ecke des Speisesaals. Ein Mönch kam und setzte ihnen eine Kanne Wasser vor, dazu einen Teller mit Brot und eine Schale mit Früchten. Als Federigo den Bruder eindringlich fordernd anschaute, ging dieser und kam alsbald mit einer weiteren Kanne, deren Inhalt auffallend einem Vernaccia glich. Ein zweiter brachte eine Platte mit Käse und kaltem Fleisch.
»Für den Bruder Pilger, dass er zu Kräften komme nach seiner langen Wegfahrt.«
Federigo nickte, und Lodovico kannte nun kein Halten mehr, während sein Vetter außer einem Glase Wasser nichts anrührte. Der Tagliello war herrlich und das zarte Kalb nicht minder, dazu der Vernaccia aus San Gimigniano, Lodovico konnte sich wohl vorstellen, dass im Kloster ein Auskommen war. Federigo beobachtete den Vetter ausgiebig während des Essens. Schließlich war dieser gesättigt und gestand:
»Das hätte ich nicht erwartet hier bei euch, bei den Dominikanern. Das ist ja köstlich und dazu angetan, Leib und Seele wieder zusammenzukitten.«
»Es war für dich, wie für alle die Pilger, die hierher zu uns kommen. Doch wenn sie bleiben wollen, dann freilich gilt eine andere Regel. Aber du willst ja nicht bleiben, du willst dir eine andere Herberge suchen, du bist bestellt zu dem großen Meister, den auch ich verehre, also genieße die mäßigen Freuden, die San Marco dir für kurze Zeit zu bieten hat.«
Lodovico nahm mit Erstaunen wahr, dass man sich nicht nur an ihrem Tische unterhielt, sondern dass die Mönche sich insgesamt in angeregten Gesprächen mit ihrer Umgebung befanden, ohne dass freilich ein einziges lautes Wort fiel. Hier wurde verhandelt, hier wurden Gedanken ausgetauscht, vielleicht wurde hier auch über das Schicksal der Stadt gesprochen. Er nahm noch ein weiteres Glas von dem Vernaccia und bat den Vetter:
»Federigo, erkläre mir, in Florenz soll jetzt alles anders sein seit drei Jahren. Nicht mehr die Freiheit der Kunst und der Rede, nicht mehr das Ansehen der Natur als Gebieterin von uns allen.«
Federigo blickte seinen Vetter mit Ernst und aus tief umschatteten Augen an.
»Die Natur als Gebieterin von uns allen! Ist das auch deine Meinung?«
Freudig wollte Lodovico antworten: ›Aber ja, natürlich! Die Natur, das ist die Liebe, das ist die Jugend und die Kunst, das ist unsere Zeit!‹, doch er spürte, dass der Vetter eine andere Antwort erwartete. Aber er wusste nicht, welche Antwort Federigo erwartete, und noch weniger wusste er, was er sagen sollte. Auf die Vergangenheit wollte er den Vetter nicht ansprechen, aber sein Blick konnte die Frage nicht verhehlen. Federigo nahm sie auf.
»Es war auch die meine, Lodovico, bis vor zwei Jahren. Du weißt es, und ich weiß es. Aber dann habe ich gesündigt im Namen dieser Natur, ich habe ein Mädchen unglücklich gemacht und – was viel schlimmer ist – sie vom Weg zu ihrem Schöpfer abgezogen. Da habe ich erkannt, welch’ verderbliche Macht in den Händen der Natur liegt, und ich habe ihr abgeschworen, um fortan Buße zu tun.«
»Du hast den Pinsel aus der Hand gelegt.«
»Ja, und ich habe nie mehr einen Strich gemalt seit zwei Jahren, ich habe nie mehr eine Frau angeschaut seitdem.«
Lodovico dachte: ›Aber dein Blick ist dir erhalten geblieben. Gebe Gott, dass du ihn nicht für etwas anderes nutzt.‹ Laut fragte er:
»Und die Buße, die verrichtest du jeden Tag? Füllt sie dich aus, spürst du, dass die Last geringer wird?«
Federigo sah ihn an mit diesem Blick, in dem nicht nur Schärfe und Prüfung lag, Lodovico konnte auch Hunger und Durst darin erkennen.
»Ich verrichte sie. Aber wer schuldig geworden ist vor dem Herrn, dessen Last wird nicht geringer, er verspürt sie jeden Tag aufs Neue und schärfer denn gestern, und er erkennt, dass es nur einen Weg gibt, sie zu mindern: indem er anderen zeigt, worin diese gesündigt haben, und indem er ihnen hilft, ihre Sünden zu bekennen und zu bereuen. Ich bleibe auf ihrer Fährte und lasse sie nicht aus den Augen, bis sie in sich gehen und bekennen: ›Mea culpa, mea maxima culpa‹.«
›Domini canis‹, dachte Lodovico voller Schrecken. ›Federigo, welch’ furchtbarer Weg! Die eigene Schuld zu sühnen, indem du andere in die Verzweiflung stürzt! Nichts hast du bereut seitdem, nichts hast du erkannt von dem Unglück der armen Lucrezia. Du bist immer noch derselbe, dem nichts größer ist als das eigene Ich, und du bleibst der wichtigste Mensch auf Gottes Erdboden, auch deine Schuld und deine Reue und deine Buße, sie sind einzigartig und können von niemandem auch nur im Traume erreicht werden. Du hast niemals schwerer gesündigt als hier im Kloster.‹ Lodovico beschloss, dem Vetter Widerpart zu bieten, aber nicht gleich jetzt und hier, da ihn der Vernaccia belebte und ihn der Tagliello mit einer wohligen Wärme ausfüllte. Stattdessen versuchte er, möglichst viel über die große Stadt zu erfahren.
»Hast du wohl viele arme Seelen in dieser Stadt, denen du helfen musst? Erzähle mir ein wenig von den Menschen, die hier wohnen, von ihren Sitten und Gebräuchen, vom Leben diesseits und jenseits des Arno. Sind sie so ganz anders als die Menschen in Prato?«
»Wie könnten sie das? Was machen zehn Meilen schon aus auf Gottes großem Erdkreis? Und doch, diese zehn Meilen können eine gewaltige Entfernung sein. Weißt du, was die Florentiner von den Pratesern unterscheidet?«
»Nun?«
»Es ist die Leichtlebigkeit und das Vertrauen in den Tag. Die Stadt ist alles, die Stadt beschützt sie, die Stadt ernährt sie, mit der Stadt stehen und fallen sie. Sie sind der festen Überzeugung, dass es neben der Lilienstadt nichts Vergleichbares gibt.«
»Haben sie denn da unrecht?«
»Weißt du, diese Stadt hat die herrlichsten Kirchen, die bedeutendsten Palazzi, die größten Kunstwerke, viel größer als Rom oder Byzanz, das ist auch meine Meinung. Und in ihr wandeln die schönsten Frauen und Mädchen, die man sich denken kann, aber ...«
»Aber du hast doch seit zwei Jahren keine Frau mehr angeschaut!«
Federigo sah ihn an mit einem stechenden Blick.
»Lassen wir das. Die Florentiner sind Kinder, sie verlieren sich im Unbedeutenden, sie bedürfen der Leitung, sie brauchen den Propheten.«
»Den Propheten?«
»Es war der Wille des Herrn, dass der Prophet auftrat, die Medici vertrieb und die Sitten wieder aufrichtete. Ohne den Propheten wäre diese Stadt dem Chaos geweiht.«
Lodovico konnte sich wohl denken, wen Federigo mit dem Propheten meinte, aber dass der Vetter ihn so benennen würde, wie es das einfache Volk am Arno tat, das überraschte ihn doch. Langsam begann er zu zweifeln, ob ein Kloster wohl der rechte Aufenthaltsort für ihn war, zumal dieses Kloster, in welchem die Mönche den Prior für einen Propheten hielten. Wo blieb die Liebe zum Menschen, wo blieb die Stimme der Natur, die beide doch Quelle und Ursprung waren für die Größe dieser Stadt? Und gar Federigo, der nie eine fremde Macht über sich ertragen hatte, Federigo sprach von einem Propheten und von seiner Leitung! Lodovico hatte beschlossen, an diesem Abend nicht die Auseinandersetzung zu suchen, also bat er den Vetter:
»Erzähle mir etwas von diesen Kindern. Erzähle mir von den Menschen in dieser Stadt.«
»Weißt du, sie sind ungemein prunksüchtig und an den Luxus gewöhnt. Die Frauen lieben es, sich auf der Straße zu zeigen, sie flanieren über die Via dei Calzaiuoli mit dem wertvollsten Schmuck und den raffiniertesten Kleidern, die kaum ihre Blöße bedecken, sie gehen alleine auf die Märkte und in die Kirchen, als hätten sie nie etwas gehört von Sitte und Anstand. Und die Männer, sie besuchen Häuser mit jungen Mädchen darin, dass sich jeder Christenmensch fragen muss: Wohin ist es gekommen mit dieser Stadt? Um ihre Verfehlungen zu vertuschen, gründen sie Findelhäuser, die sich der Nachfrage kaum erwehren können. Und die Kunst ist auf einen Tiefstand der Liederlichkeit gekommen, die einem Maler die Zornesröte ins Gesicht treibt.«
»Wie dies, lieber Vetter?«
»Nimm, wen du willst, die Maler, die Bildhauer, die Dichter: Sie preisen die rohe Nacktheit des menschlichen Körpers, sie malen sie, sie meißeln sie, sie widmen ihr Verse. Aber der Prophet, Bruder Girolamo, unser Prior, hat Kraft genug, dem allen einen Riegel vorzuschieben. Und er findet großen Nachhall. Der große Botticelli zum Beispiel hat öffentlich bekannt, dass Bruder Girolamo ihm die Augen geöffnet habe und dass er es herzlich bereue, jemals die Venus und die Primavera gemalt zu haben.«
»Aber das ist ja furchtbar!«, rief Lodovico. »Die Venus! Die Primavera! Ihretwillen bin ich nach Florenz gekommen. So will ich auch malen! Das will ich doch gerade von dem großen Meister lernen!«
»Du kannst viel von ihm lernen, vor allem dies, dass ein Mensch bereuen und umkehren kann und dass dies seiner Kunst nicht zum Schaden gereichen muss. Im Gegenteil. Seine Beweinung ist einzigartig, oder nimm die Heilige Maria Magdalena, die erst im letzten Jahr fertiggeworden ist: ein Zeichen der Demut jenes menschlichen Geistes, der die Kraft hat, sich selbst zu erniedrigen, um nicht selbst zu Fall zu kommen. Das kannst du von ihm lernen, und also bist du nicht umsonst nach Florenz gekommen.«
Lodovico war verzweifelt. Wie konnte das sein? Wie konnte er eine so falsche Vorstellung von dem gehabt haben, was ihn hier erwartete? Oder war es einfach nur die Enge des Klosters, die Federigos Gedanken so verkümmert hatte? Verkümmert waren sie, daran bestand gar kein Zweifel, und Lodovico war nicht einen einzigen Augenblick versucht, ihnen auch nur im Geringsten ein Gewicht beizumessen. Er wusste: Auch in dieser Stadt war Leben, das echte, richtige, wahre Leben. Da gab es zwei junge Mädchen, die Sehnsucht nach der Welt hatten, und da war sein Herz, welches diese Sehnsucht nur zu gut verstand. Das war richtig, das war natürlich, darin war nichts Falsches und keine Sünde. Von einem Federigo, der jetzt Bruder Bartolommeo hieß und der weiland eine Nonne namens Lucrezia geschwängert hatte, während er sie doch nur einfach malen sollte, ließ er sich nicht vorschreiben, was Tugend und was Sünde war. Er begriff, dass es seltsame Verbindungen geben konnte zwischen der Wahrheit und der Heuchelei, zwischen der Schuld und der Menschenverachtung.
Nach und nach erhoben sich die Mönche, um das Refektorium zu verlassen und den gewöhnlichen Tagesablauf zwischen Vesper und Komplet wieder aufzunehmen, jeder nach seiner Bestimmung, und der Bestimmungen gab es viele in dem berühmten Kloster San Marco. Auch Lodovico hatte sein Mahl beendet, das ihm mit so vielen seltsamen Gefühlen gewürzt worden war, und soeben wollte Federigo ihm seine Stube in der Pilgerherberge weisen, als eine bemerkenswerte Gestalt das Refektorium betrat, so dass die verbliebenen Mönche aufstanden, sich bekreuzigten und murmelten:
»Gelobt sei Jesus Christus.«
»In Ewigkeit. Amen«, sagte der Prophet, und im selben Augenblick erblickte er Lodovico und den Vetter in der äußersten Ecke des Refektoriums. Während er in ihre Richtung eilte, hatte Lodovico Zeit, in seinem Kopf eine erste Skizze von ihm zu entwerfen. Er war von kleiner Gestalt und von auffallend groben Gesichtszügen. Seine Bewegungen hatten etwas Huschendes, Lauerndes, und Lodovico nahm mit Unbehagen wahr, wie sehr ihm die Gabe zu Gebote stand, den Menschen mit einem einzigen Blick auszuforschen und auf den Grund seiner Seele zu sehen. Dabei wirkte er seltsam unsicher auf Lodovico, so als sei er sich seiner Hässlichkeit bewusst, sein Blick kam immer von unten und war stets von der schier unmenschlichen Anstrengung begleitet, jeden, den er anblickte, kleiner zu machen, als er selber war. Er kam nicht bis zu ihrem Tisch herab, sondern nahm auf einer Bank in der Nähe Platz. Federigo grüßte den Prior nach den Regeln des Ordens, und auch Lodovico stand auf und neigte ehrerbietig das Haupt. Savonarola gewährte ihnen eine Segensgeste und ließ sich von einem Mönch auftragen, nichts als einen Krug Wasser und ein paar Früchte. Das Gespräch zwischen den Vettern war zu einem Ende gekommen, und so beschlossen sie, nunmehr in die Pilgerherberge hinüberzugehen. Als Federigo am Tisch des Priors vorbeikam, bat er ihn, den Vetter in sein Quartier bringen zu dürfen. Savonarola sah Lodovico mit prüfenden Augen an.
»Du kommst aus Prato, mein Sohn?«
»Jawohl, ehrwürdiger Vater.«
»Und du bist Maler?«
Lodovico nickte und schluckte; denn die nächste Frage konnte er sich wohl vorstellen.
»Was malst du, mein Sohn? Was sind deine Gegenstände?«
»Der ehrwürdige Meister Botticelli hat mich hierher bestellt, dass ich an zwei Retabeln helfe; der eine ist für Santo Spirito, der andere für Santa Croce.«
Die Augen des Propheten verengten sich, und in seinem groben Gesicht war nichts als steinerne Härte und ein Anflug von Hass.
»Er malt für diese braunen Schandgesellen? Das wusste ich ja gar nicht. Warum weiß ich das denn nicht?«
Diese Frage, in der eine unverhohlene Drohung schwang, richtete sich an Federigo. Dieser machte eine Geste der Hilflosigkeit und schwieg. Der Prophet schaute wieder Lodovico an, und nach der Art des Inquisitors kam er auf die Frage zurück, weil dieser sie nicht im Sinne des Fragenden beantwortet hatte.
»Ich fragte dich nicht, was du malen wirst, mein Sohn, ich fragte dich danach, was du bereits gemalt hast.«
In Lodovico erhob sich ein beklemmender Widerstreit zwischen Furcht und Empörung. Dieser Mensch verstand es, eine Seele in Angst und Schrecken zu versetzen. Sein Herz klopfte bis zum Halse, und er sah den Folterkeller, roch den Scheiterhaufen. Dieser da würde sie ihm abpressen, seine Even und seine Susannen im Bade, den Raub der Sabinerinnen und das Urteil des Paris. Und dann würde er alles auf den Scheiterhaufen werfen und zu guter Letzt auch ihn selbst. Aber auch Empörung war in ihm, in demselben Herzen und zur selben Zeit. Was maßte dieser sich an, den Richter über die Menschen zu spielen? Wer gab ihm die Vollmacht, zu urteilen, was gut und was böse, was recht und was schlecht war? Lodovico hatte keine Schuldgefühle, seine Werke waren entstanden aus dem reinen Trieb, die Stimme der Natur zu verstehen und sie in Bilder zu formen. Sein Vater hatte ihn gelehrt, dass die Stimme der Natur die Stimme Gottes sei und dass es keine Sünde sei, die Dinge so zu malen, wie Gott sie geschaffen hatte. Das galt für einen Lehrsatz, nicht nur beim Vater, sondern bei allen angesehenen Malern der Zunft, und darin bestand die wunderbare Freiheit, welche die neue Zeit mit sich gebracht hatte. Dieser da wollte sie wieder zurücknehmen, er wollte die Zeit zurückdrehen und die Hässlichkeit der Menschenverachtung auf den Thron der Unschuld setzen. Federigo hatte er schon beraubt, nun wollte er auch ihn bestehlen. Das konnte er nicht zulassen, das ließ er nicht mit sich machen. Er musste ja nicht in diesem Kloster wohnen, und zur Not wäre er in einem Tag nach Prato zurück. Aber er wollte auch kein Hitzkopf sein und unbeherrscht alles aufs Spiel setzen, immerhin war er schon einundzwanzig Jahre alt, und morgen sollte er bei dem großen Meister vorsprechen, von dem er sich so viel für seine Kunst versprach. Also versuchte er sich in einer klugen Antwort.
»Ich habe gemalt, was mir Gottes Natur vor die Augen stellte. Und ich habe erfahren, dass es die Menschen froh gemacht hat.«
Der Prophet sah ihn durchdringend an.
»Nun hast du mir alles bekannt, mein Sohn. Ich kenne deine Bilder, sie stehen mir so vor dem Auge. Und nun sage ich dir Folgendes: Falls du nicht ablässt davon, dann wirst du den Weg gehen, den diese ganze Stadt gehen wird, wenn sie nicht Buße tut und bereut. Der Herr hat ein anderes Regiment für diesen Erdkreis gewollt, und er hat seine Diener bestellt, dass sie ihm sein Werk richten. Man muss dich im Auge behalten, mein Sohn«, dabei gab er mit einem einzigen Blick Federigo seinen Auftrag, »aber du wirst in eine gute Lehre kommen. Der Bruder Sandro wird dich weisen, wie man umkehren kann, so dass die Kunst wieder ein Wohlgefallen ist im Auge des Herrn. Gehe dahin, es wird dir ein Segen sein. Solange du aber Gast unseres Klosters bist, solange möge der Herr dich beschützen.«
Er hob die Rechte, und Lodovico wusste nicht: Geschah es, um Segen zu spenden oder den Stab zu brechen? Federigo murmelte:
»Gelobt sei Jesus Christus.«
Der Prophet entgegnete:
»In Ewigkeit, Amen«, und so waren sie denn entlassen. Federigo führte Lodovico in seine Kammer, die auf die Piazza San Marco ging, und verabschiedete sich schnell. Lange schaute Lodovico noch aus dem Fenster, bis die Stadt in tiefer Finsternis lag. Er hatte das unbestimmte Gefühl, zu einer Zeit in diese Stadt gekommen zu sein, die kaum einen Stein auf dem anderen lassen würde.
Am nächsten Morgen nahm er das karge Pilgerfrühstück zu sich und machte sich zeitig auf den Weg. Federigo hatte ihm den Weg zur Porta San Friano beschrieben. Es lag