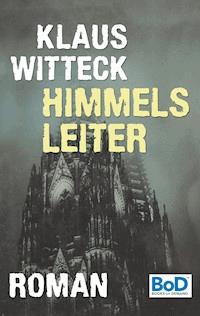Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rathenauplatz
- Sprache: Deutsch
Noch ein „Köln-Roman“, aber diesmal völlig anders als das Übliche! Auf über tausend Seiten (in zwei Bänden) wird die Lebensgeschichte des deutsch-italienischen Architekten Anton Giovanni Werth erzählt, den alle nur Tonio nennen, und in dieser Lebensgeschichte spiegelt sich zugleich die Geschichte der Stadt Köln von 1881 bis zum Frühjahr 1933. Dabei knüpft der Autor an die Handlung seines Romans „Himmelsleiter“ an und führt sie fort. Im Laufe des Geschehens kristallisieren sich vier große Themen heraus: Das Schicksal der Stadt Köln vom Kaiserreich bis zum Beginn des „Dritten Reiches“, die Entwicklung des Neuen Bauens von den Anfängen bis zur Herausbildung des Internationalen Stils, die Begegnung des Helden mit dem Judentum und das Erstarken von Nationalismus und Antisemitismus in Deutschland. Dabei begegnen uns namhafte Gestalten aus der Zeitgeschichte, allen voran Konrad Adenauer, aber auch die berühmten Kölner Architekten Wilhelm Riphahn und Dominikus Böhm. Und immer wieder ist es die Stadt Köln selbst, durch die uns der Autor führt. Die Handlung entwickelt sich in konzentrischen Kreisen um einen Platz in der Kölner Neustadt. Zu Kaisers Zeiten hieß er Königsplatz, in den Weimarer Jahren Rathenauplatz und im „Dritten Reich“ Horst-Wessel-Platz. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges heißt er wieder Rathenauplatz. An diesem Platz steht die große Kölner Synagoge, 1899 wurde sie eingeweiht, in den Pogromen 1938 verwüstet und vom Bombenkrieg fast völlig zerstört. Nach dem Krieg wurde sie wieder aufgebaut wie so vieles in Köln und am zwanzigsten September 1959 ein zweites Mal geweiht. Der Platz gibt dem Roman seinen Namen, die Synagoge gibt ihm seine Seele.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 749
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HERMOGENES:
Denn mir scheint jeder Name, den man einem Dinge beilegt, der rechte zu sein, und wenn man ihn wieder mit einem anderen vertauscht und jenen nicht mehr gebraucht, so muss man diesen späteren für nicht minder richtig halten als den früheren: wie z.B. wenn man den Sklaven andere Namen gibt, so ist der neue nicht minder richtig als der, den sie ursprünglich führten. Denn nicht von Natur kommt jedem Dinge ein Name zu, nicht einem einzigen, sondern durch Gesetz und Gewohnheit, je nach der wechselnden Wahl der Benennung.
(Platon: Kratylos. 384d)
Inhalt
Die Wirklichkeit der Namen. Früh am Morgen
Offene Augen über diesem Ort I
Erstes Buch: Königsplatz
Erster Teil: Die Steine werden schreien I
Zweiter Teil: Herrlichen Zeiten entgegen I
Die Wirklichkeit der Namen. Gegen Mittag
Pforten des Heils I
Zweites Buch: Rathenauplatz
Erster Teil: Der Feind steht rechts II
Zweiter Teil: Weiße Welt II
Die Wirklichkeit der Namen. Am Nachmittag
Verjünge unsere Tage II
Drittes Buch: Horst-Wessel-Platz
Erster Teil: Die Fahne hoch II
Zweiter Teil: Wo Bücher brennen II
Die Wirklichkeit der Namen. Gegen Abend
Nicht durch Macht und nicht durch Stärke II
Eine notwendige Anmerkung II
Die Wirklichkeit der Namen
Früh am Morgen
Offene Augen über diesem Ort
Dass Deine Augen offen seien über diesem Hause Tag und Nacht, über dem Orte, wovon Du gesprochen: Mein Name soll dort sein. Dass Du hörest auf das Gebet, welches Dein Knecht betet an diesem Orte.
(1. Kön 8.29. Aus dem Grußwort des Leiters der Israel-Mission bei der Wiedereinweihung der Synagoge Köln, Rathenauplatz am 20. September 1959)
I
Es ist kühl an diesem Morgen, der Himmel ist klar und von dem grauen Blau der frühen Stunde. Daran hätte ich denken sollen. Kühl ist es; denn wir haben September, und wenn der Tag sonnig wird, dann ist der Morgen schneidend, und der Abend wird kurz wie der Abschied einer verlorenen Liebe. Aber ich habe nicht daran gedacht. Ich habe keinen Mantel dabei, er liegt im Kofferraum meines Wagens. Ich sitze hier in meinem schwarzen Jackett und friere. Ich schlage die Revers hoch, aber das bewirkt nicht viel. Meinen Hut möchte ich nicht aufsetzen, er ist für drinnen mitgebracht und nicht für draußen. Ich werde ihn nicht aufziehen können, bevor ich die Treppen dort hinaufgestiegen bin, lange nach den bedeutenden Figuren dieses Tages, als eine der Randfiguren nämlich, und bevor ich – lange, lange nach den Großen – dieses Haus wieder betreten darf. Bis dahin liegt er hier neben mir auf der Bank. Gegen diese schneidende Kühle, welche die Erinnerung weckt und den Verstand scharf macht, würde er mir ohnehin nur wenig helfen. Will hat gemeint, wir sollten unsere Homburger tragen, weil der Bundeskanzler sicherlich in einem Zylinder kommen wird. Da müssten wir nicht mittun. Und eine Kippa trage doch unsereins nicht, vielleicht stehe sie uns nicht einmal zu. Ich bin anderer Ansicht, mir steht sie zu, mir kommt sie zu, meinem Haupt unter dem Angesicht des Herrn dieses Hauses, den niemand kennt. Aber ich habe eingewilligt, ohne ein Wort zu sagen. Der steife Hut liegt neben mir auf der Bank, und gegen die Kälte hilft er ebenso wenig wie eine Kippa. So muss ich also selber sehen, wie ich zurechtkomme.
Der Stern, wo ist der Schild Davids? Fast kann ich ihn nicht erkennen; denn die Sonne wird erst spät emporsteigen, damit sein Gold glänzen kann, und früh wird sie wieder hinter den Häusern des Platzes verschwinden. Aber er ist da, oben auf der Spitze des Daches, groß, schwer, mahnend, selber bedenklich auf der Spitze stehend. Wenn wir dort drinnen sitzen in drei Stunden, dann wird seine Stunde gekommen sein. Jetzt, am Morgen dieses September-Sonntages, spricht er noch nicht, selber nur grau und blau und stumm. O du Stern Davids, dass du dort oben wieder stehst, wer hätte das gedacht? Wer hätte das denken können? Im Schutt lagst du über zwanzig Jahre, während die, welche vordem dein Haus besuchten, selber verbrannten zu Asche und Staub. Aber heute stehst du wieder über dem Platz wie vor sechzig Jahren. Damals war ich schon dabei, heute bin ich immer noch hier. Ich verneige mich vor dir und vor deinem Volk, das seinen Herrn nicht verloren hat, nicht in den Gaskammern und nicht auf den Todesmärschen. Mir selber aber ist dieser Herr so fern geworden, lange schon, damals am Isonzo vielleicht oder spätestens bei den brennenden Büchern. Er spricht nicht mehr zu mir, hat vielleicht nie zu mir gesprochen. Wird er es heute doch einmal tun? O schweigender Stern dort oben in dem grauen Blau der frühen Stunde, wenn das geschieht, so wirst nur du das bewirkt haben. Wache über diesem Ort, schweigender Stern; denn es steht geschrieben: Sein Name soll hier sein. Sein Name über dem Platz mit den vielen Namen. Wache, und auch ich werde wachen. Ich werde diesen Platz nicht verlassen, bevor die Sonne wieder untergeht. Ich werde meine Augen offen halten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Ein alter Mann von achtundsiebzig Jahren, den es friert. Denn vielleicht spricht Er heute an diesem Ort, und dann will ich wach sein. Aber Er wird schweigen, und auch das kann ich hören an diesem Ort. An diesem Ort mit den vielen Namen. Wir werden gemeinsam wachen, du schweigsamer Schild des König David.
Ich habe mir eine Bank auf der nördlichen Seite des Platzes ausgesucht. Hier kann ich leicht den Stern über dem mächtigen Kuppelturm der Synagoge sehen, und wenn ich den Kopf zur anderen Seite wende, sehe ich die Stelle, wo die schmale Görresstraße in den Platz einmündet. Im Souterrain des Eckhauses ein ehemaliges Kneipenlokal, die Fenster mit Brettern vernagelt, niemand geht hier mehr ein und aus. Seit vielen Jahren nicht mehr, wer ging dort wohl früher hinein? Und wer kam heraus? Früher, in einer anderen Zeit. In einer Zeit vor dieser Zeit. Der Platz liegt völlig stumm. Auf der Roonstraße zwar bemerke ich schon Polizeiwagen und Absperrgitter, aber die werden erst später benötigt. Kaum ein Automobil fährt über die Straße. Die Sandkästen, die Klettergerüste: leer. Kein Kind verläuft sich an einem Sonntagmorgen hierher. Auch im späten September stehen die Büsche und Sträucher noch im vollen Laub, ihre Schatten schlucken alles auf in ein dunkles, graues Grün. Nur hier und da bereits sinkt ein frühes Blatt zur Erde, vor meine Füße, so dass ich sein unmerklich sanftes Aufkommen hören kann. Ich höre viel an diesem stummen Morgen auf dem Platz, fast gegen meinen Willen. Meine Ohren sind offen und meine Augen sind weit. Die Kühle des Morgens schärft die Sinne und weckt die Erinnerung. Die Erinnerung will nicht mehr schlafen. Aber sie schneidet, mehr noch als die Kühle der Luft. Und es ist noch ein langer Tag. In meinem Rücken weiß ich die Boisseréestraße, das Lindentor, die Lützowstraße. Links ist die Beethovenstraße, die Engelbertstraße, alle zielen auf den Platz, auf diesen Platz mit den vielen Namen. Und sie zielen auf den alten Mann, den seine Erinnerung frieren macht. Offene Augen und Ohren über diesem Ort.
Vielleicht gehe ich gar nicht hin. Auf mich kommt es ja nicht an. Niemand wird mein Fehlen bemerken. Die Mächtigen und die Bedeutenden werden viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein. Will wird es vielleicht bemerken, aber er kennt mich, er weiß: Wenn Tonio nicht kommt, so wird er sich wieder einmal nicht entschließen können. Wird sich nicht entschließen können wie so oft in seinem Leben. Und so würde ich enden, wie ich begonnen habe, ein Hamlet, ein Zauderer, der vieles weiß, aber nichts wollen kann. Nicht heiß, nicht kalt, nur lau, die aber wird Er ausspeien aus seinem Munde. Aber was wird mir denn heute noch gewonnen, wenn ich dort hineingehe? Vor sechzig Jahren war ich schon einmal dort, das faszinierende, geheimnisvolle Mädchen mit den großen, fragenden Augen saß oben auf der Empore, sie fragte mich, fragte mich immerzu mit ihren fünfzehn Jahren, aber ich blieb ihr die Antwort schuldig. So gingen wir hinaus, und ich konnte mich nicht entschließen. So gingen wir immer weiter, und ihre Frage wurde Schmerz, und der Schmerz wurde Klage. Und als die Jahre dahingingen, wurde ihre Klage stumm. Und dann? Und dann? O Tonio, du bist es nicht wert, dieses Haus noch einmal zu betreten. Oder musst du es gerade deshalb noch einmal tun? „Dieses Haus ist ein Haus des Betens für alle Völker.“ So steht es über einer anderen Synagoge. Vielleicht bete ich heute sogar, bete für dieses ferne Mädchen, bete um meine verlorene Seele, bete unter dem Stern. Ich habe nicht mehr gebetet seit vielen Jahren; denn ich habe niemals etwas gehört auf mein Gebet, keine Antwort, keinen Zuspruch, keine Mahnung. Warum beten? Zu wem beten? Zu den unendlich traurigen Augen dieses fernen Mädchens? Aber das ist kein Gebet, das ist nur das Bekenntnis meiner Schuld. Ach, gäbe es doch noch einmal diesen Tag im März vor sechzig Jahren, wie wollte ich alles anders machen! Wie sähe die Welt jetzt anders aus! Aber sie sieht so aus, wie sie ist, und deswegen muss ich hineingehen. Ich muss; denn in meinem Alter wird einem nicht mehr so oft die Gelegenheit gegeben, Abbitte zu tun, und das will ich. Soweit ich es vermag. Denn ich vermag nicht viel auf diesem Feld.
Über die Roonstraße, vom Barbarossaplatz her, blitzt jetzt ein erster, früher Sonnenstrahl hervor und fragt an, wie es bei uns steht. Die Polizeimänner beginnen damit, die eisernen Absperrgitter auf die Straße zu stellen. Zwei Arnoldwagen mit Blaulicht nehmen Stellung ein und machen es von nun an jedem herkömmlichen Automobil unmöglich, über die Roonstraße zu fahren. Ein kleiner Spatz, wie vom Himmel gefallen, sitzt plötzlich vor meinen schwarzen Schuhen und ruckt aufmunternd mit dem Köpfchen. Das ist ein Stadtvogel, der muss hart arbeiten für sein Auskommen. Ich krame in den Taschen meines Jacketts, finde aber nur zwei Hustenbonbons, die kann ich dem Tier nicht anbieten. Warte, in der Boisseréestraße ist eine Bäckerei, da kaufe ich einen Reihenweck, und den kannst du haben. Er ist einverstanden und fliegt einstweilen in die Linde über uns, während ich aufstehe und mich umwende. Die Boisseréestraße! Links das Haus Nummer Eins, wo ich meine erste eigene Wohnung hatte, unmittelbar über dem Ladengeschäft, in dem man heute Tapeten und Lacke verkauft. Damals konnte man dort Bürsten, Bohnerwachs und Topfschwämme bekommen, dazu Anmachholz und Schmierseife aus der Tonne. Das war noch vor dem Krieg, vor dem ersten Krieg; denn mittlerweile haben wir schon einen zweiten hinter uns. Und im Hinterhof mein „Studio“, in welchem die Großstädte der Welt entstanden, auf holzhaltigem Papier und unter dem lautstarken Protest der Anwohner; denn den Kanonenofen mit dem viel zu kurzen Rohr heizte ich mit allem, was sich dazu eignete, zuvörderst mit Linoleum-Resten aus dem Ladengeschäft. Die moderne Großstadt im Zeichen der Industrialisierung. Vielleicht rührt meine Sehnsucht nach der Weißen Stadt tatsächlich schon aus dieser Zeit. Die Bäckerei, die heute diesem Ladengeschäft gegenüber liegt, gab es damals noch nicht, aber sie hat geöffnet, das ist das Wichtigste an einem Sonntagmorgen. Ich verlange einen Reihenweck für zehn Pfennige und erweise mich spröde gegenüber den verlockenden Angeboten des Fräuleins bezüglich Domspitzen mit echtem Rum-Aroma oder Baisers mit Schokoladenüberzug, die Sahnetorten gebe es leider erst heute Nachmittag. Einen Reihenweck um zehn Pfennige für meinen kleinen Freund. Sie bricht das Backwerk von dem Riegel der anderen Wecken ab, überlegt sich, ob dieser Einkauf überhaupt eine Papiertüte wert ist, und bedauert in jedem Falle meinen „kleinen Freund“. Zurück auf meiner Bank, hat mein Freund mittlerweile ein ganzes Spatzenvolk mobilisiert, ich schätze die benötigte Kapazität auf etwa zehn Reihenwecken und bereue es bereits, nicht den ganzen Riegel erstanden zu haben. So muss ich also an ein gerechtes Teilen gehen, das von Anfang an zur Hoffnungslosigkeit verurteilt ist. Was nicht anders sein kann, tritt ein: Anstatt dass ich mir einen wohlgenährten kleinen Spatz zum Freund gemacht habe, umzetert mich ein hungriges Volk in der Wüste, das mehr Manna verlangt. Aber ich habe nicht mehr und getraue mich auch nicht in die Bäckerei zurück. So bleibe ich also schweigsam sitzen und warte, was geschieht. Ich muss nicht lange warten. Das Zetern erstirbt in gleichem Maße, wie das Interesse an dem unzureichenden Mannaspender erlahmt, und einer nach dem anderen erhebt sich, um vielleicht sein Glück bei den Hinterlassenschaften der Sester-Pferde auf der Ringstraße zu suchen. Freilich, heute ist Sonntag, da sind die Aussichten dürftig. Als Letzter erhebt sich mein kleiner Freund, aber er scheint doch recht zufrieden, offenbar hat er mehr abgekriegt als die Anderen, als Abschied schenkt er mir ein zartes „Tschilp“, dann ist das auch vorbei. Zehn Pfennige für den kleinen Augenblick eines bescheidenen Glücks.
Ich bin mit Katharina in die Stadt gefahren, wie wir es hin und wieder tun, aber heute mussten wir besonders früh losfahren; denn um neun Uhr wollte ich auf dieser Bank sitzen. Es ist eigentlich nicht mehr zu verantworten, dass ein alter Mann wie ich noch mit dem Auto fährt, aber mein schöner nachtblauer 170 S mit Weißwandreifen und cremefarbenen Lederpolstern ist nun schon fast zehn Jahre alt und weiß manchmal besser als ich, wie er fahren soll, deshalb benutze ich ihn immer noch und liebe ihn wie am ersten Tag. Sonst wäre es auch schwierig für uns, in die Stadt zu kommen, zu der wir doch ein so seltsames Verhältnis haben, unser beider Geburtsstadt. Heute wohnen wir im Bergischen, wir haben dort ein Haus, von dessen Terrasse man die Domtürme sehen kann. Hin und wieder fahren wir in die Stadt. Katharina besucht dann zumeist ihre Tochter in Lindenthal, ich sitze oft hier, gehe vielleicht durch die Lützowstraße, bin im Istituto Italiano di Cultura oder fahre zum Neumarkt. Am Abend, bevor wir wieder abfahren, treffen wir uns im Mohr-Baedorf oder auch im Kranzler, was es neuerdings auch bei uns gibt, manchmal fahre ich auch hinaus nach Lindenthal, und dann ist es die Decksteiner Mühle oder das Haus am See. Orte unseres Lebens, Stätten von Freud und Leid. Heute Abend werde ich sie im Café Braun treffen, am Lindentor, wie heute niemand mehr sagt; denn es ist gar kein Tor mehr, sondern nur eine schäbige Bahnunterführung, davor die Andeutung eines Platzes, keine hundert Schritte von hier. Es ist wunderbar altmodisch in dem Café, und sie haben ein herrliches Eis. Wie stets, werde ich zuerst da sein und auf Katharina warten. Ich warte immer auf Katharina. Zeit ist für sie eine unverbindliche Richtlinie zur Einrichtung unseres Lebens. Ihres Lebens, will ich dann immer betonen, nicht des meinen, der ich doch preußischer Offizier gewesen bin, was mir aber ansonsten gar nichts mehr bedeutet. Ich werde sie fragen, was die Enkelkinder machen, sie wird das Übliche darauf antworten und mich ihrerseits fragen, wie es in der Stadt gewesen sei. Aber heute wird sie mich vermutlich etwas anderes fragen, heute wird sie mich fragen, wie der „Staatsakt“ gewesen sei, so hat sie sich heute Morgen ausgedrückt. An dem „Staatsakt“ würde sie liebend gerne teilnehmen, aber das geht nicht, sie gehört nicht zu den betroffenen Personen, weder zu den Bedeutenden noch zu den Unbedeutenden. Ach Carina, der Staatsakt! Eigentlich hatte ich geglaubt, dass er zwischen uns gar nicht mehr stattfinden würde, weil ich doch schon so felsenfest überzeugt gewesen war von dem Satz des dänischen Philosophen, mit dem du mich bekannt gemacht hast: „Es gibt keine Wiederholung.“ Es hat sie aber doch gegeben, und dafür muss ich dir dankbar sein, auch dafür, dass du es so viele Jahre bei mir ausgehalten hast. Auch das wird bald vorbei sein. Aber bis dahin bleiben diese Autofahrten in die Stadt unser Anker im Leben der Vergangenheit, wenn wir auch selber dort nicht mehr leben können.
Nun findet schon ein erster, blendender Strahl der Sonne durch die Blätter des Buschwerks und trifft mein Gesicht, punktförmig wie durch eine Irisblende. Ich muss die Augen schließen, aber meinen Platz will ich nicht räumen. Die Kühle fühlt sich erträglich an, vielleicht wird es heute sogar noch richtig warm. Ich kann die Revers herunterschlagen, welchen Eindruck hatte das wohl auf das Fräulein in der Bäckerei gemacht? Solche kleinen Dinge sind mir peinlich, selbst in meinem Alter noch, aber sie widerfahren mir immer häufiger. Mit geschlossenen Augen sehe ich, wie der Sonnenstrahl mich verlässt und langsam, prüfend über den Platz streicht, an den Häusern hinauf, in die blinden Fenster hinein, in die Ladengeschäfte, von denen es hier nur wenige gibt, hoch zu dem Stern, aber seine Stunde ist noch nicht gekommen. Auf dem Bretterverschlag vor dem Kneipenlokal an der Görresstraße verweilt er eine ganze Weile, kann nicht durchdringen. Dann leuchtet er auf das Straßenschild davor, da steht ein Name. Es ist der Name dieses Platzes. Oder sollte ich sagen: Dies ist der Platz für den Namen? Wer gibt dem Ding seinen Namen? Gibt es mehr Dinge, als es Namen gibt, oder ist es eher umgekehrt? Ist es vielleicht sogar das Mittlere: Jedem Ding eignet sein Name von Anfang an und in alle Ewigkeit? Aber das kann nicht sein; denn dieses „Ding“ hier, dieser Platz hatte drei Namen, oder sollte ich besser sagen: vier? Also anders gefragt: Besteht eine innere Zwangsläufigkeit zwischen dem Ding und dem Namen, so dass ich nicht ohne weiteres und beliebig ein Ding einmal so und ein anderes Mal so nennen kann? Wenn wir das bejahen – und vieles spricht dafür; denn ein Name ist ein Name, nichts anderes -, so fragt sich, ob der Zwang von dem Ding ausgeht, so dass es eben diesen und keinen anderen Namen verdient, oder ob er nicht vielmehr von dem Namen ausgeht, weil nur er nennen kann, was das Ding ist? Anders gefragt: Ist die Substanz in dem Namen, oder ist sie in dem Ding? Indem ich die Augen fest geschlossen halte, zeigt mir der Sonnenstrahl dieses Ding, in dessen Mitte ich sitze, in vielerlei Gestalt. Ich sehe Bäume wachsen, ich sehe zwei Jungen spielen, ich sehe eine Pickelhaube, wie sie hinter den Jungen herjagt, ich sehe ein prächtiges Gotteshaus, eine große Treppe, einen goldenen Stern. Ich sehe eine Baracke mitten auf dem Platz, davor viele Menschen. Ich sehe Fackeln, Aufmärsche, Kolonnen, ich rieche brennendes Pech, ich sehe, wie der Stern aus der Höhe herabstürzt in die qualmenden Trümmer. Ich spüre verkohltes Papier und verbranntes Menschenfleisch. Für fünfzig, nein, für zehn Gerechte wäre die Stadt errettet worden. Doch ich sehe, wie die Häuser rings umher hoch auflodern und berstend in sich zusammenstürzen, das Innerste nach außen kehrend. Ich sehe das mit geschlossenen Augen; denn ich darf sie nicht öffnen, der Herr dieses Hauses hat es verboten, wenn ich nicht erstarren soll. Dann sehe ich nichts mehr und höre nichts mehr, eine lange Zeit. Es ist still, so still wie nach dem Jüngsten Gericht. Jetzt – endlich - fühle ich wieder die warme Sonne auf meinem Gesicht. Jetzt darf ich die Augen öffnen, der Herr dieses Hauses erlaubt es, er gebietet es. Siehe, mein Strahl streift die obere Spitze des Sterns und macht sie glänzend, golden und hell. Und auf dem Schild steht wieder der Name, der darauf stehen soll. Jetzt weiß ich die Antwort, der Stern hat sie mir gezeigt.
Auf der Roonstraße fahren Automobile vor, alles muss auf das Genaueste vorbereitet werden. Ich weiß, wie es da drinnen aussieht, ich war mehr als einmal dort. Oder weiß ich es vielleicht doch nicht mehr? Außen jedenfalls bemerke ich Veränderungen. Ein Schriftzug über den Fenstern, in Hebräisch, den gab es früher nicht, mittlerweile kann ich ihn lesen; denn nach dem Krieg habe ich ein wenig Hebräisch gelernt. Überhaupt, die Fenster: Früher waren das große Portale, vor der Freitreppe kein eisernes Gitter. Heute nur ein kleiner Eingang links, fünf Stufen hoch, wie eine Hintertür oder wie der Durchgang durch einen Festungswall, den man gut beobachten kann. Am Castello Sforzesco habe ich so etwas schon einmal gesehen. Vielleicht ist auch innen einiges anders. Wenn sich die Namen ändern, haben sich auch die Dinge geändert. Ich werde es erfahren, hernach, wenn ich drinnen bin. Drinnen sein, davor hatte ich mein Leben lang einen fast körperlichen Widerwillen. Draußen sein, dort, wo ich auch jetzt bin, das war meine Bestimmung, dahin floh ich, wann immer es ging. Draußen sein, allein mit mir selbst, da werden die menschlichen Verhältnisse nicht kompliziert. Sicher nicht, aber nur um den Preis, dass man sie verliert. Ich habe nicht immer Glück gehabt mit den menschlichen Verhältnissen, ich habe kein großes Geschick für sie. Aber ohne sie konnte ich auch nicht auskommen. Zeichen eines verzweifelten Bewusstseins: Wenn ich als junger Mensch bei Katharina war, konnte ich ihr fast nichts über meine Liebe sagen. Kaum war sie weg, erhielt sie die innigsten Briefe und die schönsten Gedichte von mir. Das kann eine Frau nicht glücklich machen, sie will kein Papier lieben, sondern einen Mann. Aber wenn der nicht lieben kann, so begreift das eine Frau sehr schnell. Für das Drinnen war ich nicht geschaffen, ein Erbteil meines Vaters vielleicht. Aber nur Wenige haben das gemerkt, Katharina zum Beispiel und das ferne Mädchen mit den großen Augen. Unter den Übrigen habe ich gelebt wie einer der Ihren. Meine Grillen zeugten von Stil, mein misanthropisches Denken bewies Charakter. So hatte ich mein Auskommen und wurde nur wenig behelligt. Das kann man so treiben ein Leben lang, doch am Ende, wenn nur noch Wenige geblieben sind, die den Stil ertragen und den Charakter schätzen, am Ende ist man ziemlich allein. Was war es bei mir: Unfähigkeit oder bloßer Unwille, Mutwille? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass ich mir meine Haut nicht ausgesucht habe. Oft war ich nicht gerne der, der ich sein musste. Oft wäre ich gerne der gewesen, der ich niemals sein konnte. Trotzdem, und das klingt widersinnig, war ich selten unglücklich bei mir, unerfüllt vielleicht manches Mal, verzweifelt eigentlich nie. Ich habe immer ein Mauseloch gefunden. Allerdings, am Rande war ich zwei Mal, einmal, als Katharina mich verließ, und einmal, als mir ein androgynes Scheusal, übrigens von verführerischem Aussehen, in einer stickigen, überfüllten Halle die Welt und ihre Bestimmung auslegte. Einmal war ich sogar über diesen Rand hinaus, und das war, als das ferne Mädchen mit den wissenden Augen sein Schicksal selbst in die Hand nahm. Da hätte ich sterben mögen, vielleicht wäre es besser so gewesen. Aber ich bin nicht gestorben, ich lebe auch heute noch. Und alle die Anderen, die über diesen Platz gingen, als gingen sie ins Leben, in ihr eigenes Leben. Aber stattdessen, wohin gingen sie? Der Platz weiß es; denn jeder Schritt geschah im Zeichen eines seiner Namen. Der Platz ist Raum, durch die Namen geht die Zeit, und wir können nicht stillestehen, können nirgends verweilen.
Es ist kühl an diesem Morgen, obwohl die Sonne jetzt schon wärmt. Scharf ist der Verstand und die Erinnerung wach. Bald werde ich dort hineingehen, dann wird es nicht anders sein. Plötzlich schwindelt mir vor einer Eingebung. Die Jugend ist kräftig, stark und unbesonnen, ihr Erbteil ist die Zukunft. Aber davon weiß sie nichts, sie hat gar keine Dimension als nur die meines kleinen Freundes aus der Linde, den Augenblick. Und dann wird sie geschoben, behutsam, langsam am Anfang, dann mäßig, schließlich immer schneller. Dann ist die Jugend vorbei. Das Alter hat seine eigene Kraft. Jeden Tag erfährt es mit Schmerzen, wie der Schub noch immer nicht vorbei ist, im Gegenteil, aber seine Dimension ist nicht der Augenblick, hic et nunc, seine Dimension ist die Vergangenheit. Das Alter malt nicht aus, es vergegenwärtigt, und wenn es ehrlich ist, beschönigt es nicht, sondern es beurteilt. Seine Tragik: Es kann nichts mehr ungeschehen oder gar besser machen. Die Zeit lässt sich nicht aufheben, sie ist, sie war, bald wird sie nicht mehr sein. Ich kann sie schauen, noch einmal schauen, die lange, kurze Zeit. Mehr nicht, aber das kann ich. „Unsern Eingang segne Gott“, das wäre schön, doch erst kommt der Ausgang.
Erstes Buch
Königsplatz
Erster Teil
Die Steine werden schreien
Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien, und die Sparren am Balkenwerk werden ihnen antworten.
(Hab. 2,11)
II
Wenn wir uns nun anschicken, die Lebensgeschichte von Tonio oder doch einen Teil derselben zu erzählen, so beginnt sie nicht auf einer Parkbank in der Kölner Neustadt, sondern im katholischen Hospital Sankt Marien, ganz in der Nähe der ehrwürdigen Stiftskirche Sankt Kunibert am Rheinufer. Es ist Dienstag, der siebzehnte Mai 1881. Tonios Vater hat einen Tag Urlaub von der Dombauhütte erbeten, um dabei zu sein, wenn seine Frau ihr erstes Kind gebären soll. Ob Junge oder Mädchen, das weiß er nicht, das ist ihm auch einerlei. Wenn nur Grita nichts zustößt und wenn nur das Kind gesund ist. Das kann man nicht wissen; denn da sind noch alte Rechnungen offen. Wenn Der sie nun gerade heute einlösen würde, jener, dessen Namen Tonios Vater niemals nennt? Ach, hätte er doch nur die feste Zuversicht seiner schönen Frau, die ihn auch jetzt noch stützen müsste, da sie doch eigentlich seiner Stütze bedürfte! Es ist fünf Uhr in der Frühe. Tonios Vater sitzt auf der weißlackierten Bank vor dem Kreißsaal, hat den Kopf ein wenig vorgebeugt und die leicht geöffnete Faust vor dem Mund. Er kaut nicht an den Nägeln, das steht dem Ersten Meister der Steinmetze am Dom nicht an, aber in seinem rasenden Kopf kommen die Gedanken nicht in Ordnung. Wenn nur alles gut wird! Wie mag es Grita dort drinnen gehen? Warum kann er jetzt nicht bei ihr sein? Die Schwestern werden schon wissen, warum sie Männer in diesem Zustand nicht in den Kreißsaal lassen. Erstens ist das Ganze nichts für Männer, sie sind viel zu schwach dazu, und zweitens ist das nicht schicklich. Tonios Vater bildet da keine Ausnahme, doch seinen Leidensgenossen ihm gegenüber auf der anderen weißlackierten Bank nimmt er gar nicht wahr. Wenn nur alles gut geht! Wenn wir nur alles richtig gemacht haben!
Seit einem halben Jahr ist der Dom fertig, seit Weihnachten ist Tonios Vater verheiratet, der Erste Steinmetz-Meister der Dombauhütte, seit drei Monaten heißt er nicht mehr Giovanni Valori, sondern Werth, Johann Werth, und seine Frau heißt Margarethe Werth, geborene Buttmühlen. So hat man ihnen geraten, zuvörderst Margarethes Vater, Anton Buttmühlen, der Wirt vom Fischmarkt; denn das sei für das Kind das Beste und auch für sie. Ein Italiener habe keine großen Aussichten in dem neuen, glänzenden Deutschen Reich. Und so hat das Ehepaar Valori die zweifelhafte Gunst der Stunde ergriffen und seinen Namen „eindeutschen“ lassen, was eigentlich nur für die vielen Zugezogenen aus den Ostgebieten des Reiches gedacht war, die ihre polnischen Namen loswerden wollten. Tonios Vater hat sich schwer damit getan, den Namen seines eigenen Vaters aufzugeben, er ist in Bergamo in der Lombardei geboren, aber für sein Weib, für sein Kind hat er dieses Opfer gebracht. Es wird ihm ein Opfer bleiben bis zum Ende seines Lebens. Und auch, dass sie hier in Köln wohnen und nicht in Italien. Doch seine Frau bleibt ihm immer Grita, und sie nennt ihn Gianni, wie aus den Tagen ihrer jungen Liebe.
Johann Werth ist dabei gewesen, als der Dom vollendet wurde. Er selbst durfte den Schlussstein auf dem Südturm setzen. Aber dabei hat er Einen kennen gelernt, den kein menschliches Wesen mit Namen nennt. Er hat mit ihm gerungen, er hat ihm seinen Steinmetz-Meißel in den Rachen geschleudert, dass er gedacht hat, er sei besiegt. Aber kein Mensch kann ihn jemals besiegen. In immer neuen Gestalten steigt er wieder auf und wieder empor. Tonios Mutter ist mittlerweile ratlos, wie sie der Obsession ihres geliebten Gatten begegnen soll. Vielleicht hilft das Kind, vielleicht wird es ihm beweisen, dass Gott und nicht der Satan diese Welt in seinen Händen hält. Tonios Mutter ist eine gläubige Katholikin, dabei eine kluge, aufgeklärte Frau, die nichts vom dumpfen Geschwätz mancher Pfaffen hält. Sie hat ihre eigenen Ansichten über diese Welt und wie es in ihr zugeht. Sie wird ihrem Kind eine gute Mutter sein und, wo es Not tut, ihren Gatten beschützen. Tonios Mutter ist eine starke Frau, viel stärker, als je ein Mann sein kann.
Giovanni Valori sitzt auf der Bank vor dem Kreißsaal und hat Angst um seine geliebte Frau. Das Schlimmste ist, dass er nichts tun kann. Wie oft hat man schon davon gehört, dass die Frauen bei der Geburt ihres ersten Kindes sterben! Aber das darf nicht sein! Insgeheim ertappt er sich dabei, wie er dem armen, unschuldigen und ungeborenen Kind die schwere Schuld am Tode seiner Mutter aufbürdet. Mein Gott, aber das nicht! Das ist Sünde. Doch dann hilf auch, Gott, dass es vorbeigeht! Eine Schwester kommt heraus, die beiden Männer fahren auf, erkennen verwirrt, dass sie nicht allein sind, und hängen am Munde der Ordensfrau. Diese, im schwarzen Gewand der Cellitinnen, schaut erst den einen, dann den anderen mit einer gewissen Herablassung an, sagt ein wenig schnippisch: „Nur Geduld, meine Herren, nur Geduld! Hier geht es nicht so schnell“, und verschwindet mit einem Bündel weißer Tücher in der Tiefe des Flures. Die Männer sinken verzweifelt zurück auf ihre Bänke. Im nächsten Augenblick stehen sie wieder auf und begrüßen sich gegenseitig.
„Johann Werth mein Name, verzeihen Sie, mein Herr, dass ich Sie gar nicht bemerkt habe. Aber es ist das Erste, wissen Sie.“
„Jacques Breier. Bei mir ist es genauso. Es dauert ja eine Ewigkeit! Lange halte ich das nicht mehr aus. Diese Schwester, hat sie denn gar kein Mitleid mit uns?“
Nein, keines. Mit den Männern ohnehin nicht, und mit den Frauen ist das so eine Sache. Manches Mal könnte man auf den schrecklichen Gedanken kommen, sie gönnten den Frauen ihren Schmerz von Herzen, damit sie dafür bezahlen, dass sie so frei leben und sogar Kinder bekommen können. Aber das ist nur eine Hypothese, wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, es an dem gebührenden Respekt vor dem entbehrungsreichen und aufopfernden Dienst der Ordensschwestern fehlen zu lassen. Die Männer jedenfalls ergreifen den dünnen Strohhalm einer beklommenen Konversation, um ihrer herzverengenden Angst Herr zu werden. Man teilt sich gegenseitig mit, wer man ist und wo man wohnt, stellt mit Schrecken und in allerletzter Sekunde fest, dass man hier keine Zigaretten rauchen darf, und im Übrigen holt man hin und wieder so tief Atem, dass daraus nur ein Seufzer entstehen kann. Die Zeit erstreckt sich in Unendlichkeiten, auf der weißen Stationsuhr ist der große Zeiger auf zehn Minuten nach fünf gesunken. Wie oft wird er noch sinken und wieder steigen und wieder sinken? Zehn nach fünf am Morgen, ein fahles Morgengrauen draußen auf dem Platz zwischen Hospital und Kirche. Eine Gaslaterne leuchtet matt in das weißlackierte Fenster des Flures. Von ferne hört man, wie ein Eisenbahnzug über die Rheinbrücke fährt, aber das ist weit weg.
Plötzlich wird es lebendig hinter dem marmorierten Milchglas der Tür zum Kreißsaal, aber ach, es ist nicht jener auf der Seite von Giovanni. Die Tür fliegt auf, eine Schwester tritt heraus mit einem Bündel im Arm und dem triumphierenden Ruf: „Es ist ein Junge! Und gesund!“ Giovannis Leidensgenosse springt auf, will „seinen“ Jungen in den Arm nehmen, aber das verwehrt ihm die Schwester, als hätte er tatsächlich eine Zigarette geraucht. Stattdessen winkt sie mit dem Kopf, der junge Vater stürzt durch die Tür, diese fällt glasklappernd hinter ihm ins Schloss, und Giovanni ist allein. Der Angstschweiß bricht ihm aus, soeben beginnt der weiße Zeiger der Stationsuhr wieder zu steigen. Halb sechs in der Frühe. Und kein Ende in Sicht. In seinem hämmernden Kopf läuft Giovanni alle Stiegen im Haus am Fischmarkt hinauf und hinunter, hinauf und hinunter, von irgendwo hört er Gritas Stimme: „Wenn ich ein Vöglein wär‘ ...“. Vöglein, Vöglein, du bist ein Vöglein, so jung und so leicht und so schön! Du kannst fliegen, aber ich kann nur warten. Wie lange muss ich noch warten? Fliege, fliege zu mir!
Nun, ewig kann das nicht so gehen, zum einen nicht aus den Gründen der natürlichen Abläufe und zum anderen, weil auch einmal ein Mitleid sein muss mit dem armen Giovanni, der doch Tonios Vater werden will. Und er wird es! Vorsichtig, ganz vorsichtig öffnet sich die Milchglastür auf seiner Seite, eine Schwester steht darin mit einem Bündel auf dem Arm und winkt Giovanni still mit einem Finger herbei. Er geht wie auf Zehenspitzen und schaut in das Bündel hinein. Da, ein Schrei, „Bäh!“ oder wie man das in der Schriftsprache zu Worte bringen soll, und Giovanni weiß, dass er ein gesundes Kind hat. „Es ist ein Junge! Und gesund!“, bestätigt die Schwester mit der Floskel, die offenbar allen Schwestern gemein ist.
„Und meine Frau?“
„Kommen Sie!“
Grita liegt da, erschöpft, glücklich, das Vögelein ist gelandet und gut. Sie lächelt und streckt ihre Arme nach Giovanni aus. Als er sich zu ihr niederbeugt und ihre Lippen mit einem ganz zarten Kuss berührt, kann er nicht mehr an sich halten. Er weint wie ein kleines Kind. Sie nimmt seinen Kopf in ihre Arme wie so oft und sagt: „Es ist alles gut, Gianni, es ist alles gut. Nun sind wir zu Dritt, und nur Gott hat ein Anrecht auf uns.“ Er nickt und weint in ihren Armen und nickt. Die Schwester mit dem Kind auf dem Arm hat so etwas nicht erwartet. Aber sie ist aus einem anderen Holz geschnitzt als ihre Mitschwester, und sie versteht. Deswegen legt sie das Kind auf das Bett zwischen Grita und Gianni und geht still hinaus.
So wurde Anton Giovanni Werth, genannt Tonio, geboren. Nach sieben Tagen verließen er und seine Mutter das Krankenhaus, und sie wurden mit einer Droschke in die elterliche Wohnung, in das Haus seines Großvaters Anton Buttmühlen am Fischmarkt kutschiert. Dort verlebte er seine ersten Jahre und lernte seine Heimatstadt, seine Mutter, vor allem aber seinen Vater kennen. Durch seinen Vater aber begegneten ihm auch der Dom und sein Schicksal.
Bei niemandem gab es einen Zweifel darüber: Tonio war ein hübsches Kind. Seine braunen Augen, sein schwarzes Haar, vor allem aber seine langen Wimpern ließen alle Frauen, die seiner ansichtig wurden, in wahre Orgien von Entzückung ausbrechen. Bei den Männern war es zu allererst sein Großvater, dessen Namen er trug, Anton Buttmühlen. Er hob das Kind in den Himmel. „Nee, wat is’ dat en lecker Kerlche!“, rief er ein ums andere Mal, während er Tonio auf seinen Knien wiegte. Ansonsten bemühte er sich aber, nur Hochdeutsch mit dem Kinde zu sprechen, immerhin hatte ihm seine Tochter eingeschärft, dass dies unabdingbar sei für seine Bildung. Auch der Knabe fühlte sich unwiderstehlich zu diesem behäbigen alten Mann hingezogen, und so war es ein rührendes Bild, die Beiden in dem großen Wirtshaus am Fischmarkt zu beobachten, wie sie Nachlaufen spielten über alle die engen Stiegen hinauf und hinab, wie sie Türme aus Bierfilzen bauten oder wie sie ganz einfach „Wirtshaus“ spielten, Tonio hinter dem Tresen abenteuerlich auf einem der hohen Wirtshausstühle balancierend, sein Großvater davor mit einem sogenannten Rondell, in das Tonio vorsichtig die hohen, wenn auch leeren Kölsch-Gläser sinken ließ. „Noch eins, noch eins!“, bis alle Fächer voll waren oder bis doch eins klirrend auf den Boden fiel. Das war kein Unglück, nicht für den Knaben und nicht für den Großvater, der aber immer mit Sorge und Ängstlichkeit darauf bedacht war, dass seinem Augapfel kein Leid geschah. Als der Kleine laufen konnte, ließ Anton Buttmühlen manchmal einfach das ganze Wirtshaus hinter sich und ging mit Tonio zur Schiffsbrücke an der Hafengasse. Dann warteten sie, bis die großen Dampfer den Rhein hinaufstampften und nach der Festen Brücke wieder die Schornsteine nach oben klappten, dabei schauerlich tuteten, damit sie Durchlass bei der Schiffsbrücke erhielten. Bei Ostwind wehte ihnen der schwarze Rauch der Ungetüme ins Gesicht. Danach wurde die Brücke wieder geschlossen, und die Beiden konnten hinüber zur anderen Seite. Auf der hohen Terrasse des Bellevue in Deuttz gab es für das Kind immer ein Malzbier und für den Großvater natürlich ein Kölsch, dazu eine Havanna. Der Großvater erklärte dem Kind, das große Ungetüm dort drüben, das sei der Dom, dort arbeite sein Papa, aber beide würden nie fertig, nicht der Papa und nicht der Dom. Dann schaute der Knabe seinen Großvater fragend an, weil er nicht verstand, was dieser meinte. Anton Buttmühlen strich dem Knaben über das Haar und sagte: „Ach, das ist doch egal. Dein Papa soll dir das nächstens erklären, ich weiß das auch nicht so richtig. Komm, wir gehen jetzt zur Eisenbahn!“ Die Eisenbahn! Das war Tonios wunderschönstes Erlebnis. Mit zwei Händen hielt er sein Glas, um es leer zu trinken, der obere Rand hinterließ einen Abdruck auf seiner Stirn. Jetzt geht’s zur Eisenbahn! Wie oft schon standen die Beiden auf der Eisenbahnbrücke über den Rhein, die in Köln nur die „Muusfall“ hieß wegen ihres eisernen Gitterwerks! Genau in der Mitte, wo unten die Dampfer mit abgeknicktem Schornstein stromaufwärts oder stromabwärts glitten und wo genau vor ihnen die fauchenden Dampfrösser über den Fluss ächzten. In den Waggons saßen richtige Menschen, Tonio konnte sie sehen. Manchmal hatten sie die Fenster herunter geschoben und winkten den Beiden. Tonio, auf dem sicheren Arm des Großvaters, winkte begeistert zurück. Aber noch aufregender als die Menschen in den Coupés fand Tonio die Lokomotivführer vorne auf der Maschine. Sie lehnten seitwärts aus dem Fenster und schauten unfehlbar danach, wann die Brücke ein Ende hatte. Und wenn sich zwei Züge mitten auf der Brücke begegneten, dann dröhnte und zitterte es, als müsste gleich die ganze Konstruktion einstürzen. Aber davor hatte Tonio keine Angst, er war ja auf dem schützenden Arm seines Großvaters, da konnte ihm nichts geschehen. Die Lokomotivführer hatten schwarze Kleider an und eine schwarze Mütze auf, und auch im Gesicht waren sie ganz schwarz. Sie mussten arbeiten. Arbeiten, das wollte Tonio auch, genau so wie die Lokomotivführer. Oft, wenn die Beiden nach Hause kamen, hatten sie auch so schwarze Gesichter, aber nicht nur das, auch Tonios ehemals schneeweißer Matrosenkragen war ganz schwarz, ebenso wie der Stehkragen seines Großvaters. Bei dem war es nicht so schlimm, den konnte man einmal durchs Wasser ziehen, dann war er wieder passabel, aber bei Tonios Kleidern war das etwas Anderes. Oft schalt Tonios Mutter ihren eigenen Vater, er solle das Kind nicht so „verdrecken“ lassen, sie hätte zum Schluss nur die Arbeit damit. „Verdrecken“, so etwas sagte Tonios Mutter sonst nie, und er merkte sich das Wort. Aber um nichts auf seiner kleinen Welt hätte er es sich nehmen lassen, sich mit seinem geliebten Großvater demnächst noch einmal zu „verdrecken“. Und im Laufe der Zeit fanden die Beiden noch viele Varianten, sich zu „verdrecken“. So war Anton Buttmühlen ein spätes, verstohlenes Glück beschert, und Tonio verlebte eine wunderbare Kindheit an der Hand seines Großvaters.
Kurz über lang brauchte Anton Buttmühlen zwei Hände; denn nach zwei Jahren war das zweite Enkelkind da, Peter Vittorio Werth, den sie dann alle nur Piero nannten. ‚Immer dieses italienische Getue!‘, dachte Anton Buttmühlen nicht zum ersten Mal. Mit den Italienern war er nun wahrlich gesegnet! Freilich, beim ersten Mal konnte er niemanden zur Verantwortung ziehen; denn als er Margarethes Mutter kennengelernt hatte, war er selber auf eine Italienerin hereingefallen. Diese wohnte nicht bei ihm in Köln, sondern ‚trieb sich‘, wie Anton das nannte, als Kammersängerin an den berühmtesten Opernhäusern Europas ‚herum‘. Doch auch sie war in die Jahre gekommen, eine Fünfundfünfzigjährige kann kaum noch die Königin der Nacht singen, und bei der Donna Elvira musste man schon ganz gehörig durch die Finger sehen. Also wurden ihre Konzertpausen länger, als ihr selber lieb war, und entsprechend häuften sich ihre überfallartigen Besuche am Fischmarkt. Wie nicht anders zu erwarten, schloss sie Tonio sogleich in ihr großes Primadonnen-Herz und hätte ihn beinahe darin erstickt. Aber Tonio fasste keine rechte Zuneigung zu dieser Großmutter, intuitiv spürte er wohl, dass ihre Liebe eigentlich nur Selbstliebe war. Was Margarethes Mutter zum Beispiel überhaupt nicht ertragen konnte, war dieses, dass Tonio sie „Oma“ nannte. „Oma“, da brach eine Welt zusammen für Vittoria de Angelis. Sie brauchte lange, aber schließlich merkte sie es selbst, dass da keine Wärme von dem Kind zu ihr herüberwehte. Weit davon entfernt, sich einzugestehen, dass sie selber keine Wärme hatte, zuckte sie die Schultern, tätschelte ihrer Tochter die Wangen - „Schau, schau! Noch so jung und schon zwei Kinder!“ -, fingierte einen Kuss für Tonios Großvater, ihren Nicht-Ehemann, und reiste mit großem dramatischem Effekt wieder ab. Man gewann den Eindruck, dass sie mindestens zwei Mal so oft abreiste, wie sie ankam. Bei solchen Gelegenheiten ließ Anton Buttmühlen seinen geliebten Enkel auf den Knien reiten und sagte zu ihm: „Lass‘ sie nur, Tonio. Sie kommt schon wieder. Solche kommen immer wieder; denn sie wollen wissen, was wir von ihnen halten. Sie sind darauf angewiesen, weißt du. Wir aber, wir halten gar nichts von denen. Wir brauchen die nicht, wir brauchen nur uns selbst und sonst niemanden, und natürlich Mama und Papa, das versteht sich.“ Das verstand der Knabe gut, Opa, Mama und Papa, das war seine Welt. Großzügig ließ er den kleinen Piero auch daran teilhaben, und seine Mutter musste ein über das andere Mal darauf achten, dass er dem kleinen Bruder nicht vor lauter Liebe das junge Leben vorzeitig verkürzte.
Tonio ging noch nicht in die Schule, da kannte er den Dom schon in- und auswendig. Zwischen den beiden Türmen standen noch die Gerüste, die man in diesen Tagen erst langsam abzutragen begann. Tonios Vater, der Erste Meister der Steinmetze an der Dombauhütte – mittlerweile war er auch leider der letzte -, nahm ihn oft mit auf die „Baustelle“, wie er sagte, obwohl der Dom doch eigentlich schon fertig sein sollte. Aber für Tonios Vater blieb es immer die „Baustelle“, und in Wirklichkeit war es auch so. Keine Rede davon, dass der Dom am fünfzehnten Oktober 1880, am Tage seiner feierlichen Einweihung, schon fertig war. Kaum einer konnte das sehen hinter den Gerüsten, aber Tonios Vater wusste es, Tonios Vater, der den letzten Stein in die Kreuzblume auf dem Südturm versetzen durfte, während von unten Kaiser und Reich heraufstarrten. An den Türmen fehlte noch vieles, vor allem am Südturm, aber auch an der Südwand des Langhauses und an den Chorkapellen. Hoch oben auf den Gerüsten erklärte der Steinmetz-Meister seinem Jungen, den er fest an sich presste, damit ihm ja nichts geschah: „Er wird nie fertig, mein Junge, so sehr wir uns auch mühen. Wir bauen und bauen, aber es bleibt immer mehr zu tun, als wir schaffen können. Und manchmal abends, wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind, haben wir das Gefühl, dass ihm jetzt sogar noch mehr fehlt als am Morgen. Dann sind wir sehr traurig. Kannst du das begreifen, mein Sohn?“ Tonio konnte das nicht begreifen, das ging über sein kindliches Vorstellungsvermögen, aber er begriff sehr wohl, dass sein Vater traurig war und immer trauriger wurde, je öfter sie auf den Dom stiegen. Dadurch wurde er selber traurig. Ganz von ferne begriff Tonio dann auch, dass zum Glücklich-Sein das Traurig-Sein gehört, dass das eine ohne das andere nicht sein kann. Denn Tonios Vater war durchaus nicht immer traurig, manchmal, als sie auf den hohen Planken der Gerüste standen, geriet er geradezu in einen Rausch, wies in das weite Land und rief: „Sieh, mein Junge, das ist das Land, welches man nur von hier oben sehen kann! Und niemand sieht das jetzt außer dir und mir! Das ist unser Land! Sind wir nicht reich? Ist das nicht großartig?“ Tonio schwindelte ein wenig, aber sein Vater hielt ihn sicher, und so sah er tief unter sich den Rhein, sah den Turm der Martinskirche, wo sie wohnten, sah den Bahnhof und die Brücke, wo er schon so manches Mal mit seinem Großvater gestanden, sah weit hinaus in das Land, erblickte die sieben Berge, ahnte die sieben Zwerge, und sein Herz wurde so weit, dass er einfach jubeln musste. Sein Vater jubelte mit ihm, weit oben über den Dächern von Köln, und dann war er nicht mehr traurig, dann waren sie beide glücklich. In dieser Zeit entstand in Tonio eine tiefe, unauslöschliche Liebe zu seinem Vater, und er wollte in allem so werden wie er.
Bei den Werkleuten, die von Tag zu Tag weniger wurden, war Tonio schon bald sehr bekannt, und er wurde von allen geliebt. Dieses kluge und gewandte Kind, der Sohn des Steinmetz-Meisters, war ein wahres Labsal in ihrem unsicheren Arbeitsalltag, der zunehmend davon überschattet wurde, dass immer mehr von ihnen gehen mussten. Der Dom wurde vielleicht nie fertig, mag sein, aber trotzdem brauchte man sie nicht mehr. Sie konnten gehen. Aber wohin? Zum Schluss leisteten die Steinmetze nur noch Hilfsdienste, zum Beispiel bei der Beplattung des Dom-Inneren, das würde auch bald vorbei sein. Aber wenn dieses Kind in den Hof der Dombauhütte kam, nicht mehr dort, wo sie einst gestanden, auf der Südseite des Domes, sondern auf der kleinen Terrasse im Schatten des Nordturms, wenn es dann rittlings auf den Werkbock genommen werden wollte und jedem Schlag der Meißel aufmerksam zusah, wenn es selber einmal Schlegel und Meißel in die kleinen Händchen nehmen wollte, dann waren schnell drei, vier Steinmetze da, die zusahen und ihm aufmunternd dabei halfen. Seit jenen Tagen stand es bei Tonio fest: Er wollte nicht mehr Lokomotivführer, er wollte Steinmetz werden wie sein Vater. Alle diese Steine hier, von ganz unten bis ganz oben in die Spitzen der Türme, waren ja von Steinmetzen gemacht! Und die steinernen Rosen, die Spitzen, die Männer und Frauen in Stein, die dort in den Wänden standen: alles von Steinmetzen! Das wollte er auch können. Die Steinmetze belehrten ihn: Nein, nicht alles sei von ihnen, die Männer und Frauen würden von den Bildhauern gemacht. Aber sein Papa, der könne alles, der könne Steine behauen und Männer und Frauen machen. Ob er denn noch nie seine steinerne Mama dort oben hoch in den Türmen gesehen habe. Nein? Dann müsse ihm sein Papa die aber unbedingt einmal zeigen.
Tonio war ganz verwirrt und aufgeregt. Seine Mama oben auf dem Dom in Stein! Als er seinen Vater danach fragte, wich dieser seinem Jungen aus und wollte ihm gar nichts erzählen. Da hätten sich die Steinmetze ja etwas Schönes ausgedacht. Tonio war enttäuscht, er verstand seinen Vater nicht, der ihm doch sonst immer alles am Dom zeigte, was er nur wollte. Er beschloss, seine Mutter danach zu fragen, die musste es doch schließlich wissen. Als Tonio mit seiner Frage herausrückte, waren die Beiden ganz allein in ihrer Wohnstube am Fischmarkt, der kleine Piero spielte mit rot und blau lackierten Bauklötzen in seinem Laufstall. Margarethe Werth nahm ihren kleinen, klugen Tonio auf den Schoß und strich ihm liebevoll über das Haar.
„Ja, mein Schatz, die Steinmetze haben tatsächlich Recht, und auch wieder nicht. Da oben am Dom nämlich hat dein Vater eine Maria aus Stein gehauen, nicht die Mutter des Jesuskindes, sondern eine Frau, die auch Maria hieß und die oft zu unserem Heiland kam, um ihn zuzuhören. Und auch ihre Schwester, welche Martha hieß, hat dein Vater gemacht, die steht auch da oben. Und weil er keine rechte Vorstellung von ihren Gesichtern hatte, so hat er der Martha das Gesicht seiner eigenen Schwester gegeben, deiner Tante Agnese aus Mailand, und die Maria, nun, die sieht so aus wie ich. Hier unten, im Garten hinter dem Haus, musste ich deinem Vater Modell sitzen. Da hat er der Maria mein Gesicht geliehen.“
„Aber du hast doch noch deins!“ Tonios Herz klopfte; denn er verstand nicht ganz, was seine Mutter meinte. Sein Vater hatte der Maria das Gesicht seiner Mutter geliehen! Dann hatte die Mutter vielleicht jetzt das Gesicht der Maria! Natürlich konnte Tonio nicht Maria und Maria unterscheiden, sondern er dachte fortwährend an das herrliche Bild im Dom mit der schönen Frau, ihrer goldenen Krone und dem kleinen Jesuskind auf dem Schoß, so klein wie der Piero. Die hätte jetzt vielleicht der Mutter Gesicht und die Mutter ihres. Sein Vater konnte Gesichter verleihen! Das war ja aufregend! „Warum will mir Papa denn dein richtiges Gesicht nicht zeigen?“
Margarethe lachte schmerzlich und zog ihren kleinen Liebling ganz an sich heran.
„Mein richtiges Gesicht, das habe ich immer noch, hier kannst du es sehen. Aber da oben, mein zweites Gesicht, vielleicht ist es nicht mehr so schön wie am Anfang, und das will dir dein Papa womöglich nicht zeigen. Ich will noch einmal mit ihm reden, vielleicht darfst du es dann doch noch sehen.“
Margarethe kannte ihren Mann nur zu gut, und sie wusste, warum er Tonio seinen Marien- und Marthen-Zyklus nicht sehen lassen wollte. Er konnte ihn selber nicht mehr sehen. Nicht, dass er auf einmal mit seinem Werk unzufrieden geworden wäre, nein, aber es war nicht mehr sein Werk, oder besser: Es war nicht mehr sein Werk allein. Da war sie wieder, die große Sorge Margarethes um den inneren Frieden des geliebten Gatten. Eines Abends, es mochte vor einem Jahr gewesen sein, kam er in großer Unruhe und tiefer Niedergeschlagenheit vom Dom nach Hause.
„Grita, Er ist wieder aufgetaucht.“
„Wer, mein Schatz?“
„Der! Der! Du kennst ihn! Wir haben ihn beide schon einmal gesehen. Er zerfrisst den Dom!“
„Gianni!“ Dunkle Erinnerungen stiegen in Margarethe auf. Giannis Seele, das war die Seele eines Kindes, wenn er auch sonst mutig und stark sein konnte wie ein Löwe.
„Er zerfrisst den Dom. Er nagt an dem Stein, als sei er modriges Holz. Noch nicht zehn Jahre sind ins Land gegangen, kaum fünf, und der Dom zerfällt! Das musst du dir ansehen! Die Fialen, die Wasserspeier, die Heiligen, als hätten sie Lepra! Die Steine sind krank, sie schreien vor Schmerz. Sie schreien, dass ich mir die Ohren zuhalten muss. Grita, er wird gewinnen. Zum Schluss wird er doch noch gewinnen.“
Damals dachte Margarethe: Wieder diese alte Geschichte! Gianni ist krank, und von dieser Krankheit wird er nicht mehr genesen. Dann wurde ihr wieder mit Schmerzen bewusst, dass eigentlich sie der Grund war für diese unheilbare Krankheit. Sie hatte darauf bestanden, dass sie hier in Köln und nicht in Italien leben sollten. Gianni hatte sich gesträubt, wollte nicht, wollte seine junge Frau mit nach Italien nehmen, wollte alles hinter sich lassen, dieses Köln, dieses Deutschland, diesen Dom. Sie verursachten ihm nur Angst und Schrecken. Doch er musste bleiben. Also fügte er sich, er verleugnete seinen Namen, nach seinem Passeport war er jetzt sogar ein Deutscher, seine beiden Söhne wurden hier geboren, auch sie waren Deutsche. Jeden Tag ging er zum Dom, zur „Baustelle“. Aber darüber war Tonios Vater krank geworden. Viel später, als Tonio schon die Philosophen las, begriff er, dass dies die „Krankheit zum Tode“ war, wie sie der dänische Philosoph genannt hatte, der seinem Herzen eine Weile nahegestanden hatte. An dieser Krankheit war sein Vater schon zu jener frühen Zeit erkrankt. Tonios Mutter war eine kluge Frau, kannte zwar den dänischen Philosophen nicht, aber wusste umso besser, wie es mit ihrem Gatten stand. Und sie fühlte sich schuldig. Vielleicht sollte Tonio gar nicht mehr mit seinem Vater zum Dom, wer weiß, was daraus noch werden konnte? Doch als sie dann wieder in die leuchtenden Augen ihres Kindes sah, erkannte sie, dass dies gar nicht mehr möglich war. Tonio war schon ganz von dem Zauber des Domes gefangen, da gab es kein Entrinnen mehr. Also beschloss Margarethe, mit ihrem Mann zu reden, ihn vorsichtig zu bitten, dem Kinde doch einmal die Figuren zu zeigen, ohne ihn mit seinen fürchterlichen Visionen zu ängstigen.
Tonios Vater wollte erst gar nichts von dieser Bitte wissen. „Nein, Grita, ich kann sie ihm nicht zeigen, ohne ihm zu erklären, warum sie so aussehen. Aber das will ich nicht. Unser kleiner Tonio soll davon nichts wissen. Wir wollen ihn schützen, soweit es in unserer Macht steht. Und Der soll nie einen Anteil an ihm haben, nicht an ihm und nicht an Piero.“ Margarethe wusste, wie es um den Dom bestellt war, sie hatte es mit eigenen Augen gesehen. Es war furchtbar und eigentlich nicht zu erklären. Nur wenige Jahre nach seiner Fertigstellung zeigte das Bauwerk schon solche Anzeichen von Verwitterung, wie es sie früher wohl in Jahrhunderten nicht gegeben hatte. Margarethe konnte sich da ein Urteil erlauben; denn sie war Kunsthistorikerin und beim Amt für Denkmalpflege beschäftigt, wenngleich sie sich im Augenblick nur ihren Kindern widmete. Niemand konnte sich das erklären, und ihr Gatte stand nicht allein mit seiner Ansicht, dass hier wohl dämonische Kräfte im Spiel sein mussten. Doch das wollte Margarethe nicht gelten lassen. Ihre Ansicht war, dass, wenn man eine Wirkung wahrnahm, man so lange nach der Ursache forschen musste, bis man sie gefunden hatte. Wenn man gar keine finden würde, das heißt gar keine im Bereiche der Physik, dann konnte man immer noch in einem anderen Bereich nachfragen. Aber so weit war man hier noch nicht, obwohl kein einziger der angeschriebenen Geologen eine überzeugende Antwort wusste. Vielleicht wäre es wirklich am besten, wenn ihr kleiner Tonio das gar nicht sehen müsste; denn sein Vater würde ihm nur eine Erklärung geben können, die den Jungen völlig verwirren und ängstigen musste. Doch dann keimte eine Hoffnung in Margarethe auf. Ihr Junge, so klein er war, hatte die Gabe, alle Dinge in einem nüchternen und natürlichen Licht zu sehen, das schon manchen überrascht hatte. Vielleicht konnte dieser kleine Junge seinen Vater von seinen schweren Träumen befreien, vielleicht war es möglich, dass dieses Kindlein seinem Vater den Weg zum Himmelreich weisen könnte, wenn sie denn einmal mit den Worten des Heilandes sprechen sollte.
„Gehe hinauf mit ihm, Gianni, ich bitte dich. Wir wollen es schützen, unser Kind, aber nicht, indem wir es verstecken. Wir wollen kämpfen. Du hast dich auch nicht versteckt. Erinnerst du dich an deinen Meißel? Er ist Ihm übel bekommen.“
„Aber er ist wieder aufgetaucht.“
„Vielleicht, Gianni, aber was folgt daraus? Dass wir ihm ab sofort die Welt kampflos überlassen sollen? Dann hätte er wirklich gesiegt. Aber wenn wir niemals Ruhe geben, wenn wir immerfort kämpfen, dann wird er nicht die Oberhand gewinnen. Das ist unsere Aufgabe im Leben: immerfort zu kämpfen gegen das Böse. Gehe hinauf mit Tonio und sage Diesem: Wir haben erkannt, wer du bist, ich und mein Junge, und wir werden dich wieder hier herunterwerfen, wie es dir schon einmal geschehen ist. Wir werden oben bleiben, aber du wirst fallen, wie du gefallen bist vor Zeiten in den Pfuhl der Hölle!“
„Grita, deine Dissertation über den Signorelli! So habe ich dich schon einmal gehört. Es hat mich damals erschüttert und hat mir Kraft gegeben. Wie du sprechen kannst!“
„Gibt es dir auch jetzt Kraft, da unser Kind an deiner Seite ist? Er muss hinauf auf den Dom, da gibt es nichts! Nimm ihn und zeige ihm alles, wie es ist. Sage ihm aber auch, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt.“
„So ein kleines Kind.“
„Nicht zu klein für die Wahrheit und nicht zu gering für Gottes Liebe.“
„Nein, Grita, wahrlich nicht. Wenn ich dich nicht hätte! Wir werden hinaufgehen, ich werde ihm alles zeigen, und ich werde ihm alles erklären.“
Tonio war überglücklich, als ihn sein Vater einige Tage später aufforderte, mit ihm hinaufzusteigen und hoch dort oben die Figuren seiner Mutter und seiner Tante zu besichtigen. Es war ein kalter Tag im November, der Himmel war grau, und der Wind pfiff um die Ecke des Nordturms, wie es die Kölner nicht anders kannten. Das Fahrgerüst hatte man bereits demontiert, so mussten die Beiden die enge Treppenspindel im Südturm nehmen. Anfangs schritt der kleine Knabe wacker aus, doch auf dem fünften oder sechsten Treppenabsatz musste ihn sein Vater auf die Schultern nehmen. Endlich erreichten sie die Glockenstube. Tonio war nicht zum ersten Mal hier und wollte sofort hinaus auf die Gerüste. Doch heute hielt ihn sein Vater fest.
„Warte, mein Junge. Wir wollen hier ein wenig Rast machen; denn ich muss dir noch die Geschichte dieser Glocken erzählen. Schau dich einmal um, wie viele zählst du?“
Tonio hatte auf der Steinbank neben dem Vater Platz genommen und nahm seine kleinen Finger zu Hilfe, während er zählte:
„Eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf!“
Er war entzückt, dass es genau so viele Glocken gab wie Finger. Sein Vater nahm die kleine Hand noch einmal in die seine und zählte:
„Eins, das ist die Pretiosa, zwei, das ist die Speciosa, drei, das ist die Ursula, vier, das sind die drei Könige, und fünf, das ist der dicke Kaiser.“
Das gefiel Tonio: „Der Kaiser, der ist aber dick!“
„Doch der kann nicht gut Musik machen. Immer, wenn die anderen eine schöne Musik machen wollen, dann platzt der dicke Kaiser darein und ruft: Bong! Dann ist die ganze Musik verdorben, und die vier Kleinen schweigen still. Und weißt du, woran das liegt? Die Kleinen sind zwar klein, aber sie sind alt und vornehm und wollen nicht mit der Dicken spielen; denn sie ist neu und gemein. Immer, wenn sie eine schöne Musik machen wollen, sagt die Dicke nur: Bong!, mehr kann sie nicht, und alles ist verdorben. Kannst du das verstehen?“
O ja, das konnte Tonio sehr gut verstehen. Einmal in der Woche ging Tonio nämlich mit seiner Mutter in den Harmonie-Cirkel der Kirchengemeinde Sankt Martin, da machten sie auch Musik und sangen Lieder. Und wenn einmal einer den Ton nicht traf, dann zog der Kantor ein schiefes Gesicht, als hätte er Zahnschmerzen. Der dicke Kaiser machte also schräge Töne.
„Aber warum darf er das denn? Warum kann er dort nicht einfach nur hängen und gar nichts sagen? Wenn er doch keine Musik machen kann!“
„Ja, aber er glaubt von sich selbst, er sei die prächtigste Glocke mit der schönsten Musik weit und breit, und weil er der Kaiser ist, kann man ihm das nicht einfach verbieten. Weißt du, ich habe hier manches Mal gesessen und dem Streit unter den Glocken zugehört. Es war grässlich.“
Tonio war ganz aufgeregt. „Kannst du denn hören, was die Glocken sagen? Ich höre aber gar nichts.“
„Man kann sie nicht immer hören. Jetzt zum Beispiel sagen sie auch nichts. Aber wenn sie uns die Stunden anzeigen, dann schlagen sie nur ein einziges Mal und dröhnen danach noch lange fort. Dann kannst du sie belauschen.“ Tonios Vater zog seine Taschenuhr heraus. „Warte, jetzt gleich muss es so weit sein. Aber halte dir die Ohren zu; denn sie sind sehr laut.“
Tonio tat, wie ihm geheißen, und schaute erwartungsvoll auf die Glocken. Es wurde elf Uhr. Vier Mal schlug die Pretiosa an, dann, wuchtig, schauerlich, dass es in Tonios kleinem Kopf schmerzte, elf Mal die Kaiserglocke. Tonios Vater bedeutete seinem Sohn, nun solle er die Hände von den Ohren nehmen und lauschen. Wie Wellen ging der Schall der Glocken noch stark durch die Glockenstube, dann wurde er leiser, verebbte, ward nicht mehr zu hören. Nun nahm Giovanni seinen Sohn auf den Arm und hielt seine Hand auf die Pretiosa. Tonios Hand bebte von den Schwingungen, welche die Bronze noch immer vollführte, und er war ganz betroffen. Nun gingen sie zur Speciosa, die gar nicht geläutet hatte, aber auch sie zitterte unter Tonios Hand, wenngleich viel schwächer. So war es auch bei der kleinen Ursulaglocke und bei der Dreikönigsglocke.
„Sie sprechen miteinander“, flüsterte Giovanni. „Kannst du es auch hören?“ Tonio nickte mit großen Augen und offenem Mund. Dann legte der Vater Tonios Hand auf die Kaiserglocke, und der Knabe zog sie erschrocken zurück. Die Glocke bebte ja, dass sie seine Hand abzureißen drohte! Der Vater nahm seinen Sohn auf den Schoß, und sie setzten sich wieder auf die Steinbank.
„Sie spricht eine andere Sprache, gröber und lauter, und das wollen die anderen nicht leiden. Deswegen unterhalten sie sich nur im Flüsterton, damit der dicke Kaiser nichts versteht. Sie mögen ihn nicht, weil er so laut und so grob und so falsch ist. Er weiß das, aber er kann nicht mittun bei diesem leisen Gespräch. Er kennt keine leisen Töne, er kann sie nicht hören, und er kann sie nicht sagen. Und darum ist immer Streit in dieser Glockenstube.“