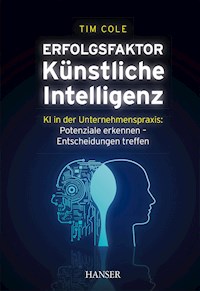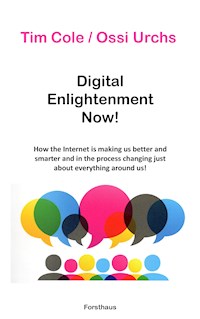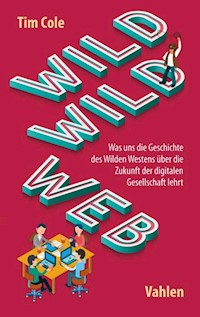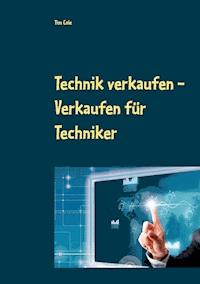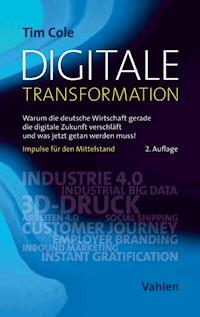Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist schick geworden, das Internet und die digitale Vernetzung für allerlei Übel der Menschheit verantwortlich zu machen. Kulturpessimisten diagnostizieren eine aufkommende „digitale Demenz“ und zeichnen das düstere Bild einer Zukunft, in der Menschen aufhören, selbstständig zu denken. Die Internet-Experten Tim Cole und Ossi Urchs vertreten eine radikal andere Position: Das Internet macht uns klüger. Wer alle Möglichkeiten der Vernetzung ausschöpft, kann sich mit anderen zusammentun, um Missstände der Politik anzuprangern, kann Unternehmen gründen und gemeinsam mit anderen an sozialen Projekten arbeiten. Wir sind der Digitalisierung nicht hilflos ausgeliefert, wir können sie sinnvoll gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ossi Urchs & Tim Cole
DIGITALE AUFKLÄRUNG
Warum uns das Internet klüger macht
Inhalt
Vorwort: Über die Beschleunigung des Alltags
Ich bin ich, und ich bin da!
Digitalisierung bringt Märkte in Bewegung
Vernetzung bedeutet immer Veränderung
1. Warum wir eine »digitale Aufklärung« brauchen: 10 Thesen
Was uns die Teekanne lehrt
Das Neue verstehen
Zehn Thesen zu einer digitalen Aufklärung
Kategorien für eine neue Aufklärung
2. Vergangenheit und Zukunft der Vernetzung
Die Lehre der Spinne
Vernetzung ohne Netzwerk
Metcalfes Vermächtnis
Leben im Schwarm
3. Denken in Echtzeit
Digital Natives sind keine neue Generation
Digitalisierung verändert die Wahrnehmung (der Umwelt und meiner selbst)
Multitasking ist keine Körperverletzung
4. Der vernetzte Mensch
Wie die digitale Vernetzung uns verändert
Warum Ballerspieler friedliche Menschen sind
Evolution im Zeitraffertempo
Der sechste Kondratieff
Der Generationenkonflikt findet nicht statt
Neophobe und Neophile
Ein einig Volk von Onlinern
5. Generation jetzt
Digitale Schnullerbabys
Willkommen in der Facebook-Gesellschaft
Die Welt ist »meins«
Social Media 2.0: Zeitverwendung statt Zeitverschwendung
Kein Leben ohne Facebook
Jeder ist Pressesprecher
6. Der neue Lebensplan
Feierabend war gestern
Arbeit ohne Grenzen
Digitalisierung versus Industrialisierung
Digitaler Beduine sucht digitale Oase
7. Die Zukunft des Privaten – das globale Dorf
Pulcinellas Geheimnis und die Erfindung des Privaten
Alles ist öffentlich
Digitale Omertà
Der Rumpelstilzchen-Effekt
Im Schutz des digitalen Schleiers
Agenten, Avatare und digitale Diskretion
Anonymität als Menschenrecht
8. Information will frei sein
Schwarze Löcher im Internet
Das neue Rechtsempfinden
Ein Drehbuch für Raubkopierer
Kunst ohne Copyright – Copyright ist keine Kunst
Ist geistiges Eigentum Diebstahl?
Alte Inhalte in neuem Kontext
Information ohne Zusammenhang
Blogger – Amateurjournalisten auf dem Vormarsch
Der Journalist als Auslaufmodell
9. Das Erdbeben von New York
Die Angst vor der Freiheit
Der Bote lebt gefährlich
Das Erbe der Twin Towers
Die Überwacher überwachen!
10. Das Ende der Utopien
Politik in Echtzeit: Von Hacktivismus zur Helvetisierung
Digitale Kleinstaaterei
Heilslehren waren gestern
Die Zukunft der Intelligenz
11. Selber denken!
Neue Begriffe für eine neue Ethik
Alles wird klar
Zukunftsziel Offenheit
Autonomie als Systemelement
Nachwort: Wie dieses Buch entstand
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
© 2013 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Lektorat: Martin Janik
Herstellung: Andrea Stolz
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
ISBN 978-3-446-43673-2
E-Book-ISBN 978-3-446-43821-7
VORWORT: ÜBER DIE BESCHLEUNIGUNG DES ALLTAGS
Im Kinderbuch Alice hinter den Spiegeln lässt der Autor Lewis Carroll seine kleine Heldin von der Königin an die Hand nehmen, die daraufhin losrennt und das Kind so lange hinter sich herzerrt, bis es vor Erschöpfung stehen bleibt und sich wundert, dass sie beide immer noch auf dem gleichen Fleck stehen wie vorher. »Bei uns kommt man meistens irgendwo hin, wenn man lange Zeit so schnell rennt wie wir gerade«, sagt sie keuchend. »Ein langsames Land ist das!«, sagt die Königin. »So schnell wie du muss man hier schon rennen, um bloß auf der gleichen Stelle zu bleiben. Wenn du irgendwo hinkommen willst, musst du mindestens doppelt so schnell laufen.«
Willkommen im Land hinter dem Bildschirm, wo man irgendwie das Gefühl hat, alles liefe viel schneller ab, als man es mitbekommen und verstehen kann, und wo sich der Fortschritt im Zeitraffertempo abzuspielen scheint. Das Internet hat uns eine völlig neue Zeiteinheit beschert: Internet-Jahre, von denen zwischen sechs und neun angeblich einem Menschenjahr entsprechen. Womit sie eine gewisse Ähnlichkeit mit Hundejahren haben, die ja auch viel schneller ablaufen sollen als unsere.
Viele von uns haben damit so ihre Probleme, nicht nur die Betagteren unter uns. Es geht wohl weniger um Alter als um Anpassungsfähigkeit, um Flexibilität und um Aufgeschlossenheit für neue Dinge. Wohl an keinem Beispiel wird das deutlicher als bei Twitter. Die Menschheit unterteilt sich in Bezug auf diese winzigen »Telegramme aus dem Internet«, wie der Nachrichtendienst einmal beschrieben wurde, in zwei unversöhnliche Lager: die einen, die Twitter für so ziemlich das Dämlichste halten, was ihnen je untergekommen ist (»99 Prozent Mist«) und die anderen, für die Twitter nichts Geringeres ist als eine Revolution in der Kommunikationstechnik.
Zur Erinnerung: Per Twitter ist es möglich, Nachrichten von maximal 140 Zeichen Länge vom PC oder unterwegs per Handy abzusetzen, die zunächst einmal auf der Website www.twitter.com dargestellt werden. Da mittlerweile pro Stunde viele Millionen solcher »Tweets«, wie die Superkurztexte heißen, geschrieben werden, kann kein Mensch sie alle lesen. Deshalb sucht man sich diejenigen Twitter-Autoren aus, denen man »folgen« möchte, so wie weiland die Jünger Jesus gefolgt sind. Sie heißen im Englischen auch genauso, nämlich »follower«, was auch so viel wie »Anhänger« oder »Fan« bedeutet. Das heißt: Ich sehe nur die Texte, die von den Menschen stammen, denen ich »followe«, wie es Neudeutsch heißt.
Es ist erstaunlich, wie viel Geistreiches sich in 140 Zeichen packen lässt, aber natürlich auch wie viel aberwitzig Dummes. Das mit den 99 Prozent Mist kommt ungefähr hin – aber wegen des einen Prozents lohnt sich die ganze Mühe, jedenfalls für die Anhänger von Twitter. Und die sind seltsamerweise zu einem erstaunlich hohen Anteil ältere Menschen. Wir meinen damit die Generation der »Babyboomer«, also diejenigen, die entweder langsam ins Rentenalter kommen oder bereits ihr berufliches Ablaufdatum erreicht haben. Da lässt zum Beispiel einer, der sich »@lusches« nennt und von Beruf Metzgermeister im Oldenburgischen ist, täglich Dutzende von Tweets vom Stapel, in denen es um Bratwürste und Bauernbraten, um Salzgraslamm und Partyservice geht. Klar: Der Mann hat eigentlich beruflich alle Hände voll zu tun und findet trotzdem noch Zeit zum Online-Zwitschern.
Ich bin ich, und ich bin da!
Bei Twitter ist es gerade die Mischung aus Selbstmitteilung und Echtzeitkommunikation, die viele fasziniert. »Ich bin ich, und ich bin da!«, lautet die Kernbotschaft dieses neuen Mediums – das neueste in einer Reihe von technischen Innovationen, die uns Menschen einander immer näher bringen. Zugleich setzen sie uns aber auch unter neuen Druck. Jeder Kommunikationsversuch, jede E-Mail, jede SMS, jede Twitter-Nachricht ist zugleich ein Hilferuf aus dem digitalen Jenseits: Hier ist ein Mensch, der will zu dir! Ich habe Kommunikationsbedarf, also heb bitte ab, antworte, schicke mir etwas zurück, rede mit mir! Und weil wir so sind, wie wir sind, reagieren wir auch auf fast jeden Versuch der kommunikativen Kontaktaufnahme. »Ich bin gerade in einem Meeting«, sagte mir neulich jemand, den ich am Handy angerufen hatte, aber er redete trotzdem volle fünf Minuten mit mir. Was die anderen Teilnehmer wohl so lange gemacht haben? Wahrscheinlich E-Mails beantwortet oder SMS-Texte getippt.
Wir spüren es ja am eigenen Leibe: Das Lebenstempo ist schneller geworden. Wir sitzen angekettet auf der Bank und rudern zu einem Takt, dessen Schlagzahl ständig steigt, und wir sehen nicht den Mann an der Trommel, der sie uns vorgibt. Wir sind alle kleine Alices, die so schnell laufen, wie sie können, nur damit wir auf dem gleichen Fleck bleiben und nicht zurückfallen.
»The Age of Acceleration« nennt der Amerikaner Ray Kurzweil dieses Phänomen. Er glaubt, dass wir sogar erst am Anfang dieser Entwicklung stehen. »Dank exponentiellem Wachstum wird der Fortschritt im 21. Jahrhundert dem von 20000 Jahren Fortschritt im bisherigen Tempo entsprechen«, schreibt er in Homo [email protected]
Das Problem ist nur: Der Mensch lebt linear. Und insgeheim »weiß« jeder von uns, dass exponentielle Modelle irgendwann kollabieren, weil sie im Grunde nichts anderes sind als Kettenbriefe. Wenn die Kurven langsam ansteigen und dann irgendwann steil nach oben ragen, scheint es so, als ob die Gesetze der Schwerkraft ausgeschaltet worden wären. Sind sie aber nicht, wie wir alle in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends erleben mussten, als nämlich die wunderbare Scheinwelt der »New Economy« auf einmal wie eine Seifenblase platzte und das ganze schöne Geld, das Wachstum und Wohlstand für alle bringen sollte, auf einmal in einem schwarzen Loch verschwand, so wie der Hase in Alice im Wunderland.
Was uns auf einem Umweg zurückbringt zu der Geschichte von Alice und der Frage, wie schnell man rennen muss, um nicht hoffnungslos zurückzufallen, geschweige denn, welches Tempo wir vorlegen – und vorleben – müssen, um vorwärtszukommen. Niemals war diese wundervolle kleine Geschichte von Lewis Carroll wertvoller als heute, um zu verstehen, welche Veränderungen unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit gerade im Internet-Tempo ablaufen.
Digitalisierung bringt Märkte in Bewegung
Das wird sofort deutlich, wenn wir uns den »Megatrend« der letzten Jahrzehnte anschauen. Die Rede ist von der Digitalisierung. Alles, was sich digitalisieren lässt, wird auch digitalisiert. Und zwar aus einem einfachen Grund: Digitalisierung bedeutet, wirtschaftlich betrachtet, immer einen Preisverfall. Damit wird klar: Digitalisierung ist ein mächtiger Marktfaktor, der großen Einfluss hat auf zahlreiche Bereiche des Lebens und der Wirtschaft.
Das trifft für den Vergleich vordigitaler Produkte mit ihren digitalen Nachfolgern ebenso zu wie für die Preisentwicklung digitaler Waren im Laufe der Zeit: Wer vor Jahrzehnten eine Langspielplatte käuflich erwerben wollte, musste mit der damals üppigen Summe von 20 D-Mark rechnen. 20 Jahre später war für eine (»teildigitale«) CD immer noch ein recht stolzer Preis zu entrichten, vielleicht 15 Euro. Wer aber heute überhaupt noch bezahlt, wenn er digitale Musik per Download aus dem Web bezieht, braucht dafür kaum mehr als ein paar Cent zu investieren.
Digitale Produkte werden immer billiger, weil die variablen Kosten beim Vertrieb der Ware gegen null gehen. Und das betrifft nicht nur Verpackung und Logistik, sondern auch Lagerhaltung und Verkaufsflächen, um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen. Deswegen kann Amazon heute nicht nur bei digitalen, sondern auch bei »analogen« Produkten im Wettbewerb mit herkömmlichen stationären Händlern immer wieder mit Preisvorteilen punkten. Einfach weil das gesamte Geschäftsmodell des Online-Versenders auf der Digitalisierung wesentlicher Geschäftsbereiche beruht.
Dieser Preisverfall führt notwendig zu einem verschärften Wettbewerb am Markt, dem die Anbieter, nicht nur Online-Händler, sondern zunehmend auch die Hersteller selbst, zu begegnen versuchen, indem sie immer direktere Beziehungen zu den Endkunden aufbauen, um so möglichst viele der nicht unbedingt zur Wertschöpfung benötigten Vermittlerfunktionen im Markt auszuschalten. Ermöglicht werden solche Strategien durch einen Grad der Vernetzung von bislang unbekanntem Ausmaß, und zwar sowohl global wie persönlich.
Digitalisierung bedeutet aber nicht nur Preisverfall am Markt für digitale Waren. Sie bringt auch eine unglaubliche Beschleunigung der Technologie- und damit einhergehend der Medienentwicklung. Von Gutenbergs »Erfindung« des Buchdrucks mit variablen Typen 1453 in Mainz (die in China schon mindestens 500 Jahre vorher bekannt war) bis zur massenhaften Verbreitung gedruckter Medien, die man mit dem Aufkommen der ersten Tageszeitungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts ansetzen könnte, dauerte es noch etwa 350 Jahre. Bis sich Tim Berners-Lees Konzeption des World Wide Web 1989 am CERN in Genf zu einem »Massenmedium neuen Typs« entwickelt hatte, vergingen gerade noch fünf Jahre. Wobei er den größten Teil dieser Zeit dafür benötigte, das CERN davon zu überzeugen, sein Konzept eines weltweiten Webs direkt in die »Public Domain« zu übergeben, um es der weiteren Entwicklung und allgemeinen Nutzung zuzuführen.
Die Idee von »TBL«, wie Tim Berners-Lee in Internet-Kreisen gerne genannt wird, nämlich die Wissenschaftler am CERN und ihre Forschungsergebnisse besser und effizienter zu vernetzen, beruhte auf damals längst bekannten und etablierten Technologien, vor allem auf »Hypercard«, einer Software, die es erlaubte, auf einem Computer Karteikarten zu simulieren, deren Inhalte mit anderen Karten durch einen sogenannten »Link« verknüpft werden konnten. Das Geniale war, dass er diese Verlinkung nicht nur auf einem einzelnen Computer oder dessen Festplatte nutzen wollte, sondern dass er verstand, welches Potenzial diese Verlinkung entfalten würde, wenn sie erst mal auf allen Workstations am CERN realisiert würde, die damals schon durch ein TCP/IP-Netzwerk miteinander verbunden waren. Um das zu ermöglichen, musste er lediglich ein neues Zusatzprotokoll zum »TCP/IP-Stack« schreiben, das heute weltberühmte »HTTP«. Und das schaffte er in ein paar Tagen.
Die dramatische Veränderung, die die Entwicklung des Web prägte und von allen anderen Softwareprojekten vorher unterschied, war die Strategie der Entwicklung auf der Grundlage offener und allgemein zugänglicher Standards. Und die führte nicht nur zu einer neuen Qualität der Produktionsgeschwindigkeit, sondern auch der Ergebnisse der Entwicklungsanstrengungen des einzelnen Wissenschaftlers. Ähnliche Ergebnisse können aber auch Unternehmen erzielen, deren Mitarbeiterzahl per definitionem endlich ist. Diese Entwicklungsstrategie auf der Basis offener Standards unterscheidet das Internet von anderen, traditionellen Massenmedien, und zwar sowohl quantitativ, also in der Geschwindigkeit seiner Entwicklung und Verbreitung, als auch qualitativ, nämlich in der »Offenheit« der Strategien, also ihrer Fähigkeit, neue Technologien und Anwendungen zu integrieren.
Genau dieser Entwicklungsstrategie folgte Tim Berners-Lee, als er die offenen Standards der Internet-Technologie, die sogenannten Internet-Protokolle nutzte, um auf deren Grundlage seine eigenen, entscheidenden Beiträge zur Entwicklung des World Wide Web zu realisieren. Mittels des »Hypertext Transfer Protocol« (HTTP) kann jeder Nutzer im Netzwerk eine Anfrage an einen (Web-)Server stellen, die der Server mithilfe des gleichen Protokolls durch die Auslieferung der gewünschten Daten beantwortet.
Zur Darstellung der in (IP-)Paketen versandten Daten auf der Client-Seite nutzte Berners-Lee die Standards sogenannter »Auszeichnungssprachen«. Mit deren Hilfe entwickelte er seine vergleichsweise unkomplizierte »Hypertext Markup Language« (HTML), eine Sprache zur Darstellung der übermittelten Daten auf einer digitalen »Seite« – eine Metapher, die an die vordigitale Art der Präsentation von Daten auf einer Dokumenten- oder Buchseite erinnert.
Damit hatte Berners-Lee nicht nur alle wesentlichen Elemente zur Übermittlung und Darstellung der Daten im Web in rekordverdächtiger Zeit entwickelt; durch die Nutzung »offener« Standards war auch jederzeit gewährleistet, dass das System bei Bedarf weiterentwickelt werden konnte, sodass heute nicht nur Text- und Grafikdaten, sondern eben auch Sprach- oder Videodaten in »Echtzeit« (!) per Web übermittelt und dargestellt werden können. Designer können sich nicht nur immer neue Gestaltungsformen für die Darstellung der Daten einfallen lassen: Techniker und Entwickler können ihnen auch immer neue Funktionen und »Logiken« mit auf den Weg zum Nutzer geben. Das Web erweist sich damit als ebenso anpassungs- wie entwicklungsfähiges System und gerade darin allen anderen Massenmedien überlegen.
Diese mit der Digitalisierung und der globalen Vernetzung einhergehende Beschleunigung produziert oder begünstigt doch wenigstens auch sogenannte »disruptive« Entwicklungen, also Technologien und Produkte, die etablierte Märkte und die sie beherrschenden Unternehmen buchstäblich aus den Angeln heben können.
So sahen sich beispielsweise die Hersteller von Autonavigationssystemen noch vor wenigen Jahren in einer ausgesprochen komfortablen Situation: Sie konnten mit relativ einfachen technischen Geräten sowie einer zugegeben relativ komplexen Software an einem schier explodierenden Markt fantastische Preise erzielen. So lange, bis Google die eigenen digitalen Karten angereichert mit der dazupassenden Navigationssoftware in das kostenlose Smartphone-Betriebssystem »Android« integrierte. Damit änderte sich diese Situation schlagartig. Eine ganze Industrie mit einem ehemals florierenden Geschäftsmodell hörte de facto auf zu existieren, weshalb der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt nicht ohne Zynismus den Markt für Navigationsgeräte gern als »Zero Billion Dollar Industries« beschreibt.
Vernetzung bedeutet immer Veränderung
Der zweite Großtrend, der mit dem Trend zur Digitalisierung unmittelbar verbunden ist, ist die globale Vernetzung und die dadurch ausgelöste permanente Veränderung. Diese betrifft beileibe nicht nur die technischen Systeme selbst, sondern alles, was mit diesen vernetzten Systemen in irgendeinem Zusammenhang steht: Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle und Marktentwicklungen, aber auch die Menschen selber, die an diesen vernetzten Systemen arbeiten oder damit kommunizieren. Alles unterliegt dem Imperativ der digitalen Veränderung. Darüber wird in diesem Buch noch viel zu reden sein.
So, wie Digitalisierung immer Beschleunigung bedeutet, bedeutet Vernetzung immer Veränderung. Sie liegt geradezu im Wesen der Vernetzung begründet. Ein gutes Beispiel dafür, wie Vernetzung zu Veränderung führt, stammt von Vinton Cerf, einem der Erfinder des TCP/IP-Protokolls und somit einem der Väter des Internets. Was passiert, fragte Cerf, wenn wir einen Internet-fähigen Kühlschrank mit einer ebenfalls Internet-fähigen Personenwaage vernetzen? Es verändert sich etwas. Sie kommen abends nach Hause, und der Kühlschrank ist nicht mehr zu öffnen oder er enthält nur noch Diätkost, weil die beiden sich einig geworden sind, dass Sie lieber ein paar Tage abnehmen sollten.
Vernetzung führt zwangsläufig zu Veränderung, auch im Unternehmen. Nur ist nicht immer sofort offensichtlich, wo sie stattfindet und wie groß ihre Tragweite sein wird. Die große Herausforderung besteht für Manager in einer digitalisierten und vernetzten Wirtschaft darin, die Veränderung für das Unternehmen, für ihr Geschäftsmodell und für sie persönlich zu erkennen und darauf ebenso schnell wie adäquat zu reagieren. Wer das am besten und am schnellsten kann, wird zu den Gewinnern zählen. Die Langsamen werden unter die Räder kommen.
Digitalisierung und Vernetzung sind also die komplementären Kräfte, die die exponentielle Beschleunigung, nicht nur der Technologieentwicklung, sondern unserer gesamten Lebensweise, auf individueller wie gesellschaftlicher Ebene vorantreiben. Willkommen in der Ad-hoc-Gesellschaft!
1. WARUM WIR EINE »DIGITALE AUFKLÄRUNG« BRAUCHEN 10 THESEN
»Die ungeheure Ausdehnung der Erkenntnisse in unserem Zeitalter und die Entstehung neuer Wissenschaften erlauben es uns kaum mehr, das Gültige zusammenzufassen und uns seiner zu bedienen.«
Lawrence Durrell: Justine, 1957
ES IST CHIC GEWORDEN, dem Internet und der digitalen Vernetzung die Schuld zu geben für allerlei Übel der Menschheit. Kulturpessimisten rufen wahlweise die »kognitive Krise« aus wie Frank Schirrmacher1 von der FAZ, diagnostizieren eine aufkommende »digitale Demenz« wie der Nervenarzt und Bestsellerautor Manfred Spitzer2, zeichnen eine düstere Zukunft, die »uns nicht braucht«, wie der amerikanische »Informatik-Künstler« Jaron Lanier3 oder stellen nur scheinbar provozierende Fragen wie »Wer bin ich, wenn ich online bin, und was macht mein Gehirn solange?« wie der Wirtschaftsjournalist Nicholas Carr4 aus Harvard.
Nun, Kulturpessimisten hat es zu allen Zeiten gegeben. Sokrates beklagte laut Platon den Schaden, den die aus Ägypten eingeführte Erfindung der Schrift verursachte, weil die Menschen nichts mehr auswendig lernen würden und ihnen damit »das Vergessen in die Seele gepflanzt« würde. Der britische Philosoph und Naturwissenschaftler Robert Burton warnte im 17. Jahrhundert die Leser seiner Schrift The Anatomy of Melancholy5 vor Büchern, die sich durch die junge Erfindung der Druckerpresse inflationär ausbreiten und so unweigerlich zu einer Frühform des »information overload« führen würden – also zu einer Art analoger Überforderung.
Kulturpessimisten sehen in Wirklichkeit die Informationsgesellschaft sehr simplizistisch, nämlich als eine rein mechanistische Welt. Sie glauben, wenn man die Nutzer nur lange genug mit Informationen überflutet, würden sie aufhören, selbständig zu denken und nur noch fremdgesteuert durchs Leben torkeln. Diese »Kritiker« des Internets können sich nicht vorstellen, dass Menschen sehr wohl die Fähigkeit besitzen – oder dabei sind, diese Fähigkeit zu entwickeln –, haarscharf zwischen relevanten und irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Sie sehen die Menschen als Vieh, das nur stumm wiederkäuen und sich ansonsten von medialen Hirten wie ihnen vorantreiben lassen muss in eine ungewisse, fremdgesteuerte Zukunft.
Was uns die Teekanne lehrt
Einer der Autoren dieses Buches hatte vor vielen Jahren die Ehre, die Villa des inzwischen verstorbenen Panasonic-Gründers Konosuke Matsushita im japanischen Osaka zu besuchen, wo er einer traditionellen Teezeremonie beiwohnen durfte. Eine kleine Frau in einem grünen Kimono goss den Tee mit einer unnachahmlich gleichmäßigen Bewegung aus der Kanne ein. Der Autor kaufte sich später auch so eine Kanne, aber bei ihm ist immer die Hälfte danebengegangen. Offenbar fehlte etwas, das die Japaner »Wa« nennen. »Wa« beschreibt Ruhe und ein inneres Gleichgewicht, das auch Gegenstände und sogar Orte haben können, so wie die Villa von Konosuke Matsushita.
Dem Autor fiel aber eines Tages zu seiner eigenen Verblüffung auf, dass er inzwischen offenbar die Kunst erlernt hatte, fehlerfrei Tee aus einer japanischen Kanne zu gießen. Es ging jedenfalls inzwischen fast kein Tropfen mehr daneben. Was zu der spannenden Frage führt: Hatte der Mensch mit der Zeit gelernt, das Ausgießen zu beherrschen – oder hat vielmehr die Kanne ihm beigebracht, wie man gießen muss?
Das ist keine triviale Frage, denn es geht spätestens seit der Diskussion über »Ich-Ermüdung« und digitale Überforderung im Kern um die Selbstbestimmung des Menschen, und in diesem Zusammenhang konkret darum, ob der Mensch Herr des Computers ist oder umgekehrt. Sagt uns Google, was wir denken dürfen? Ist Multitasking eine wünschenswerte Anpassung des Menschen an eine neue Kommunikationsumgebung, oder ist es Körperverletzung, wie Schirrmacher schreibt? Anders formuliert: Sind wir Getriebene oder bewusst handelnde und denkende Wesen, eine Spezies, die besonders gut in der Lage ist, neue Lebensumstände zu adaptieren und damit auf Veränderung zu reagieren?
Unser Freund Norbert Bolz, Ordinarius an der TU Berlin und der postmoderne »Philosoph« unter den Medienwissenschaftlern in Deutschland, hat eine recht überzeugende Antwort gefunden. Er schreibt im Czyslansky-Blog:
»Immer mehr Menschen verzweifeln an der Aufgabe, die eigene Aufmerksamkeit zu managen. Dabei geht es um die so einfach klingende Frage: Was ist wirklich wichtig? Um hier überhaupt zu einer Antwort zu kommen, müssen wir Komplexität reduzieren. Auf der Suche nach Orientierung bieten die neuen Medientechniken Filter, aber am Ende geht es doch um die menschliche Urteilskraft. Produziert also digitales Lesen digitale Gehirne? Hinter dieser Frage versteckt sich die neueste Gestalt des Kulturpessimismus ...«
Die ablehnende Haltung Einiger gegen Internet und Digitalisierung ist in der Geschichte des Nachdenkens über das Denken weder besonders neu noch gar originell, wie schon die wenigen hier angeführten Beispiele belegen. Dennoch vermag sie immer wieder, insbesondere zu Zeiten grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandels, eine große Anzahl von Menschen anzuziehen.
Wir wollen mit diesem Buch nicht in die Diskussion einsteigen, ob das menschliche Gehirn nicht doch in gewisser Weise »digital« funktioniert, wofür vieles spricht, wie Kognitionswissenschaftler und Neurophysiologen beeindruckend darlegen können. Uns geht es vielmehr darum, den »Kulturpessimismus« von Sokrates bis Schirrmacher zu widerlegen und den Anstoß zu liefern für das, was wir »digitale Aufklärung« nennen, eine neue geistige Anstrengung und eine notwendige Voraussetzung, um als Mensch und als Gemeinschaft den Übergang in die digitale Gesellschaft erfolgreich absolvieren zu können.
Das Neue verstehen
Der großartige amerikanische Denker und Literat Robert Anton Wilson charakterisiert die Menschen, indem er zwischen »neophoben«, die das Neue und Unbekannte immer wieder in Angst und Schrecken versetzt, und »neophilen«, die beidem mit Neugier und Lust an der Entdeckung begegnen, unterscheidet. Eine solche Unterscheidung kann hier ebenso hilfreiche wie vergnügliche Impulse liefern. Aber sie hilft uns noch nicht, den Prozess radikaler Veränderungen zu verstehen, den wir alle miteinander gerade durch Digitalisierung und Vernetzung erleben, um ihn dann auch produktiv nutzen zu können. Wir wollen also dazu anregen, die »Zeichen der Zeit« als wirklich neue zu begreifen, statt sie mittels alter Vorstellungen zu bewerten, egal ob positiv oder negativ.
Nicht dass wir nicht dabei sind, unsere Gehirne alle neu zu programmieren. Wilson nennt das »metaprogramming the human bio-computer«. Das tun wir ständig. »Jedes Mal, wenn wir ein neues Faktum lernen oder uns eine neue Fähigkeit aneignen, ändert sich die Verdrahtung unseres Gehirns«, schreibt Steven Pinker, Harvard-Professor für Psychologie in der New York Times6. Aber neuronale Plastizität bedeutet nicht, dass unsere Gehirne Tonklumpen sind, die durch Erfahrungen in eine neue Form gepresst werden. Erfahrung vermindert nicht die grundlegende Fähigkeit des Gehirns zur Verarbeitung von Informationen. Im Gegenteil: Sie befördert sie!
Was uns zurückbringt zur Frage nach der digitalen Überforderung des Menschen. Wir halten die Vorstellung, dass sich unsere Gehirne zurückbilden oder dass wir sie gar verstümmeln könnten, weil wir uns ständig einer steigenden Zahl von Informations- und Kommunikationsreizen aussetzen, für geradezu menschenverachtend. Das Gehirn bildet sich nicht zurück, es bildet sich weiter. Homo sapiens ist das Produkt eines jahrtausendelangen Anpassungsprozesses, der natürlich niemals abgeschlossen sein wird, sondern immer weitergeht – wohin auch immer.
Das Beispiel der Teekanne verdeutlicht das, was wir sagen wollen: Natürlich hat die Teekanne Einfluss auf ihren »Nutzer« gehabt. Sie hat ihm eine neue Fähigkeit beigebracht, seine Hand-Augen-Koordination verbessert und ihm geholfen, den Vorgang des Einschenkens mit dem nötigen »Wa« auszuführen. Womöglich sind dabei Millionen von Synapsen in seinem Gehirn neu vernetzt oder umprogrammiert worden. Er war also Gegenstand eines Eingriffs in seine Persönlichkeit. Aber er war kein wehrloses Opfer, sondern war aktiv an diesem Vorgang beteiligt.
Mit den folgenden Thesen wollen wir, ganz im Geiste der klassischen europäischen Aufklärung, einen Denkprozess einleiten und darüber hinaus einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen. Es geht uns darum, das Neue, das wir heute in immer kürzeren Abständen erleben, auch als etwas wirklich Neues zu denken, uns also jenseits herkömmlicher Vorstellungen und Begriffe zu bewegen, um so gerüstet in einen gesellschaftlichen Diskurs eintreten zu können, auch und gerade darüber, ob und wie uns dieses Neue nützlich sein könnte, oder ob wir es als untauglichen Irrweg besser auf die Müllhalde der Geschichte expedieren sollten.
Zehn Thesen zu einer digitalen Aufklärung
THESE 1
Alles was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Alles, was sich vernetzen lässt, wird vernetzt. Und das verändert alles!
Der Megatrend zur Digitalisierung hat, wie bereits in der Einleitung kurz dargestellt, vor allem wirtschaftliche Gründe, die weltweit unter dem griffigen, wenn auch irreführenden Titel »Moore’s Law« bekannt geworden sind. Denn eigentlich hat das, was Gordon E. Moore, einer der Gründer von Intel, schon 1965 erkannte, weniger den Charakter eines (Natur-)Gesetzes als den einer Hypothese, die sich allerdings bis heute als durchaus tragfähig erwiesen hat.
Moore beschreibt mit seinem »Gesetz« lediglich die Eigenschaft digitaler Geräte, ihre Kapazität ziemlich genau alle zwei Jahre zu verdoppeln, also exponentiell zu erhöhen. Implizit bedeutet dieses exponentielle Wachstum (das uns auch an anderer Stelle immer wieder begegnen wird) aber auch eine Halbierung der Kosten digitaler Rechenleistung. Und genau dies ist, mehr noch als andere Faktoren, wie der Wegfall variabler Kosten, der eigentliche Treiber des Preisverfalls in allen Märkten, die von der Digitalisierung erreicht und verändert werden. Dieser Preisverfall betrifft also nicht nur Mikroprozessoren und digitale Speichermedien, sondern auch Kühlschränke und Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Telefone, um nur wenige Beispiele für Produkte zu nennen, die heute von Mikroprozessoren gesteuert werden. Indirekt erreicht der Preisverfall digitaler Produkte sogar die Distributionslogistik und andere Dienstleistungen, die zunehmend digital gemanagt werden.
Und wie immer, wenn Märkte von einem derartigen Preisverfall erreicht werden, bemühen sich die Anbieter um möglichst direkte Beziehungen zu ihren Kunden, mit dem Ziel, alle, die nicht unmittelbar an der Wertschöpfung beteiligt sind, aus diesem Zusammenhang auszuschließen. Ermöglicht werden solch direkte Beziehungen heute durch einen Grad weltweiter Vernetzung von Herstellern und Händlern, Märkten und Kunden, wie wir ihn uns alle noch vor wenigen Jahren nicht hätten vorstellen können. Und beides zusammen, die immer weiter fortschreitende Digitalisierung einhergehend mit der globalen Vernetzung von Märkten und Menschen, hat in den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur die gesellschaftlichen, sondern eben vor allem die wirtschaftlichen Verhältnisse »zum Tanzen« gebracht.
THESE 2
Digitalisierung und Vernetzung sind kein Schnupfen: Sie gehen nicht wieder weg!
Digitalisierung und Vernetzung haben die ganze Art, wie wir leben und arbeiten, wie wir lernen und spielen, wie wir einkaufen und miteinander Geschäfte machen, wie wir uns unterhalten, insbesondere aber die Art, wie wir kommunizieren, ganz grundsätzlich verändert. Kaum ein Lebensbereich und immer weniger Menschen bleiben von diesen buchstäblich fundamentalen Veränderungen ausgeschlossen. Und deshalb ist auch damit zu rechnen, dass uns diese Entwicklungen, zumindest auf absehbare Zeit, erhalten bleiben werden.
THESE 3
Die digitale und die reale Welt durchdringen sich immer mehr. Das verändert beide mit rasender Geschwindigkeit und in einem bisher unvorstellbaren Maß.
Wenn technische und wirtschaftliche Entwicklungen erst einmal das gesellschaftliche wie das persönliche Leben tief greifend verändert haben, dann lassen sie sich kaum mehr ungeschehen machen: Das Rad der Geschichte kann man bekanntlich nicht zurückdrehen. Zumal sich im Zuge dieser Entwicklung ein weiteres, ebenso merkwürdiges wie bemerkenswertes Phänomen eingestellt hat: Waren bis vor wenigen Jahren noch die digitale und die »reale« Welt fein säuberlich voneinander getrennt, so haben beide inzwischen begonnen, sich mehr und mehr gegenseitig zu durchdringen.
So weisen uns Navigationsgeräte nicht einfach den Weg: Die von ihnen bereitgestellten digitalen Informationen erlauben uns erst den »richtigen«, den schnellsten oder den schönsten Weg zu wählen. »Augmented Reality« bedeutet in der Übersetzung nicht einfach eine »Anreicherung« unserer Wirklichkeit: Das, was wir als »Wirklichkeit« erleben und verstehen, wird tatsächlich in zunehmendem Maß aufbereitet und vermischt mit unseren Eindrücken aus der »virtuellen« Welt, angereichert mit zusätzlichen Informationen und angezeigt auf einem Smartphone oder durch neuartige »wearable« Computer, etwa spezielle Brillen, wie Googles Projekt »Glass«. So entsteht gerade eine neuartige, digitale »Infosphäre«, die mehr und mehr Dinge in unserer unmittelbaren Umgebung genauso umgibt wie den ganzen Planeten.
Das bedeutet keineswegs, dass wir alle in Zukunft wie Zombies hilflos den Anweisungen unserer digitalen Bewegungshilfen folgend durch die Welt irren werden. Im Gegenteil müssen und werden wir lernen, Relevanz zu beurteilen, also Informationen so zu filtern, dass sie uns hilfreich und nützlich sind. Sollten sie uns ablenken oder gar stören, werden wir die entsprechende Informationsquelle einfach ausschalten.
Aber wenn wir die Infosphäre abschalten, werden wir das mit der gleichen Haltung tun, die es uns auch heute noch erlaubt, einen Stummfilm anzuschauen und zu genießen. Der bewusste Verzicht eröffnet uns die Möglichkeit eines ebenso asketischen wie ästhetischen Genusses. Es fehlt also nicht einfach eine Dimension des (Multi-)Mediums, sondern diese Reduktion erhöht unsere Konzentration auf andere Aspekte. Wobei wir wohl wissen, dass wir immer und jederzeit in der Lage sein werden, zusätzliche Dimensionen per Knopfdruck wieder zu aktivieren.
THESE 4
Digitalisierung und Vernetzung schaffen technisch und gesellschaftlich, kulturell und wissenschaftlich neue Bedingungen. Sie gilt es in Kategorien zu fassen und als Qualitäten zu verstehen.
Damit hat sich bereits weitgehend das verändert, was wir für wirklich halten, genau wie die Bedingungen, unter denen wir die neue Realität erleben. Ist ein Computerspiel weniger real als die Schnitzeljagd im Wald? Ist eine Facebook-Romanze etwas anderes als ein Flirt an der Bar? Obwohl der binäre Code uns nahezulegen scheint, allein zwischen »an« und »aus« zu unterscheiden, zwischen »real« und »irreal«, haben wir doch offenbar längst gelernt, die Welt gerade mit der Hilfe digitaler Informationen differenzierter, ja granularer und modularer zu verstehen, ohne, so ist jedenfalls zu hoffen, ihre grundlegende Einheit im Sinne der ihr eigenen vernetzten Existenzweise zu übersehen oder gar zu vergessen.
Digitalisierung und Vernetzung verändern offensichtlich die gesamte Art und Weise, wie wir Realität erleben, verstehen und verarbeiten. Doch damit nicht genug: Auch die Bedingungen, unter denen wir das tun, sind andauernd fortschreitenden Veränderungen ausgesetzt. Und zwar so schnell und dynamisch, dass wir unter dem Eindruck des immer wieder neuen Geschehens um uns herum drohen zu vergessen, es auch gedanklich und begrifflich zu erfassen. Wir brauchen also angesichts der neuen Entwicklungen und Erscheinungen, ob sie sich nun im Bereich der Wissenschaft oder der Technologie, gesellschaftlich oder kulturell zeigen und ausprägen, erst eine Begrifflichkeit, die ihnen auch gerecht wird. So wie Newtons Mechanik nicht zur Beschreibung der Quantenphysik taugt, so helfen auch Vorstellungen und Begriffe der vergangenen Jahrhunderte herzlich wenig bei der Beschreibung der digital vernetzten Gegenwart.
THESE 5
Massenmedien verlieren mit dieser Entwicklung nach 150 Jahren ihre gemeinschafts- und identitätsstiftende Funktion. Dadurch kehrt die Kommunikation gewissermaßen zu ihrem Ursprung zurück: zum interpersonalen Austausch, der heute allerdings zunehmend digital und medial vermittelt stattfindet.
Erschwerend kommt bei dieser bevorstehenden »Neuformatierung« der Gesellschaft der Umstand hinzu, dass uns die bekannten Leitplanken und Orientierungshilfen zur Erfassung einer sich dramatisch verändernden Wirklichkeit abhandengekommen sind. Und das betrifft nicht etwa nur Religionen und andere Glaubenssysteme, seien sie eher (natur)wissenschaftlicher oder philosophischer Natur, sondern in ganz besonderem Maße die meinungs- und gemeinschaftsstiftende Funktion der alten Massenmedien.
Konnte man noch vor wenigen Jahren – wie ein deutscher Ex-Kanzler – davon ausgehen, dass man morgens nur die Bild-Zeitung lesen müsse, um zu wissen, was Deutschland am Abend glauben würde (oder wenigstens glauben sollte), so trifft das heute gleich aus mehreren Gründen nicht mehr zu. Zum einen hat die meinungsbildende und gemeinschaftsstiftende Qualität der Inhalte, ob sie nun gedruckt oder elektronisch unters Volk gebracht werden, unter dem Preisverfall der digitalen Waren und Inhalte dermaßen gelitten, dass sie als »Leit-Bild« schlechterdings untauglich geworden sind. Insofern dürfte die Pleite namhafter Zeitungstitel wie der Frankfurter Rundschau oder der Financial Times Deutschland nur ein erster Vorbote des großen Zeitungssterbens sein, wie es in den USA längst begonnen hat.