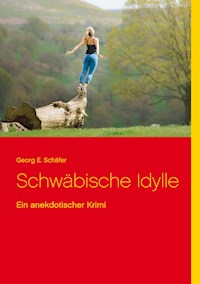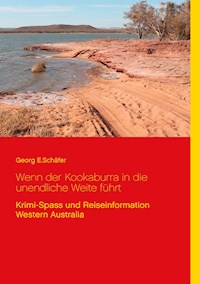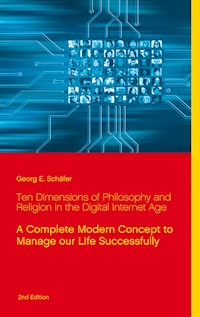Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Digitalisierung kommt und wird unser Schicksal der nächsten Jahrzehnte bestimmen. Wir müssen die Digitalisierung gestalten. Sie bietet ungeahnte neue Möglichkeiten, sie kann unsere Fähigkeiten enorm erweitern. Sie kann uns andererseits in einen Lebensweg pressen, ohne dass wir einen Ausweg finden. Doch was ist zu tun? Verstehen und Technik bewusst anwenden, muss unser Motto heißen, in einer Welt der potentiell unendlichen Chancen und Herausforderungen. In der Arbeit, der Freizeit und im Privatleben dominiert die Digitalisierung als Nachfolger der heutigen Informationsgesellschaft. Künstliche Intelligenz wird bestimmen, wie unsere Persönlichkeit und unser Potential bewertet werden, wie wir bei Krankheit behandelt werden und wie wir unser Geld anlegen können. Quantencomputer können in Millisekunden unsere Sicherheitsmaßnahmen knacken und uns ausforschen. Digitalisierung kommt nicht als Gefahr daher, sondern als Verführung. Avatare werden uns komfortabel, liebenswürdig und umfassend überall unterstützen. Viele von uns werden einfache Dinge, wie Reise und Hotel buchen, den hübschen, schnellen Avataren überlassen, selbst unfähig zu durchschauen was der Avatar macht. Wenn wir nicht wissen, wie die Algorithmen rechnen, gestaltet ein guter oder ein schlechter unsere Zukunft. Neuronale Netze werden so tun, als könnten sie autonom denken. Wir werden sie gerne nutzen. Doch es kann auch ein kaltes, maschinelles Denken sein, das unsere Empfindungen, unseren Glauben und unsere Seele verkrüppeln lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Paul und Leon
Über dieses Buch:
Digitalisierung kommt und wird unser Schicksal der nächsten Jahrzehnte bestimmen. Wir müssen die Digitalisierung gestalten. Sie bietet ungeahnte neue Möglichkeiten, sie kann unsere Fähigkeiten enorm erweitern. Sie kann uns andererseits in einen Lebensweg pressen, ohne dass wir einen Ausweg finden. Sie kann die Demokratie bedrohen. Doch was ist zu tun? Verstehen und bewusst leben, muss unser Motto heißen, in einer Welt der potentiell unendlichen Chancen und Herausforderungen.
In der Arbeit, der Freizeit und im Privatleben dominiert die Digitalisierung als Nachfolger der heutigen Informationsgesellschaft. Wer einen Kredit will, ärgert sich über den geheimen Algorithmus der Schufa. Wer einen Kita-Platz sucht, weiß nicht, wie der Auswahl-Algorithmus aussieht. Wir brauchen ein neues Gesetz dafür, denn die Gerichte halten die Geheimniskrämerei für zulässig. Künstliche Intelligenz wird bestimmen, wie unsere Persönlichkeit und unser Potential bewertet werden, wie wir bei Krankheit behandelt werden und wie wir unser Geld anlegen können. Quantencomputer können in Millisekunden unsere Sicherheitsmaßnahmen knacken und uns ausforschen.
Digitalisierung kommt meist nicht als offensichtliche Gefahr daher, sondern als Verführung. Avatare werden uns komfortabel, liebenswürdig und umfassend überall unterstützen. Viele von uns werden einfache Dinge, wie Reise und Hotel buchen, den hübschen, schnellen Avataren überlassen, selbst unfähig zu durchschauen was der Avatar macht. Wenn wir nicht wissen, wie die Algorithmen rechnen, gestaltet ein guter oder ein schlechter unsere Zukunft. Wir müssen also verstehen, was Digitalisierung mit sich bringt.
Neuronale Netze werden so tun, als könnten sie autonom denken. Gigantische Möglichkeiten bieten sie. Wir werden sie gerne nutzen. Doch es wird ein kaltes, maschinelles Denken sein, das unsere Empfindungen, unseren Glauben, unser Bewusstsein und unsere Seele verkrüppeln lässt. Deshalb ist dies ein wichtiges Thema des Buches. Wo sind die Grenzen der Computerisierung?
Vertrauen können wir der Digitalisierung nur, wenn wir sie verstehen. Das ist das Ziel dieses leicht verständlichen Buches, das letztlich komplexe Sachverhalte aufdeckt.
Zum Autor:
Georg E. Schäfer studierte schon zu Lochkarten-Zeiten Mathematik, Physik und Informatik. Die Computer haben den Diplom-Mathematiker und Leitenden Ministerialrat a.D. nie mehr losgelassen. Forschung und Produkte der Informatik hat er weltweit erkundet. Ihre Anwendung in Wirtschaft, Produktion und Regierung kennt er aus eigener tiefgehender Anschauung.
Jetzt hat er die Zeit, die breite Entwicklung unserer Informationsgesellschaft und Wissensgesellschaft zur Digitalisierung verständlich und umfassend zu beschreiben.
Daraus ist dieses leicht lesbare Buch entstanden, das komplexe Sachverhalte gut nachvollziehbar aufklärt.
Inhalt
Vertrauen in die Digitalisierung
Digitalkonzepte: Wovon jeder spricht!
Wir haben Träume realisiert
Jugendträume erfüllen sich
Information und Macht an den Fingerspitzen
Technischer Wandel wird schließlich institutionell begleitet
Die Angst vor „Allem“ ist dahin
Leuchtturm 1: Super- und Quantencomputer
Von Neumann - Architektur
Supercomputing strebt zum Exascale
Quantencomputer
Leuchtturm 2: Künstliche Neuronale Netze
Leuchtturm 3: Algorithmen
Manager wollen Digitalisierung verstehen, indem sie programmieren
Algorithmen werden immer umfangreicher … und keiner misst ihr Gewicht
Leuchtturm 4: Künstliche Intelligenz und Deep Learning
Künstliche Intelligenz (KI) / Artificial Intelligence (AI)
Deep Learning („tiefgehendes Lernen“)
Vernetzte Digitalisierung und juristische Begriffe dazu
Technik-unabhängiges Deutsch erklärt vieles Technische
Gefangen im Netz – Irrgarten mit Ausgängen
Netze sind nicht nur Kabel sondern auch in der Fläche verteilte, leistungsfähige Computer
Digitalisierung und Datenschutz: Korrekt und sicher muss es sein
Was sind Sicherheit und Risiko?
Schutzgüter des Datenschutzes
Verschlüsselung, Steganografie und elektronische Unterschrift
Datensicherheit
Maßnahmen zum Schutz für alle Computer
Maßnahmen zum Schutz unserer PC
Maßnahmen zum Schutz unserer Smartphones
Persönlichkeitsrechte und Ethik in der digitalisierten Gesellschaft
Kinder müssen auch im Netz Kinder bleiben dürfen
Missbrauch des Internets muss aufhören
Rechtliche Gestaltung der 4 Leuchttürme
Auskunft, Löschen und Alternativen müssen alle Computersysteme bieten
Recht zu erfahren, welchen Techniken und Algorithmen man ausgesetzt ist
Recht zur Ablehnung automatisierter oder halb-automatisierter Entscheidungen
Unser Bewusstsein in der Digitalisierung
Wir haben „Alles“ bekommen und wollen jetzt „Immer Alles“
Der Glaube an das Gute und den Fortschritt charakterisiert die Informationsgesellschaft
Hypothese: Menschen können jetzt und Computer demnächst autonom denken
„Wahrscheinlichkeit“ gibt es nicht, nur 10
n
Kausalitäten
Mit Mythen geht man heute wissenschaftlich um
Die Wahrheit, nichts als die Wahrheit
Orientierung im Meer der Informationen
Glück fließt zu denen, die lieben und danken können
Politik muss künftig besser beobachten und vorauseilend mit Bedacht eingreifen
Glaube benötigt eine neue Sprache, in der Musik und in der Verkündigung
Digitalisierung wird europäisch und chinesisch
Die Chancen der Digitalisierung nutzen statt sie zur Unterhaltung einzusetzen
Werbung verliert ihre Bedeutung bei der jungen Generation
Trend zu Bescheidenheit, Regionalem, Bio und einer Sensibilität für Datenschutz
Monopole, Arbeitsplätze und Standards
„America First“ zeigt die Verwundbarkeit
China wächst innovativ und qualitativ
Open Source bietet zu fast allem eine Alternative
Die geplanten hochintegrierten Systeme sind fragil und unzuverlässig
Unsere Demokratie sichern
Stichwortverzeichnis
Vertrauen in die Digitalisierung
Im November 2017 hat ein mittelständischer Unternehmer bei dem Heilbronner Prälaturforum den Trend zu einer Digitalisierung rundweg verneint. Er habe davon noch nichts gemerkt. Vielleicht nicht so extrem, aber viele, die täglich in der beruflichen Routine ihre Leistung bringen, sind bei dem Thema Digitalisierung orientierungslos. Das ist gefährlich für die gesellschaftliche und politische Orientierung, für das Individuum, das Unternehmen und seine Beschäftigten. Allerdings ist die tiefgehende Unsicherheit beim Thema Digitalisierung kein Wunder. Nur wer Jahrzehnte Erfahrung mitbringt, wer viel Zeit zum Recherchieren und Schreiben hat, kann das komplexe Thema in der notwendigen Breite erschließen. Für viele heißt sonst Digitalisierung nur, dass Glasfaserkabel für Internet und Fernsehen im Land verlegt werden.
Wenn wir realistisch sind, können wir unsere Zukunft in der Informationsgesellschaft gestalten.
Digitalisierung löst Sorgen, sogar Ängste aus. Viele Arbeitsplätze werden verschwinden. Neue Beschäftigungen könnten entstehen. Wie gelingt es, viele gute Jobs zu schaffen? Die zwischenmenschliche Kommunikation scheint zu verkümmern. Statt sich mit realen Fragen und Objekten zu befassen, scheint es zu oft bloß um Fake News, Lug und Trug und an den Haaren herbeigezogenen Themen zu gehen. Andererseits überlassen immer mehr Familien ihre Wohnung und ihr Haus an andere. Viele Menschen laden über das Internet Gäste zum gemeinsamen Tafeln ein (z.B. „Eatwith“). Liegt es an den jeweiligen Personen, ob sie eher aus der Realität flüchten oder diese noch intensiver mit Anderen erleben wollen? Falls ja, wie sind die Prozentsätze? Müssen wir Angst um das Funktionieren unserer Demokratie haben?
In den Medien kocht jeder sein Süppchen. Halbwahrheiten, Übertreibungen, Verniedlichungen und die ewige Frage, wie weit hinkt Deutschland hinterher, lösen sich rasant ab. Jetzt ist Zeit inne zu halten. Sich erst informieren, wichtige Fragen ganzheitlich erörtern, und dann die Zukunft gestalten. Nur so kann es gehen. Die Zeit nehmen wir uns. Das ist die Antwort auf die Frage, wieso dieses Buch geschrieben wurde:
Weil es dieses Buch noch nicht für gibt. Geschrieben wurde es für Leser mit wenig und Leser mit viel Zeit. Nur dieses Buch gibt technische, rechtliche und weltanschauliche Orientierung. Weil die ganzheitliche Sicht unerlässlich ist, wenn es um Angst, Sorgen und Vertrauen geht.
Naturwissenschaftler werfen ungestüm das Denken ihrer Zeit um, merken aber offenbar nicht, wohin sie treiben. Über sich nachdenken, das sich wandelnde Bewusstsein der Gegenwart kritisch untersuchen, fällt denen schwer, die lieber Formel-Lindwürmer schreiben als einen für alle verständlichen Satz. Schlimmer noch, Naturwissenschaftler lesen auch nur selten Bücher über die Gesellschaft, ihre Kultur und Philosophie. Immer noch rekrutieren sich die „Senioren“ der heutigen Wissenschaft weitgehend aus der Forschermentalität der Nachkriegsgeneration, die lieber hart arbeitet als müßig philosophiert. Soziale Kompetenz, Philosophie (die über Atomphysik hinaus geht und Gesellschaft umfasst1) oder Kirche reizen nur wenige zur intensiven Beschäftigung. Kirche: Viele der dort gesungenen und gesprochenen Aussagen sind für Naturwissenschaftler unverständlich. Spricht der Theologe vom dreieinigen Gott, dann ist dies für einen Mathematiker so ein unsinniger Begriff wie „das runde Quadrat“ oder „der Wagen, der blitzeschnell langsam um die Ecke fuhr“. Das sind inhaltslose Aussagen, denn die theologische Interpretation kennen Informatiker nicht und sie interessiert Informatiker kaum. Physiker und Informatiker, die vom Fortschritt der Wissenschaft überzeugt sind und alles Neue aufsaugen wie ein Schwamm, sehen einen Blick über ihr Fach hinaus zu oft als Zeitverschwendung. Dann doch lieber kurz einen Tatort ansehen und stundenlang einen fachlichen Aufsatz lesen!
Politik spricht von Digitalisierung, tut sich schwer damit wie Kanzlerin Angela Merkel im Wahlkampfduell 2017, als sie schon glücklich war, dass sie das Wort früher als ihr Diskussionsgegner Martin Schulz von der SPD sagen konnte. Auch im Sondierungspapier der CDU mit der SPD haben beide Parteien nicht dazugelernt. „Das größte Problem der Politiker ist ihre Ignoranz. Die Leute, die Entscheidungen treffen, haben bis auf wenige Ausnahmen keine Ahnung.“, sagt der ehemalige Präsident Toomas Ilves des sehr weitgehend digitalisierten Estland2. Wir geben in der EU ein Vielfaches von dem, was man für Digitalisierung und Sicherung künftiger Arbeitsplätze braucht, für die Landwirtschaft aus. Inhaltlich konnte und kann Martin Schulz mit Digitalisierung offenbar auch nichts anfangen. Fazit: Diese Politiker wollen ein Hochtechnologieland steuern und können, obwohl die Kanzlerin Physikerin ist, bei dem Thema offenbar nicht tief blicken. Schnellere Netze und dafür Bagger fahren lassen, das ist noch verständlich. Wenn es nur nicht so viel kosten würde, denken die Finanzminister in ihrer Kurzsichtigkeit.
Doch Verkabelung ist nur ein Randbereich der Digitalisierung. So wie wir Luft zum Atmen brauchen, benötigen Hochleistungscomputer, Clouds, Big Data usw. die schnellen Funk- und Glasfasernetze! Giga-Bit-Netze3 sind faszinierende technische Meisterwerke, auf die wir hier nicht so breit eingehen, da sich dort kaum technische Umwälzungen abspielen. Normal ist heute, dass sie auf Glasfasertechnik basieren und optisch gesteuert werden. Die Lichtfarben repräsentieren Unternetze und diese werden durch optische Brechung umgelenkt. Dadurch werden die Wege der Datenpakete vielfach mit Lichtgeschwindigkeit und hoher Sicherheit bestimmt, statt wie vordem mit Netzcomputern, die pro Weiterleitung eines Datenpakets 150 bis 400 Millisekunden brauchten. Auch in die optisch gesteuerten Hochgeschwindigkeitsnetze sind Netzcomputer eingebunden. Sie verwalten die Prioritäten, lösen Staus auf, finden Umwege bei Netzschäden und garantieren viel Sicherheit.
Eine umwälzende Neuerung der Digitalisierung ist beispielsweise die künstliche Intelligenz. Bei dem herrschenden eklatanten Mangel an Facharbeitern und Forschern können wir die anstehenden Denkaufgaben zur Umwelt, den sozialen Systemen und, um noch ein drittes Beispiel zu sagen, zur Finanzwelt, nicht nur mit Menschen lösen, sondern müssen mit klug programmierten Computersystemen helfen. Digitalisierung ist auch Industrie 4.0, also die ganzheitliche Integration industrieller Prozesse über mehrere Firmen und Behörden hinweg, sowie die Folgestufen. Diese Folgestufen werden erfordern, dass künstliche Intelligenz diese mit Industrie 4.0 integrierten Prozesse anreichert.
Der sonst so positive Elon Musk, unter anderem als Gründer der Elektroautomarke Tesla bekannt, befürchtet, dass diese von uns geschaffenen intelligenten Prozesse irgendwann einen recht unintelligenten Dritten Weltkrieg auslösen werden. Die Gefahr ist, wie wir sehen werden, nicht sicher von der Hand zu weisen. Doch wenn die Maßnahmen zur Gestaltung der Risiken, die wir hier begründen und aus einer verständlichen Darstellung der Technik heraus erläutern werden, ganzheitlich ergriffen werden, lässt sich die Technik beherrschen. Ein Bündel an abgestimmten Maßnahmen wird es sein müssen, wollen wir unser Mensch-Sein bewahren. Computer können heute schon, wie wir begründen werden, autonom denken. Und zwar, wenn wir an das Go- oder Schachspiel denken, folgern sie schneller als wir. Wollen wir unser Mensch-Sein bewahren, müssen wir also erst einmal klären, was dieses Mensch-Sein überhaupt sein soll.
Es ist an der Zeit, sich bewusst zu werden, wo es hingeht. Nicht um Zukunftstechnologie zu bejubeln oder zu verteufeln. Wir brauchen Computer, um die Umwelt-, Forschungs-, Pflege- und Verteilungsaufgaben unserer Zeit zu lösen. Technik müssen wir verantwortungsbewusst gestalten, so wie wir mit der Technik unsere Welt stärker als bisher und ganzheitlich gestalten müssen. Computer sind weder gut noch schlecht. Sie sind wie ein Brotmesser, mit dem man Hungernden eine Scheibe Brot herunterschneiden kann, mit dem man aber auch jemanden verletzen oder erstechen kann. Technik muss man gestalten. Die Frage ist: wie?
Alle erschrecken, weil im Januar 2018 plötzlich der Öffentlichkeit bekannt wird, dass bestimmte Rechnerprozessoren etwa von Intel, AMD, ARM, Apple unsicher sind. Experten können die Rechner ausforschen und gezielt auf Passwörter usw. zugreifen.4 Informatiker wussten das schon seit 20 Jahren.5 Wieso passiert so was? Was machen wir falsch? Die Antwort verblüfft und ist einfach.
Eine virtuelle Organisation (Bank, Versicherung, Kaufhaus, usw.) ist dasselbe wie die altbekannte reale Organisation, bloß dass man kein reales Haus, keinen realen Schalter, keine reale Kasse findet, wo man hingehen kann.
Virtuelle Geschäftsprozesse kann man nicht dauerhaft sichern, da die von Kurt Gödel erkannten mathematischen Gesetze sagen: Wir können nie fehlerfrei denken.
Kurt Friedrich Gödel (1906-1978), ein österreichischer Mathematiker und am Ende seines Lebens ein guter Freund von Albert Einstein (1879-1955), hat bereits als junger Student mathematisch exakt bewiesen, dass wir von bestimmten Formeln nicht sagen können ob sie richtig oder falsch sind. 6 Verzichten wir auf die formale mathematische Herleitung, die wie die Literaturangabe zeigt, nicht ganz einfach ist, dann können wir gerne feststellen, dass wir Menschen praktisch von keiner Überlegung, Theorie oder Formelsammlung sagen können, dass sie richtig sind. Mathematisch bewiesen hat Kurt Gödel dies in den sog. Unvollständigkeitssätzen. Sie besagen zur Informatik und Digitalisierung: Wir können keine fehlerfreien Computer und keine fehlerfreien Computerprogramme schaffen. Weder die klassischen von-Neumann-Computer noch die neuen Quantencomputer sind fehlerfrei. Zweifellos lastet ein Fluch auf unserem beschränkten Denken und der damit gebastelten Technik: Das ist der Grund, wieso wir immer mit falschen Berechnungen, Computer-Attacken, Computerviren, auf Computertechnik aufbauende Kriege zwischen Staaten, Wahlmanipulationen usw. rechnen müssen. Smartphones, selbstfahrende E-Mobile, medizinische Diagnose- und Behandlungscomputer müssen wie alle Computer und Computerprogramme ständig durch Wartung und neue Programmversionen aktualisiert werden. Wir werden hier diskutieren, dass es dafür Lösungen gibt. Normalerweise darf der Kunde in unserem Rechtssystem fehlerhafte Produkte zurückgeben und ein fehlerfreies Produkt verlangen. In der Computertechnik ist das wegen der Gödel‘schen Gesetze ganz anders. Hier zahlen die Kunden, damit sie aus einer riesigen Datenbank die aktuellen Fehler erfahren können.
Kurt Friedrich Gödel lehrt uns Demut! Diesen Grundgedanken sollte der Leser von jetzt an nie mehr vergessen, wenn er sich mit Computertechnik, den neuen Erkenntnissen der Wissenschaften, der Geisteswissenschaft und Theologie auseinandersetzt. Von jetzt an glauben wir nicht mehr alles, was wir lesen und denken.
Der Autor weiß, dass er während den heißen Phasen seines Berufslebens nie die Zeit hatte, ein Buch wie dieses von vorne nach hinten zu lesen. Für sich das Wichtigste aus einem Buch herauszuholen, ist schwierig, falls der Autor das nicht erleichtert. Dieses Buch ist so geschrieben, dass es leicht von allen gelesen werden kann, die sich für eines der großen Themen interessieren. Der Leser kann im Text hin und her springen. Man muss nicht alles akribisch von vorne nach hinten lesen. Denn in Schnell-Lese-Kästchen fassen wir immer wieder den Inhalt kurz und knapp zusammen.
Wieviel Zeit verbringen wir, um unser Auto fahren zu dürfen, es zu verstehen, zu warten, zu versichern, zu navigieren und uns unproduktiv über die Straße zu bringen. Einen kleinen Teil dieser Zeit verbringen wir bloß um unsere PC und Telefone zu verstehen. Obwohl die viel komplizierter und oft gefährlicher sind.
Den Leser erwarten hier konkrete Informationen, keine abgehobenen Spekulationen oder effektheischende Zukunftsszenarien. Dieser Charakter wird besonders in den konkreten Sicherheitshinweisen deutlich, die in den Datenschutz- und Datensicherheitskapiteln enthalten sind.
Dem Autor ist letztlich ein Thema besonders wichtig: Wie gehen wir weltanschaulich mit der rasanten technischen Entwicklung um? Die meisten von uns überfordert die moderne Informations- und Wissenstechnik. Mit schlechtem Gewissen geben sie Daten ein, nutzen soziale Netzwerke und Messenger-Dienste wie WhatsApp. Alle Informationen landen in den USA. Was passiert damit? Wenn jeder alles über mich weiß, wer bin ich dann noch? Wo finde ich meine weltanschauliche Balance? Was kann ich wissen und woran muss ich zweifeln? Nachdem alle Sachinformationen beschrieben sind, wendet sich das Buch in den hinteren Kapiteln diesen weltanschaulichen Fragen zu. Nicht im Sinne einer Belehrung, sondern im Sinne eines geistigen Sparrings als Chance für den Leser, seine sicher vorhandene Position zu überprüfen!
1 Ein solcher Physiker, Philosoph und Friedensforscher war beispielsweise Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007)
2 Change – Das Magazin der Bertelsmann Stiftung, Heft 2 von 2017, S. 61
3 In der traditionellen Computertechnik (im Gegensatz zu den Quantencomputern), von der wir hier reden, ist ein Bit entweder der Zahlenwert 0 oder 1. Megabit sind 106 Bits, 1 Gigabit sind 109 Bits, also 1000 Mega-Bits. Ein Giga-Bit-Netz kann mehrere Giga-Bit pro Sekunde übertragen. Es ist heute unerlässlich, weil sehr viele Datenströme für viele Unternehmen und Privatleute über solche Netze abgewickelt werden,
4 Moritz Lipp, Michael Schwarz, Daniel Gruss, Thomas Prescher, Werner Haas, Stefan Mangard, Paul Kocher, Daniel Genkin, Yuval Yarom, Mike Hamburg, Meltdown, www.meltdownattack.com, Abruf 5. Januar 2018
5 KOCHER, P. C. Timing Attacks on Implementations of DiffeHellman, RSA, DSS, and Other Systems. In CRYPTO (1996).
6 Dirk W. Hoffmann, Die Gödel’schen Unvollständigkeitssätze: Eine geführte Reise durch Kurt Gödels historischen Beweis, Springer Spectrum, 2012
Digitalkonzepte: Wovon jeder spricht!
Kein Wunder, dass Digitalisierung vielen wie ein riesiges Sudoku erscheint, wo doch die Informationstechnik in alle Lebensbereiche irgendwie gleich und irgendwie doch anders eingreift. Bevor wir in den Kern der Digitalisierung und in die Themen des Buches einsteigen, sollen hier wichtige Begriffe für Technologien, die alle vier Leuchtturm-Technologien (Algorithmen, Künstliche Intelligenz, Künstliche Neuronale Netze und Quantencomputer) berühren, verständlich erklärt werden. Das können Sie jetzt überspringen, wohl wissend, wo Sie bei Bedarf nachlesen können.
Durch diese Kurzfassung wird sicher manches auf den Punkt gebracht. Das mag in dem einen oder anderen Fall überspitzt klingen und Experten mögen auch einmal darauf hinweisen, dass eine Aussage Zukunftsmusik ist. Doch genau diese Musik spielen wir hier. Und wenn wir im nächsten Urlaub die Zeitung aufschlagen, ist der hier vorauseilend beschriebene Entwicklungstand schon erreicht. Zudem: Nur so werden rasante Entwicklungen verständlicher. Wo nicht klar ist, wo es hingeht, unterlassen wir jedwede Spekulation und nennen das Problem beim Namen.
Internet of Things (IoT)
Mit dem Internet der Dinge (Internet of Things) bezeichnet man den Zustand, bei dem alle Gegenstände (Kleider, Milchflaschen, Butterpackungen, Lichtschalter, Kühlschränke, Waschmaschinen, Bohrmaschinen, usw.) einen mehr oder weniger großen Computerchip (mit einer eigenen Internet-Adresse) und einen oder mehrere Software-Avatare (Erläuterung siehe unten) haben. So kommunizieren sie mit einem oder vielen Rechnern im Internet. Was soll das denn? Die Vorstellung, dass sich die Butter automatisch auf die elektronische Einkaufsliste setzt, wenn nur noch 80 g in der Packung sind, überzeugt keine passionierten Köche, Gourmet-Hobby-Köche schon gar nicht, weil diese immer frisch und immer bezogen auf den Zeitpunkt der nächsten Einladung kochen und einkaufen.
Aber: Für Unternehmen ist das in der Produktion und im Handel eine enorme Hilfe. Industrie 4.0 benutzt etwa Akkuschrauber, mit denen eine Schraube nicht mehr falsch eingedreht werden kann und die zudem sicherstellen, dass jede so festgemachte Schraube in der Cloud dokumentiert ist. Anderes Beispiel: Fährt der Einkaufswagen an der Kasse vorbei, ist die Rechnung schon fertig, wenn wir die Hände vom Bügel nehmen. Amazon hat einen derartigen Einzelhandelsladen im Januar 2018 in Seattle eröffnet. Das Smartphone zahlt auf Kommando. Oder: Chips in der Kleidung können Wetterdaten live registrieren, ebenso unseren gesundheitlichen Zustand, unsere sportliche Leistung und vieles mehr. Wichtig: Aufgrund des Elektro-Smogs in unserer Umgebung, selbst in ländlichen Regionen, benötigen diese Chips heute keine Batterie mehr. Sie tanken aus den Funknetzen ihre Akkus auf, wie manche Autoschlüssel beim Fahren unseres Pkw alle Motordaten aus dem Bordcomputer aufnehmen.
Verkabelung, Glasfaser in die Fläche
Aus guten Gründen verlangt eine EU-Richtlinie, dass 3-Sterne-Hotels eine leistungsfähige Internet-Anbindung benötigen, sonst dürfen sie keine drei Sterne tragen. Der Verödung unserer Regionen und der Landflucht muss vorgebeugt werden. In Deutschland sind viele Start-ups auf dem Land gut aufgehoben, bei geringen Mietkosten, günstigen Gehältern und viel Fläche für das künftige Wachstum. Aber: Oft fehlt der Giga-Bit-Netzanschluss
7
! Die in diesem Buch nachfolgend beschriebenen vier Leuchttürme erklären sofort, dass ohne Giga-Internet künftig keine Firma mehr auf das Land ziehen kann. Viele Dörfer und dort ansässige Firmen haben notgedrungen, da die Telekom untätig blieb, bereits aus eigener Tasche hoch dimensionierte Internet-Anschlüsse realisiert. In einem Hochtechnologie-Land ohne wesentliche Rohstoffe ist eine Glasfaserverkabelung erster Qualität eine Selbstverständlich. Doch die deutsche Bundespolitik erkennt dies immer noch nicht in ihrer Bedeutung.
Unsere ambitionierten Umweltziele lassen sich ohne Internet nicht realisieren. Software-Updates können Elektroautos nur über das Internet erhalten. Bankgeschäfte benötigen Internet-Netze ebenso wie Geldanlagen, Börsengeschäfte, Gesundheitsdienste und Sicherheitsmaßnahmen. Glasfaser ist dabei aus vielen Gründen nötig. Vermeidung von Elektro-Smog, der bei Funknetzen entsteht, und die hohe Abhörsicherheit von Glasfaser-Netzen sind zwei Argumente. Was man selten diskutiert ist, dass Netze mit Metallkabeln durch den elektromagnetischen Impuls von Kernwaffen beschädigt werden, nicht aber Glasfasernetze. Ignoriert man diesen Aspekt völlig, dann lädt man Kriminelle und feindselige Staaten geradezu ein, die künftig überlebenswichtige elektronische Infrastruktur unseres Landes mit einer Bombe zu beschädigen.
Cyberwar
Unternehmen und Privatleute unterschätzen immer noch sträflich die vielen Attacken, die laufend auf ihre Computer einwirken. Cyberwar beinhaltet die Versuche von Regierungen, Wahlen zu beeinflussen. Auch Attacken wie sie vor einiger Zeit auf im Iran installierte Siemens-Anlagen durchgeführt worden sind, gehören dazu. Damals hat in Energieanlagen und Produktionsanlagen eingeschleuste Schadsoftware zu falschen Anzeigen im Kontrollzentrum der jeweiligen Anlagen geführt. Kraftwerke können, un-steuerbar durch die Kontrollzentren vor Ort, heruntergefahren werden. Jedes denkbare Szenario ist realisierbar: die Zerstörung oder Fälschung von Hotelreservierungen, Angriffe auf Versicherungen und Produktionsanlagen und selbstverständlich sind auch militärische Anlagen Zielobjekte. Dadurch, dass im Sicherheitsbereich rigorose Abschottungen und speziell ausgetestete ältere Software-Versionen benutzt werden, ist ein Angriff schwieriger.
Privatleute können durch die Nutzung mehrerer Notebooks oder PCs für sensible Anwendungen auch Geräte benutzen, die nicht oder nur in Ausnahmefällen an das Internet angeschlossen werden. Das automatisierte Auslesen oder eine Erpressung durch Lahmlegen des PC ist dann sehr unwahrscheinlich. Der ständig am Internet gehaltene PC wird im Angriffsfall einfach gelöscht und neu aufgesetzt. Die sensiblen Produktiv-PCs sind nicht betroffen.
Cyberrisiken
Cyberrisiken sind im Konsumentenalltag der Privatnutzer die vielen möglichen Schadsoftware-Varianten wie Viren, Trojaner und das geheime und kriminelle Auslesen von Kontaktordnern, Mailordnern und dergleichen. Das gilt für Smartphones und für private PC. Lästig, zeitraubend und kostspielig ist das alles, besonders wenn durch das Verschlüsseln von Speicherbereichen Erpressung betrieben wird. Cyberrisiken verursachen im industriellen und kommerziellen Bereich aber bedeutend größeren Schaden. E-Autos benötigen beispielsweise wegen der Komplexität des autonomen Fahrens laufend funktionale Updates, genauso wie vernetzte Prozessketten der Industrie 4.0. Während der Updates ist eine Nutzung des E-Autos und ein störungsfreier Ablauf der Prozessketten nicht immer möglich. „Rückrufaktionen“, wie wir sie heute von der mechanischen Autoindustrie kennen, werden im elektronischen Bereich noch öfter eintreten. Fehlerfreie Software gibt es nicht. Die Herstellerhaftung greift, etwa wenn der Hersteller unfallfreies Überholen auf der Autobahn zusagt und er nach einem Unfall einen Fehler in seiner Software findet. Hier wird der Hersteller innerhalb von Stunden reagieren müssen.
Blockchain
Die Blockchain-Technologie ist noch nicht voll entwickelt, wenngleich sie schon in verschiedenen Projekten eingesetzt wird. Estland sagt, sein E-Government mit den gut 600 online-Lösungen der öffentlichen Verwaltung für Bürger und über 1000 zusätzlichen Anwendungen für die Unternehmen würde darauf aufbauen. Die Idee der Blockchain ist, dass in verteilten Systemen auf riesige, für Hacker attraktive Datenbanken verzichtet wird, und Datenverarbeitungsaufträge wie Perlen auf einer Kette mit einer bestimmten formalen Struktur aneinander gereiht werden. Die in den Kettengliedern („Blocks“) genannten Verarbeitungsaufgaben (z.B. im Daimler-Projekt: Zeichnung einer Anleihe) werden dann von den jeweiligen Computern abgearbeitet. Experten sind sich einig, dass hier noch viele Aufgaben bis zum Internet 5.0 gelöst werden müssen, auch solche der Computersicherheit. Bitcoins, die digitale Währung, wird über Blockchains verwendet. Regulierungen wie etwa in Südkorea werden dem zumindest teilweise ein Ende setzen, weil Regulierungen zentrale Kontrollstellen benötigen.
Bitcoins und andere Kryptowährungen
Bitcoins funktionieren währungstechnisch im Grunde wie die Ehrenamts-Taler, die es in vielen Städten der Welt gibt. Ehrenamtlich Tätige erhalten als Anerkennung für die geleistete Arbeit einen Taler. Funktioniert das System und arbeiten in einer Stadt viele Ehrenamtliche mit hoher Leistung, dann ist der Ehrenamts-Taler etwas wert. Dann kann mit ihm im Dritte Welt Laden oder sonst wo eingekauft werden, ohne eine Bank zu beteiligen. Verschwindet das ehrenamtliche Engagement, dann ist der Taler nichts mehr wert. Das, übertragen auf eine elektronisch gesteuerte und weltweit operieren de Währung, ist die virtuelle Währung der Bitcoins.
Ein feiner Unterschied zwischen Ehrenamtstalern und Bitcoins sowie den anderen Kryptowährungen existiert: Bitcoins sind weltweit und nicht nur regional handelbar und sie sind elektronisch. Kein Wunder, dass hier gezockt wird, was das Zeug hält. Geldwäsche ist möglich und alle illegalen und halblegalen Geschäfte, die wir uns ausdenken können, kann man damit erproben.
Maximal dürfen 21 Millionen Bitcoins durch die Berechnung von jeweils einer kryptografischen, sehr langen Zahl pro Bitcoin im Umlauf sein
8
. Die Bitcoins können nur von Computer zu Computer (Notebook, Smartphone, Server usw.) weitergegeben werden, als Ganzes oder als beliebig kleiner Bruchteil eines Bitcoins. Ein Bitcoin, dessen Wert (derzeit 14.000 US-Dollar) sich laufend durch die Börse bestimmt, und steigen und fallen kann, kann und muss nicht als Ganzes ausgegeben werden. Wenn ein Bitcoin, mehrere Bitcoins oder Bruchteile eines Bitcoins ausgegeben werden, wird in keinem Fall eine Bank benötigt. Gebühren, Kontrollmechanismen mit digitaler Dokumentation und Bürokratie fallen weg. Man kann diese virtuelle Wahrung vom Smartphone direkt auf eine Kasse in einer Bar zahlen. Oder man verwendet eine Bitcoin-Blockchain, etwa wenn ein Besitzer eines Elektromobils an einer Strom-Zapfsäule Strom bezahlen will. Behauptet wird, dass Tausende Computer verstreut über die ganze Welt jederzeit festhalten, wo die Bitcoins sind. Allerdings wurden am 7. Dezember 2017 durch einen Hacker-Angriff, vermutlich von außerhalb der EU, etwa 80 Millionen US-$ von der slowenischen NiceHash-Firma gestohlen. Die Analyse läuft noch. Derzeit laufen Bestrebungen, weitere Bitcoin-Währungen aufzubauen. Wie sich da die Börsen verhalten, wird mit viel Interesse verfolgt werden. Klar ist: Beliebig viele Bitcoin-Währungen können realisiert werden. Vertraut man einer, dann heißt dies nicht, dass man auch einer anderen vertraut. Die nationalen Zentralbanken stützen und regulieren diese Pseudo-Währungen bislang nicht.
Advanced Analytics
Fortschrittliche analytische Methoden nutzen eine Kombination der modernsten Techniken. Wesentlich sind Cloud-Lösungen mit riesigen Verarbeitungsleistungen und Speicherkapazitäten, Big Data-Analyse-Werkzeuge für strukturierte Daten aus Datenbanken und unstrukturierten Dokumentensammlungen (gescannt, fotografiert, beschädigt durch Wasser aus Archiven usw.) sowie Methoden der Künstlichen Intelligenz. Die deutsche Firma SAP hat die HANA-Technologie entwickelt, bei der etwa ein Arzt, der eine Diagnose am Bildschirm zu einem Patienten eingibt, sofort (wahrhaftig als Blitz am Bildschirm) erfährt, wie viele Patienten in seinem Klinikum und weltweit diese Krankheit haben, was als Standard-Therapie dem Alter nach üblich ist, welche Studien laufen und was sich in der Behandlungs-Praxis bewährt hat.
Data Intelligence
Die Datenbankspezialisten haben seit Erfinden der Datenbanken erfolgreich das Ziel verfolgt, die Daten plausibel und sinnlogisch zu strukturieren und zu speichern. Wer seine strukturierten und unstrukturierten Daten (zum Begriff siehe Advanced Aanalytics) mit diesen Hintergedanken ablegt, findet sie zielsicher, schnell und kann auch komplexeste Auswertungen leicht durchführen. Übrigens: Datenbanken erfand man, damit Nutzer in den Firmen aus allen Abteilungen auf ein und den gleichen Datenbestand zugreifen und die Datenbank bei Veränderungen durch eine Abteilung sofort alle anderen mit den aktuellsten Daten versorgt. Die Datenbank speichert jedes Einzeldatum nur einmal, das aber für alle Nutzer aus dem gesamten Unternehmen. Klar, die Banken und die Fluglinien wollten das zuerst, später kamen Hotels und Bahnen dazu und dann alle Unternehmen, schließlich auch die Behörden (Gemeinden und Polizei).
Netzneutralität
In den Anfängen des Internets hielten die meisten Nutzer es für selbstverständlich, dass große, finanzstarke und kleine, sich erst entfaltende Unternehmen, das Internet in derselben Form nutzen können. Diese Haltung wollten die großen Telekommunikations-Unternehmen und auch Dienste-Anbieter, wie Soziale Netzwerke, Smartphone-Hersteller und Cloud-Anbieter, schon immer ändern. Exklusive, firmenspezifische, schnelle Internet-Verbindungen sollten es ermöglichen, die Kunden an die Konzerne zu binden und etwa Streamingdienste exklusiver verkaufen zu können. Im August 2016 hat die Europäische Union diese Netzneutralität weitgehend vorgeschrieben. Die Bundesnetzagentur berichtet in ihrem Jahresbericht zur Netzneutralität über Verstöße. 2017 hat die US-Telekommunikationsbehörde FCC angekündigt, dass sie am 14. Dezember 2017 über die Abschaffung der Netzneutralität abstimmt. Die American Civil Liberties Union (ACLU) und die Mehrzahl der 22 Millionen Kommentare an die FCC zu diesem Thema sprechen sich klar für die Beibehaltung der Netzneutralität aus. Die FCC will nicht nur die Netzneutralität in dem oben genannten Sinn ändern, sondern auch zulassen, dass Firmen beim Internet-Anschluss ihrer Kunden bestimmte Web-Sites und Informationen sperren und nur gegen Bezahlung freigeben. Man könnte das eine kommerzielle Zensur nennen. 2017 hatte die FCC bereits wichtige Datenschutzregelungen abgeschafft. So dürfen Unternehmen jetzt von ihnen aufgezeichnete Personendaten ohne Kenntnis und ohne Zustimmung der Betroffenen verkaufen.
Avatar
Ein Avatar ist eine Software-Anwendung oder -Applikation (App), die für uns zusammenhängende und logisch oder kommerziell wertvolle Aufgaben übernimmt. So ist ein Programm, das uns für eine Geschäftsreise völlig selbsttätig einen Flug, ein Hotel, Bahnkarten und sofern sinnvoll einen Pkw bucht, alles so wie wir es komfortabel empfinden, ein Avatar. Ich sehe mir beispielsweise auf jeder Reise gerne eine Kunstausstellung moderner Kunst an, möglichst mit günstigen Kaufgelegenheiten im Museumsshop. Und ich hasse zeitlich knappe Anschlüsse bei der Bahn, weil die sowieso nie funktionieren. Das muss der Avatar beachten. Gerne treffe ich mich abends mit in der Nähe wohnenden Freunden (Kontakte-Ordner). Der Avatar sollte natürlich diese Buchungen im Einklang mit der Reise-Regelung unserer Firma vornehmen. Außerdem erwarten wir von ihm eine korrekte Reisekostenabrechnung, auch bei geschäftsbedingten oder anderen Abweichungen. Das sind in der Summe hohe Anforderungen.
Cloud, Big Data
Früher hatte jedes Unternehmen sein eigenes Rechenzentrum. Dort kämpften die Mitarbeiter mit der für das Unternehmen nicht produktiven Rechenzentrums-Technik und zudem mit den darauf ablaufenden, für das Unternehmen lebenswichtigen Anwendungen. Komplexere Systeme wie SAP waren oft für jedes Rechenzentrum individuelle Lösungen, mit individuellen Fehler-Umgehungen. Als es gelang, die Qualität der Software zu erhöhen und die Netzzugänge zu riesigen Dienstleistungsrechenzentren gewaltig auszubauen, lag es auf der Hand, die einzelnen kostspieligen Unternehmensrechenzentren abzubauen und die Rechenaufgaben in kostengünstigere Dienstleistungs-Rechenzentren zu verlagern. Gezahlt haben dann die Unternehmen nur noch die Leistung, die sie jeweils abgerufen haben. Sie mussten keine teuren Rechner mehr ein Jahr lang im Rechenzentrum lagern, nur weil am Jahresende eine große Rechenleistung und diese Rechner benötigt wurden. Die Leistung, die ein solches Dienstleistungsrechenzentrum anbietet, nennt man eine Cloud („Wolke“). Falls in dieser Cloud nur ein Unternehmen rechnet, nennt man sie „Private Cloud“, falls Hunderte oder Tausende von Unternehmen rechnen, nennt man sie „Public Cloud“. Da lohnt es sich für die Dienstleistungsrechenzentren, Auswertungsprogramme für gigantische Datenmengen anzuschaffen und den Unternehmen anzubieten. Dieses Speichern und Auswerten großer Datenbestände nennt man Big Data („große Datenmengen).
4.0, Industrie 4.0
Mit Industrie 4.0 bezeichnet man die ganzheitliche Vernetzung von Verarbeitungsprozessen der Informations- und Kommunikationstechnik über Unternehmensgrenzen hinweg. Im Einzelnen verwenden viele Unternehmen solche Lösungen seit vielen Jahren (z.B. Lieferung von Autositzen an Autohersteller just-in-time). Diese Prozesse müssen im Zeitalter der Roboter jedoch immer komfortabler und automatischer werden. Ziel ist eine Produktion, die besonders flexibel erweitert, verändert und heruntergefahren werden kann, damit die Massenproduktion durch eine weitergehende Individualproduktion abgelöst werden kann. Die Mitarbeiter fügen auf großen Bildschirmen neue Maschinen in die Produktionsprozesse ein, kontrollieren die Produktion und überwachen die Dokumentation der Produktion. Das Anbringen von Klebstoffen auf die Teile einer Pkw-Karosserie wird exakt gesteuert und in der Cloud dokumentiert. Minimale Verwendung von Material und maximale Qualität bei jeder einzelnen Aktivität sind das Ziel. Wird beispielsweise ein neuer Klebstoff entwickelt, kann der in die Produktionslinie integriert werden. Falls Produktrückrufe nötig werden sollten, kann man sie optimal steuern und auf die wirklichen Problemfälle beschränken.
Informationstechnisch gesehen ist Industrie 4.0 eine reine Selbstverständlichkeit. Unternehmer dürfen den Trend nicht verspätet aufnehmen, sonst riskieren sie ihr Unternehmen. Belegschaften und Gewerkschaften befürchten allerdings, dass Industrie 4.0 zusammen mit den hier erklärten vier Leuchttürmen der Digitalisierung ein Jobkiller wird. Sie haben es in der Hand, ob dies so wird. Wenn wir die Zukunft ergreifen und gestalten, wird es in Vollbeschäftigung münden.
Die Zahl 4.0 wird inzwischen an alles angehängt. Kirche 4.0, Verwaltung 4.0, Lebensgefühl 4.0 und vieles mehr fand Eingang in Titel von Reden und Aufsätzen. Meistens steckt nicht viel Inhalt dahinter, denn die Entwicklung dieser Themen ging eben nicht wie die Entwicklung des Internet über die Versionen 2.0, 3.0 und jetzt zu 4.0. Beim Internet können wir zu jeder Versionsnummer einen Technik- und Diskussionsstand zuordnen. Bei Verwaltung 4.0 und Kirche 4.0 fehlt das zumindest in Deutschland völlig. Verwaltung und Kirche stecken bei der notwendigen Transparenz (E-Government, Offener Haushalt, qualitativ hochwertige Angebote für die Nutzer, usw.) noch in den Anfängen des Internets.
7 Ein Giga-Bit Netz überträgt 1000 Milliarden Bit (etwa 100 Milliarden Zeichen wie Buchstaben oder Ziffern) pro Sekunde. Wenn es für etwa 1000 Unternehmen arbeitet, ist das nicht viel.
8 Bitcoin wurde erst 2008 realisiert. Die Entwicklung ist wissenschaftlich jedoch schon in den 1990er Jahren vorbereitet worden (vgl. etwa Georg Schäfer, Mit Sicherheit erfolgreich, 1997, v. Decker Verlag, ISBN 3-7685-4796-5). Damals wurde das sog. virtuelle oder elektronische Geld unter anderem als unbedingt notwendig, aber auch als Beispiel gesehen, um die perfekte Erpressung durchzuführen.
Wir haben Träume realisiert
Pausenlos, wenn man vom Nippen an der Kaffeetasse absieht, haben fast alle IT-Leute, so wie die beiden wohl berühmtesten Garagenbastler Bill Gates (Gründer von Microsoft, geb. 1955) und Steve Jobs (Gründer von Apple, 1955-2011), im IT-Business9 an ihrem Traum gearbeitet. In Garagenfirmen entwickelte man rudimentäre Programme wie DOS10, nachts in Rechenzentren wurden dicke Programme aus Lochkartenstapel ausgetestet, Techniker maßen Tag und Nacht zur Qualitätssicherung elektronische Schaltungen durch und löteten neue Schaltungen zur Fehlerbehebung ein, so dass etwa der mit 48 Bit langen Registern versehene Großrechner TR 44011, in den 1970er Jahren entwickelt in Konstanz bei Telefunken Computer, bei seiner Auslieferung fast nur aus individuellen Maschinen bestand. Natürlich wäre mit ein wenig Muße alles schneller und besser gelungen. Aber so sind offenbar diese Macher-Typen. Lieber soll schnell eine 40%-Lösung raus als etwas später eine 60%-Lösung.
Dass Menschen euphorisch riesige Anstrengungen unternehmen und dann erkennen, dass doch das eine oder andere hätte besser laufen müssen, ist nichts Ungewöhnliches. Beispielsweise haben die deutschen Städte nach dem Krieg klotzige Betonbauten in die Lücken gestellt. Dabei waren die Bürgermeister und Gemeinderäte sogar stolz darauf, dass der Sichtbeton deutlich sichtbar blieb. Nicht lange dauerte es bis die meisten Bürger diese Gebäude als Schandfleck ansahen. Prompt wurden sie abgerissen oder umgebaut. Oder ein anderes Beispiel: Verkehrsminister Leber meinte, kein Ort in Deutschland solle mehr als 30 km von einer Autobahnauffahrt entfernt liegen. Seit Jahrzehnten kann jeder hellwache Zeitgenosse sehen, dass der Individualverkehr durch alternative Verkehrslösungen ergänzt und teilweise ersetzt werden muss.
Kein Wunder, dass bei etwas so Komplexem und so Verführerischem wie der Computertechnik der Eifer wie überall so auch in Deutschland zu riesigen neuen Lösungen führte.
Jugendträume erfüllen sich
Gute heile Welt: Der Brockhaus war 20 Jahre aktuell und diente allen Kleinkindern der Familie als Sitzerhöhung beim Mittagessen.