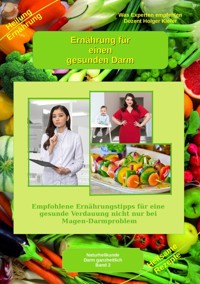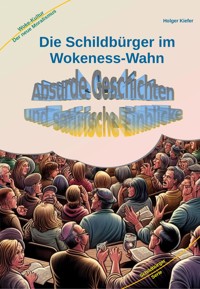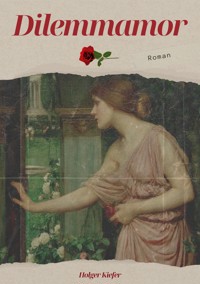
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dilemmamor ist ein Roman, der sich mit zwischenmenschlichen Beziehungen befasst. Es geht zum einen um die Rechtfertigung der Tötung eines missliebigen Nachbarn, zum anderen um die Beziehung zwischen dem vermeintlichen Mörder und der Tochter des toten Mannes. Beide befinden sich im mittleren Alter und sind für die neue, aufregende Liebe vielleicht schon zu erfahren und verkopft. Dennoch nähern sie sich Schritt für Schritt und lassen es darauf ankommen. Der Titel "Dilemmamor" enthält bereits das Thema "Liebe als zwiespältige Möglichkeit und unsicherer Zustand". Darüber hinaus enthält es auch verkürzt die philosophische Frage des so genannten Dilemmas morale, also einer Situation, in der wir moralisch nicht eindeutig und einwandfrei urteilen und handeln können. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Personen und suchen immer wieder aufs Neue einen Weg zum zufriedenen Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
O felix hominum genus,
si vestros animos amor
quo caelum regitur regat!
(Boethius: De Consolatio Philosophiae)
O glückseliges Menschengeschlecht,
wenn die Liebe auch euren Geist
lenkt, so wie sie den Himmel lenkt.
(Boethius: Trost der Philosophie)
Holger Kiefer
Dilemmamor
oder: Das unsichtbare Existente
Deutsche Erstausgabe
© 2023 Holger Kiefer
978-3-347-95725-1 (Hardcover)
978-3-347-95726-8 (e-Book)
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Erster Teil
1. Tod und Tat
2. Ins Reine kommen
3. Leuchtung im Park
4. Dünne Wände
5. Penetration I
6. Penetration II
7. Bruderliebe
8. Musik-Mosaik
9. Endgültigkeit der Ereignisse
10. Erwachen heiterer Gefühle
Zweiter Teil
1. Dichterfest
2. Kommunikation
3. Beziehungen I
4. Beziehungen II
5. Arien
6. Rømø
7. Verlust I
8. Verlust II
9. Neue Mordgedanken
10. Neues Leben
Vom Autor dieses Buches sind bereits folgende Titel erschienen:
Dilemmamor
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Tod und Tat
10. Neues Leben
Dilemmamor
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
Erster Teil
1. Tod und Tat
Nachdem er sich etwa eine Minute lang nicht bewegt hatte, um in dieser Zeit seinen Atem zu beruhigen und flach zu halten und auf das Treppenhaus hinauszuhören, zog er, als er keine Schritte, Wohnungstüren oder Stimmen vernehmen konnte, das Messer aus der linken Augenhöhle seines Nachbarn langsam heraus.
Geräuschlos und gleichmäßig ließ es sich parallel zum Nasenbein aus der Wunde entfernen, wobei einzelne Teile wie Hornhaut und Linse vom Stahl nicht ablassen wollten, der kurz zuvor ihre angestammte Heimat mit überraschender und roher Gewalt in ein schlammiges Schlachtfeld aus geborstenem Glaskörper, zerfetzten ZiliarMuskelfasern und aufgerissenen Augenkammern verwandelt hatte und nun nichts als einen Krater hinterließ, in dem die Ströme aus Blut, Gehirn und Tränenflüssigkeit seit dem gerade eingetretenen Tod schon zu trocknen anfingen.
Es war ein sauberer und schneller Stoß gewesen: Sauber, weil die Klinge, ohne seitlich auf einen Knochen zu gleiten und sich in ihn hinein zu schneiden oder gar mit der Spitze auf ihn zu treffen, direkt den Augapfel durchstieß und so ohne Hindernisse und hemmende Einwirkungen ins Gehirn eindringen konnte, um in kalter Penetration statt Leben Tod zu zeugen. Dichter nebeneinander können diese beiden Worte nicht stehen. Schnell, weil er ohne zu zögern das bereits aufgeklappte Messer innerhalb einer zehntel Sekunde aus der rechten Hosentasche zog, den Ellbogen anwinkelte und dann in entgegen gesetzter Richtung die Waffe ins Ziel führte.
Besser war es nicht zu bewerkstelligen – und der Zeitpunkt exakt der richtige: Das Telefon hatte angefangen zu läuten. Der alte Mann hatte beim ersten Klingeln zum Apparat hinüber geschaut, dann zurück zu seinem Gegenüber, um ihn mit einem stummen Blick zum Gehen aufzufordern. Dabei öffnete er beide Augen etwas weiter und blickte ihn direkt an, hielt seinen Kopf still, als ob er die Anweisung dazu erhalten hätte, um ein Lichtbild erstellen oder sich erschießen zu lassen. και καιρός… - alles hat seine Zeit.
Während des Einstichs öffnete sich der Mund der Zielperson, die aber doch zu überrascht war, um einen Schrei des Schmerzes oder der Angst, der Verteidigung oder des Zuhilferufens entwickeln zu können. Um kein Risiko einzugehen, setzte er die linke Hand, welche sowieso nichts besseres zu tun hatte, auf die sich öffnenden Lippen, die nur noch den letzten Atemzug aus dem Körper entließen.
Unmittelbar darauf sackten die 80 Kilogramm Gewicht (als Lebendgewicht konnte der Zellhaufen vor ihm schon nicht mehr bezeichnet werden) in sich zusammen; der Körper glitt an der Wand nach unten, während seine beiden Hände die Geschwindigkeit halb kontrollierten und halb von der Masse des Toten geführt wurden. Dabei entstand ein Lächeln auf dem Gesicht des Mörders, welches Goethes Zeilen aus dem „Fischer“ darauf verursachten: „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“. Und als alles getan war, ritzte er mit der Messerspitze ein Kruzifix auf die Stirn des Katholiken, der die längste Zeit über ihm gewohnt hatte – vom Haaransatz bis zur Nasenspitze und von der rechten Schläfe zur linken: Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Sein Plan ging auf – war bisher aufgegangen und würde auch weiterhin aufgehen, wenn er nicht unachtsam wurde und irgendetwas dem Zufall überließ. Denn es gibt keine Zufälle; es gibt nur Unachtsamkeiten und unliebsame Überraschungen. Aber denen konnte er zuvorkommen.
Er steckte das zusammengeklappte Messer in die Hosentasche und untersuchte seine Arme und das Gesicht, die Kleidung und insbesondere die Schuhe. An allem war Blut zu erkennen; hier ein großer verschmierter Fleck, dort nur ein paar feine Tropfen; hier eine Schliere, dort nur ein Spritzer.
Das Wichtige war nur, dass es nicht sein eigenes Blut war. Deshalb untersuchte er sein Äußeres so genau. Aber er konnte keinen Schnitt entdecken. Die Fäuste des ehemaligen Nachbarn konnten seine Lippen oder sein Zahnfleisch nicht blutig schlagen. Es hatte keinen Kampf mit dem ehemaligen Nachbarn gegeben, bei dem er durch das eigene Messer hätte verletzt werden können. Nur körperfremdes Blut – und das war gut.
Er schaute sich noch die Wände und den Teppich an, bevor er die Wohnung verlassen wollte. Die Handlung, die sein nächster Gedanke ihm vorgab, war riskant und dreist, aber gefiel ihm vom ersten Moment an so sehr, dass er keine Sekunde lang daran dachte, sie nicht auszuführen. Er öffnete den Schrank neben der Wohnungstür und nahm den Staubsauger heraus, zog das Kabel von der internen Spule und drückte den Stecker in die Dose.
Es war kurz nach zwei, die Mittagszeit noch nicht vorbei. Sein Gewissen ließ ihn jetzt zögern, die Saugmaschine zum Heulen zu bringen. Doch es war nicht seine Wohnung, in der er sich befand. Schließlich passte es zu dem Alten, der jetzt als toter Sack in seinem Blut lag, in der Mittagszeit die anderen Hausbewohner zu stören und ohne Rücksicht auf irgendetwas seinen Launen nachzugehen. Irgendjemand würde sich gerade daran noch genau erinnern können, den Störenfried genau während der Mittagszeit – war ja typisch – Staub saugen gehört zu haben.
Also schaltete er den Staubsauger ein und saugte den Teppich in der gesamten Wohnung ab, achtete darauf, nicht zu nah ans Fenster zu gelangen und drehte zwischendurch sogar den Saugkopf ab, um mit dem bloßen Rohr in die Ecken an der Decke und hinter den Türen zu gelangen. Besonders sorgfältig saugte er um die Beine des Verblichenen herum, wendete dessen Oberkörper hin und her, um auch jedes Haar zu erwischen, das ihm gehören konnte und eventuell auf der Kleidung des Ausgebluteten oder hinter seinem Rücken mit Blut an die Wand geklebt… oder das sich in eine schweißgefüllte Hautfalte gelegt… oder das sich durch eine aufgrund schwungvoller Bewegungen verursachte Luftströmung hinter eine Teppichleiste geschwebt…
Er war sich sicher, alle Möglichkeiten durchdacht zu haben, wo ein Haar überall hinfallen kann, als er das Gerät ausschaltete, den Staubsaugerbeutel wechselte und den Schrank neben der Wohnungstür wieder verschloss, nachdem das Stromkabel aufgerollt und die Maschine fachgerecht verstaut war.
Ein letztes Mal betrachtete er die verschiedenen Stellen und Ecken, an denen er sich aufgehalten hatte, überlegte dabei, ob irgend etwas hätte verloren gehen können, besah sich die graue Leiche mit dem ausgetrockneten Auge, Hände, Schultern, Kinn, Ohren und was es sonst noch an einer Leiche zu beschauen gibt. Erst als es nichts mehr zu bedenken gab, horchte er wieder aufmerksam auf das Treppenhaus hinaus, nahm den Staubsaugerbeutel behutsam in die linke Hand und verließ leise die Wohnung.
Er zog die Tür von außen ohne Zögern zu und ging mit großen und schnellen Schritten den Korridor entlang und treppab ins darunter liegende Stockwerk, schloss geräuschlos die Tür zu seiner Wohnung auf und glitt hinein. Im Badezimmer zog er seine gesamte Kleidung aus und steckte sie in eine Plastiktüte. Er nahm Wasser und wusch sich die Hände vor dem Spiegel. Als er aber sah, dass auch in seinem Gesicht und in seinen Haaren verklebtes Blut noch deutlich zu erkennen war, wusch er sich auch den Kopf und sprach dann: „Es ist vollbracht.“
Er zog frische Wäsche an – kurzärmliges Unterhemd, kurze Unterhose, helle Hose, weißes Oberhemd und blaue Strümpfe und Schuhe. Er packte die Schwimmsachen zusammen – Brille, Badehose und Tücher – und steckte auch die anderen Utensilien ein: Haustürschlüssel, Fahrradschlüssel, Luftpumpe, Stirnband. Er ging in den Keller, verstaute Schwimmtasche und Kleidertüte im Fahrradkorb, entsicherte sein Rad und schob es aus dem Abstellraum in den Kellerkorridor und von da in die Parkgarage, ließ dabei sämtliche Zwischentüren in die Schlösser fallen, setzte sich auf den Sattel und fuhr hinaus auf die Straße in den wärmenden Sonnenschein und in der erfrischenden Luft einem entspannungsreichen Nachmittag entgegen.
Währenddessen klingelte in der Wohnung des alten Mannes erneut das Telefon. Die Tochter wiederholte den Versuch, ihren Vater zu erreichen. Dabei kam es ihr nicht darauf an, ihm ein paar Worte mitzuteilen und über ihre Tätigkeiten der vergangenen Woche zu berichten, ihm die Zeit zu vertreiben oder ihm gar eine Freude zu machen, um ihm womöglich noch anzudeuten, dass er nicht überflüssig sei. Er war überflüssig. Und der einzige Grund, warum sie nach all dem, was passiert war, noch den Kontakt aufrecht erhielt, war die Hoffnung, eines Tages zu erfahren, dass er nicht mehr am Leben sei.
Jedes Mal, bevor sie den Telefonhörer in die Hand nahm, stieg der gleiche Gedanke in ihrem Kopf auf: Warum konnte dieser alte Mann, dieser spießige Verbrecher nicht einfach den Geist aufgeben? Warum bleiben immer diejenigen unangetastet, die Blut an ihren Händen tragen und andere Menschen quälen? Wenn sie gerichtet werden sollen, beschützt sie sogar noch das Gesetz: Unsichere Beweislage, widersprüchliche Zeugenaussagen, mangelndes öffentliches Interesse et cetera et cetera. Aber auch ohne diese Schuld war er alt genug zum Sterben, um der nachfolgenden Generation Platz zu machen und zu weichen; wenn es sein muss, auch mit einem Tritt in den Hintern. Was hat er hier noch zu suchen? Er war keiner von diesen netten alten Geschichtenerzählern und weisen Tröstern, die niemals sterben sollten. Er gehört zu den Menschen, ohne die wir besser leben könnten. Er war einfach nur überdrüssig, überflüssig, überfällig. Was will er noch hier?
Sie ließ es ungewöhnlich oft klingeln. Als sie darüber nachdachte, konnte sie sich nicht daran erinnern, schon einmal so lange gewartet zu haben. Ihr Vater hatte in der Vergangenheit schon nach wenigen Klingelzeichen abgenommen – vielleicht zwei, maximal drei Male hatte es sonst geklingelt.
Aber sie bemerkte auch, dass sie nicht unbedingt wartete oder ungeduldig wurde. Sie ließ es unbekümmert weiter klingeln, während der nächste ihr inzwischen nicht mehr ungewohnte Gedanke wieder ins Bewusstsein trat. Ursprünglich war es ein Gedanke gewesen; dann wuchs er heran zur Vorstellung, und heute entdeckte sie erneut, dass das ganze Gebilde viel tiefere Wurzeln aufwies und noch etwas viel Größeres darstellte: Einen Wunsch. Es war der Wunsch, dass ihr Vater tatsächlich in diesem Moment, während das Telefon in seiner Wohnung klingelte und vielleicht auch seine Nachbarn stutzig werden ließ, leblos auf dem gepflegten Teppich seines Wohnzimmers oder in dem kleinen Flur lag, beide Füße noch in den verschlissenen Pantoffeln, die ihm seine Frau vor dreißig Jahren – einem ganzen Menschenleben, wenn es frühzeitig beendet wird – zum Geburtstag geschenkt hatte.
Vielleicht ein Herzinfarkt oder ein Hirnschlag; irgendein rettendes Blutgerinnsel oder die ausreichende Verengung seiner Herzkranzgefäße. Sie würde sofort, obwohl und weil sie seit ihrer Kommunion keine Kirche mehr betreten hatte, in der nächsten Gebetshalle drei Kerzen anzünden: Eine für ihre Mutter, eine für ihren Bruder und eine für die Schulmedizin, die wieder einmal nicht helfen konnte. Sie würde allen drei Göttern danken, dass sie nun endlich frei sein und ein neues Leben beginnen könnte.
Nach der fünfundzwanzigsten Wiederholung des Klingelzeichens wurde die versuchte Verbindungsaufnahme von der Telefongesellschaft automatisch abgebrochen. Während ihre Augen starr aus dem Fenster blickten, drangen die akustischen Signale in ihrer abgehackten und telefontypischen Monotonie wie die Herzrhythmusfrequenz eines Kardiographen in ihr Ohr, als ob ein Leben verlängert werden sollte. Aber sie wollte keine Leben verlängernden, geschweige denn Leben rettenden Maßnahmen für ihren Vater; und um das vor einem imaginären Gegenüber als bezeugender Empfänger zu bestätigen, legte sie ihren rechten Zeigefinger sehr gelassen auf die Unterbrechungstaste. Das Telefon schaltete sofort auf den Wahlmodus um und erzeugte im Hörer den lang anhaltenden Ton, den sie erleichtert und aufatmend vernahm: exitus mortalis.
Sie legt den Hörer auf und schaut erwartungsvoll in den kahlen Ahornbaum, der noch blätterlos vor ihrem Fenster steht und vielleicht den Frühling schon in seinen Adern spürt. Doch bleibt beiden im Moment nichts anderes übrig als auf die steigenden Temperaturen und aufspringenden Knospen zu warten, denn noch war es dafür zu kalt – der Winter war noch nicht ganz überwunden, die Zeit noch nicht ganz gekommen, obwohl die Sonne und ein wolkenfreier Himmel ihre ersten Versprechen abgaben und ein Kohlmeisenpaar zwischen den Zweigen des Ahornbaums teils flog, teils hüpfte und sich ebenfalls über den von den Ästen im Tauen fallenden Schnee zu freuen schien.
Als Tochter hätte sie sich vielleicht Sorgen machen sollen, hätte sich ins Auto setzen sollen, um an der Wohnungstür ihres Vaters zu läuten und zu lauschen, ob sich irgend etwas da drinnen bewegt, um nach ihrem Vater zu sehen, wie es so schön heißt – sich um ihn kümmern…sorgen… Aber sie wollte nicht nach ihm sehen, wollte sich nicht kümmern und sorgen; hielt die Zeit für gekommen, um das zu beenden, was die einen als Beziehung, andere als Verbindung und wiederum andere als Verhältnis bezeichnen.
Für sie war es ein von außen auferlegtes, erzwungenes Verwandtschaftsverhältnis, zu dem sie keinen inneren Bezug mehr hatte. Ihr Vater hatte selbst alles nach und nach zerstört, was dieses Verhältnis lebenswert gemacht hatte. Aus Anstand (was immer das auch sein sollte) und falschem Gewissen (was immer das auch sein sollte) hatte sie meist am Wochenende bei ihm angerufen, dabei stets die gleichen Sätze mit ihm ausgetauscht und sich fast auf die Sekunde genau jedes Mal nach drei Minuten wieder verabschiedet.
Es war zwar seltsam, dass er an diesem Tag den Hörer nicht abgenommen hatte; aber es tangierte sie auch nicht weiter. Sie hatte den Versuch unternommen und damit ihre Pflicht getan. Am nächsten Tag wollte sie es noch einmal versuchen und erst, wenn er am nächsten Wochenende nicht zu erreichen sein würde, eventuell weitere Schritte unternehmen. Aber das war noch viel zu weit entfernt und heute schließlich ein Tag, den sie nutzen und ohne Belastungen leben wollte. Also wandte sie sich der Sonne zu und startete einen langen Spaziergang.
2. Ins Reine kommen
Friedlieb war inzwischen durch die ganze Stadt gefahren; vom Süden, wo er wohnte, zunächst in den Westen; hatte dort die Schuhe, die er bei der Tötung getragen hatte, von einer Brücke in den Fluss geworfen, der sie in seine wogenden Arme schloss und mit seinen Wellenküssen ins Unsichtbare hinabzog.
Dann war er weiter in den Norden geradelt, hatte dort in den Mülleimern zweier Grünanlagen Unterhemd, Hose und Strümpfe verteilt, alle Teile kurz zuvor noch in Fetzen zerschnitten, damit sie nicht sofort als blutiges Kleidungsstück zu erkennen waren, um dann die Unterhose und das Oberhemd (beides ebenfalls bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten) im Osten der Stadt zwischen den Teilen eines Sperrmüllhaufens zu deponieren. Das Messer schleuderte er auf dem Weg zum Schwimmbad in hohem Bogen während der Fahrt vom Rad aus in eine dichte Rhododendronpflanzung, nachdem er es sorgfältig geputzt und dann mit einem Stein zerkratzt hatte, damit es schneller rostete. So hatte er sich also aller Teile entledigt, die er während einer Lebensbeendigung an sich getragen hatte, und konnte nun befreit in Richtung Schwimmbad fahren, wo das Getümmel um diese Uhrzeit immer größer wurde, er das Wasser in Augenschein nahm und hineinstieg, sich vor dem Volk die Hände wusch und dann ganz mit dem Körper in Gedanken an ein Baptisterium untertauchte.
Hatte er zuhause die sichtbaren Spuren der Flüssigkeiten des fremden Körpers bereits beseitigt, tilgte er nun mit Hilfe des Chlors alle weiteren letzten Hinweise, selbst diejenigen unter den Fingernägeln und auf der Haut und auch diejenigen auf den Fingernägeln und unter der Haut.
Das Wasser fühlte sich zunächst kühl an und erfrischte ihn. Er schloss die Augen und tauchte unter, nachdem er sich der freien Bahn vor ihm vergewissert hatte, zog seinen Körper mit langsamen Armzügen unter der Oberfläche entlang und genoss das geräuschlose Gleiten im stillen Blau.
In der Mitte des Beckens tauchte er wieder auf und schwamm mit ruhigen und regelmäßigen Bewegungen an den jenseitigen Beckenrand, drehte ohne zu pausieren um und legte so dreißig Bahnen zurück, auf deren jeder sich ein Bild entspann, das sein Denken wie eine langlebige Sternschnuppe durchlief, um dann am Ende seiner Bahn auszuglühen und im Nichts zu verschwinden.
Der erste Grund waren die dröhnenden Stimmen des zu laut gestellten Fernsehgerätes. Jeden Abend zwischen 19 und 23 Uhr musste Friedlieb seinem über ihm wohnenden Nachbarn die erzwungene Gesellschaft beim Fernsehen leisten, was Ursache seiner Lösungstat wurde, die jeden Abend einen neuen Impuls bekam.
Es hatte ihn anfangs, nachdem er in das Haus eingezogen war, nicht gestört. Das lag allerdings nicht daran, dass er die Stimmen nicht wahrgenommen hatte, sondern daran, dass sein Nachbar, wie er später erfahren hatte, zu dem Zeitpunkt im Urlaub war, so dass Friedlieb sich sogar selbst beglückwünschte, so ruhige Nachbarn zu haben.
Als die Phase paradiesischer Ruhe vergangen war und die ersten Attacken von oben auf ihn nieder prasselten, suchte er das Gespräch mit dem älteren Herrn und forderte ihn zur Rücksichtnahme auf. Dieser jedoch war der Überzeugung, aufgrund seines Alters das Recht zu allem erworben zu haben und der verdiente Mitbürger dieses Staates zu sein, der auf niemanden Rücksicht zu nehmen brauche und noch dazu schwerhörig sei.
In der Tat war er in doppeltem Sinne schwerhörig, was seine Folgen hatte; denn wer nicht hören will, muss fühlen; und wer nicht hören kann, muss doppelt fühlen. Gegen die ungeschriebenen Gesetze werden wir niemals anschreiben können, geschweige denn sie durch geschriebene abschaffen. Denn ob wir hören und verstehen, liegt nicht an der Funktionstüchtigkeit unserer Organe oder an der Anzahl von Gesetzen, sondern zum größten Teil allein an unserem Willen.
Also machte der alte Mann immer wieder den gleichen Fehler, nicht verstehen zu wollen, dass er durch die Ausübung seines von ihm als „erworben“ bezeichneten Rechts, keine Rücksichtnahme ausüben zu müssen, den Tatbestand des Störens und Nervenaufreibens stur und penetrant wiederholte und so das Urteil über ihn mit eigener Hand durch das Betätigen der Positivkomponente des Lautstärkereglers auf der Fernbedienung jedes Mal aufs Neue selbst unterschrieb. Mit anderen Worten: Der alte Mann war selbst schuld.
Wer seine nächsten Mitmenschen skrupellos vor die Wahl stellt, entweder die eigene, für viel Geld gemietete Wohnung des Nachts zu verlassen, diese Menschen dadurch in Kälte und Dunkelheit treibt und sie darüber hinaus den Gefahren der Straße aussetzt, oder in der Wohnung verharrend sich Fernsehserien mit oberflächlichem bis dümmlichen Inhalt anzuhören, kann nicht auf Verlängerung des eigenen Lebensrechts plädieren und mit mildernden Umständen rechnen.
Also dachte Friedlieb am Ende der ersten Bahn und nietzschte weiter.
Nachdem er sich nach der Wende am Beckenrand abgestoßen hatte und mit der zweiten Bahn begann, gab seine Harnblase durch ein kurzes Signal ihren Drang nach Entleerung zu erkennen. Der innere Blasenschließmuskel reagierte durch eine prompte Kontraktion, regulierte den Vorgang und ließ den Schwimmer ohne weitere Belästigungen sich auf seine momentane Tätigkeit konzentrieren. Die bestand neben dem Schwimmen in erster Linie im Reflektieren; und dieser kurze Vorfall in der Mitte seines Körpers lieferte ihm das zweite Bild – einen weiteren Grund für seine Tat, ein weiteres Argument, das seinem Gewissen Rechtfertigung einflößte und seiner Überzeugung als weitere Stütze diente.
Seine Wohnung lag im ersten Stock einer Wohnanlage in einem Stadtviertel, in dem es nur wenige Geschäfte, dafür aber zwei Supermärkte gab. In dem einen wurden die Waren sehr günstig verkauft, während auf die Artikel in dem anderen Supermarkt noch einmal ein Drittel aufgeschlagen wurde für die Menschen, die gern etwas mehr ausgeben, um sich von „den anderen“ abzuheben, auch wenn die Qualität der Produkte die gleiche war. Dass die beiden Supermärkte dem gleichen Konzern angehörten, der seine Preispolitik eben genau diesen Eitelkeiten der Bewohner anglich, war vielen nicht bewusst und wurde vom Rest immer wieder erfolgreich ausgeblendet.
Die Bewohner aus Friedliebs Wohnanlage kauften in der Regel im billigen Markt ein oder fuhren am Samstagmorgen mit dem Auto in den Nachbarort, wo ein dritter Supermarkt die Waren noch billiger abgab. Es war wichtiger, mehr zu kaufen als sich nur sagen zu können, wenigstens Qualität gekauft zu haben. Der teure Supermarkt wurde dann aufgesucht, wenn noch eine Flasche Wein fehlte oder die Salzstangen aufgegessen waren und der billige Supermarkt bereits geschlossen war.
Dass Salzstangen und Wein genau so wichtig werden können wie Knäckebrot und Yoghurt, wissen alle, die gern vor dem Fernseher sitzen – wie unser alter Mann es gern tat. Auch er machte sich wie alle Fernsehkonsumenten längst keine Gedanken mehr, was er während des Auf-bunte-Bilder-Starrens alles in sich hineinstopfte. In die Augen und somit ins Gehirn dringt eine unerschöpfliche Flut von Bewegungen, die das eigene Leben lahm legt; und in den Mund wird ununterbrochen Kalorienmaterial hineingeschaufelt, welches das Feuer erstickt anstatt es anzufachen.
Also saß der alte Mann wie so viele seiner Artgenossen unbeweglich vor dem Elektronikkasten, der ihm visuelle und akustische Signale in einer solchen Geschwindigkeit zuflimmerte, damit er ohne jede Möglichkeit auf individuelle Handlungsfreiheit wie angenagelt in seinem Sessel sitzen blieb und in sich hinein schaufelte und goss, ohne den Brennstoff verwerten zu können. Dieser verteilte sich im Körper und sammelte sich natürlicherweise auch in Blase und Darm an, was bei den meisten Menschen nur eine gewisse Zeit lang gut geht, dann aber zu der unvermeidlichen Handlung führt, die niemand gerne aufschiebt.
Ungern, aber eben notgedrungen erhob er sich schwächlich aus seinem angewärmten Sessel, schlüpfte währenddessen mit den Füßen in die Pantoffeln, die ihm seine Frau vor dreißig Jahren zum Geburtstag geschenkt hatte, und die ihm nach jeder halben Stunde ein Stück weiter entglitten waren und schlurfte lustlos in Richtung Badezimmer, um sich dort zu erleichtern. Mit leicht gespreizten Beinen stand er vor dem Porzellansitz, hatte sein stets tief herab hängendes Glied aus dem Stoffgewirr zweier Hosen hervor gekramt und ließ die Muskeln entspannen.
Für unseren Schwimmer, der später zu seinem Lebensbeender werden sollte, stellte sich die Situation etwas anders dar: Dieser war nach elf Stunden eines durchschnittlichen Arbeitstages in seine Wohnung zurückgekehrt, hatte einen Teller Nahrung zu sich genommen und danach eine knappe Stunde geruht – sprich die Augen geschlossen und versucht, die verschiedenen Störungen von der Straße her oder aus den anderen Wohnungen heraus nicht wahrzunehmen. Da ihm dies fast nie gelang, hatte er sich erhoben, um Tee zu kochen und die kurze Zeit zu genießen, die ihm in der Regel am Abend noch blieb. In kurzer Vorfreude stand er in der kleinen Küche und füllte die bestimmte Menge an schwarzem Tee in das Netz, erhitzte Wasser und spülte die Kanne aus, die vom Vorabend noch einen Rest enthielt.
Als die verschiedenen Wirk- und Aromastoffe aus den getrockneten Teeblättern gezogen wurden, überlegte er und wählte aus dem Dutzend angefangener Bücher und aufgeschlagenen Zeitschriften und Zeitungen eine Lektüre aus, die er an diesem Abend fortsetzen wollte. Nach vier Minuten schenkte er sich einen Becher voll, überprüfte die Stufenregler am Herd, nahm den Becher in die Hand, schaltete das Licht in der kleinen Küche aus und schloss die Tür, während ihm aus dem Wohnzimmer schon ein Hauch Patchouli- und Opiumöl in die Nase wehte und innere Stimmen ihm vorschlugen, die Pastorale oder die Pathétique einzulegen.
Er setzte sich behutsam in einen der beiden Ledersessel, atmete ein paar Male den Tee ein und trank ihn in kleinen Schlücken zur Hälfte aus, bevor er das ausgewählte Buch aufschlug und zu lesen anfing. Fast schon hatte er in diesen wenigen Minuten seine Umgebung und vor allem seine Mitmenschen so ganz nebenbei vergessen, als der erste Satz des Musikstückes verklungen war und in diese Pause der Besinnlichkeit und Kontemplation das plätschernde Pullern des schräg über ihm stehend pinkelnden Pissers prasselte.
Vorbei war es dann in der ersten Sekunde, in der er dieses Geräusch wahrnahm, mit Besinnlichkeit und Kontemplation. Vorbei war die ruhige Entspannung vom Tage, wenn auch das Blut schon durch ein langsamer schlagendes Herz gemächlicher durch die Adern pulsierte. Vorbei war es mit der momentanen Musik und Muße, der Idylle eines warm wehenden Wasserdampfes und dem Genuss einer gesteigerten Glückseligkeit. Übertragen gesprochen pisste ihm da gerade jemand ans Bein.
Am Beckenrand angekommen pochte der Schwimmer auf sein Recht zur Selbstverteidigung und verteidigte seine Handlung gegenüber einer von niemandem gestellten Frage und des durch diese Überlegung in Frage gestellten Selbst. Wenn der alte Mann nicht so penetrant und direkt auf die Wassersäule in seine Toilette gestrullert, sondern mit Rücksicht auf den unter ihm Wohnenden den Strahl an den inneren Rand der Porzellanschüssel gelenkt hätte, würde er wahrscheinlich noch leben, wenn wir das, was noch kommen wird, einmal für fünf Sekunden außer Acht lassen.
Also dachte Friedlieb am Ende der zweiten Bahn und nietzschte weiter.
Nun darf sich der Leser nicht echauffieren, wenn er darüber nachdenkt, dass ein Mensch einen anderen Menschen – denn beide bezeichnen sich selbst ja so und werden auch von anderen als solches bezeichneten – tötet, weil dieser auditiv Zeuge wird, wie jener einem natürlichen Bedürfnis nachkommt und das positive Ergebnis einer körperlichen Funktion in ein für diesen negatives Erlebnis umwandelt. Dieser Leser rufe sich die Erkenntnis unserer Medizinforschung in Erinnerung, dass Menschen als Ergebnis tagelanger Folterungen ihren Verstand verlieren, wenn die Versuchsleitung einzelne Tropfen Wassers aus einer bestimmten Höhe in bestimmten zeitlichen Abständen auf eine bestimmte Stelle auf den zuvor kahl geschorenen Schädel fallen lässt. Die Reaktion darauf äußert sich nicht selten in gesteigerter Aggressivität, die sich gegen das gepeinigte Individuum selbst richten kann oder sich auch gegen den oder die Peiniger richten würde, hätte der Proband (in anderen Sprachgebräuchen auch als „Gefangener“ oder „Insasse“ bezeichnet) die Möglichkeit zu einer nach außen anstatt nach innen gerichteten Attacke. Da diesen Menschen aufgrund schon aufgezeichneter Erfahrungen die Bewegungsfreiheit fast vollständig genommen ist, indem sie vor dem Experiment angekettet, angeschnürt, angepflockt oder angeschraubt sind, bleibt dem Gehirn nichts anderes übrig, als die unterdrückten und sonst katalytisch wirkenden Muskelimpulse im Kopf durch virtuelle Raserei zu ersetzen, was in medizinischen Kreisen „Substitution“ genannt wird, und was in Kreisen Uniform tragender Organisationen nicht selten als Bestätigung einer bestimmten These oder als Grund zur Feier einer gewonnenen Wette diente und dem dazu gehörenden Gläschen Sekt den Anstoß gab.
Es ist also nicht das Was oder Wann dieser Aktion, das ausschlaggebend für eine Re-Aktion ist, sondern das Wie in seinen Unterformen des Wieoft und Wie-lang und Wieso-überhaupt. Doch bevor wir zu sehr in die wissenschaftliche Unverständlichkeit und unverständige Wissenschaft abdriften, sei der Faden aufgegriffen, der uns wieder zu der jungen Frau leitet, die während eines langen Zeitraums ihres Lebens zu der Rolle gezwungen war, die Tochter des alten Mannes und bis zum Tod seiner Ehefrau auch die Tochter dieses zweiten weiblichen Wesens zu spielen, dessen Existenz wir für einen Augenblick aus dem Dunkel menschlichen Vergessens und der Finsternis humaner Gleichgültigkeit wieder aufleuchten lassen wollen.
3. Leuchtung im Park
Die junge Frau hatte, nachdem sie ihren Vater am Telefon nicht erreichen konnte, eine leichte Jacke über den Pullover angezogen und ihre Wohnung verlassen. Sie atmete bereits mit der kühlen Luft den erfrischenden Sauerstoff ein, der im Überfluss in ihre Lungen strömte und während des Eindringens in die Blutbahnen sehr schnell das Gefühl erzeugte, über erneute Kräfte zu verfügen, mitgeschleiften Ballast in ihren Gedanken leichter fallen lassen und für die nächsten Tage und anstehenden Aufgaben schneller und vollständiger zufrieden stellende Lösungen finden zu können.
Dennoch kamen in unregelmäßigen Abständen jene Momente, in denen sich Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder an die Oberfläche der Gegenwart drängten, von denen sie geglaubt hatte, dass sie nach so vielen Jahren vielleicht doch einmal auf dem Grund ihres Unterbewusstseins ohne Möglichkeiten, noch weiter in ihr Leben einzugreifen, regungslos liegen bleiben würden. Aber wahrscheinlich ist auch das nur ein leerer Wunsch, der wie alle leeren Wünsche eine Flucht vor der Erkenntnis widerspiegelt, dass die Abwesenheit von Verletzung und Schmerz in dieser Welt eine Utopie ist, also ein Nirgendwo und ein Nirgendwann, eine Uchronie eben, die auch morgen und in tausend Jahren noch als solche ihre täglichen Beweise liefert.
Sie hatte eben die beiden Magnolienbäume am Eingang des Parks passiert, an denen in den fetten Knospen der Wille zu neuen Farben und neuer Produktion schon zu erkennen war; ein unaufhaltsames Wachsen und Begehren war der natürliche Antrieb, der nur durch konsequente Gewalt und Vernichtung verhindert und beendet werden konnte. Solange niemand diese Bäume fällt, werden sie sich immer wieder dem periodischen Wandel der äußeren Gegebenheiten anpassen – blühen und verblühen, um im nächsten Jahr wieder zu blühen und zu verblühen, bis nach vielen unabsehbaren Wiederholungen das hohe Alter und die große Schwäche das Leben beendet – wenn nicht konsequente Gewalt und Vernichtung diesen Lebenslauf verkürzt.
Während mehrere hohe Stimmen sie dazu veranlassten, ihre Augen auf die spielenden Kinder in der Entfernung zu richten, sah sie zwar die bewegten Figuren auf der Rutsche und an den Klettergerüsten, betrachtete aber ein ganz anderes Bild, das in dieser Situation nur für sie sichtbar war.
Es war ihre Mutter, die mit abgemagertem Gesicht fast regungslos in einem weiß bezogenen Bett lag und auf ihren Tod wartete. Es muss einer der letzten Tage gewesen sein, als sie ihrer sterbenden Mutter Gesellschaft leistete – auf dem Stuhl sitzend, den sie neben das Kopfende gestellt hatte, oder am Fenster stehend, um wenigstens im Anblick der grünen Wiesen und Bäume, die neues Leben atmeten, Abwechslung und Trost zu finden.
Sie redeten nur selten vom Tod, obwohl er derjenige war, den sie beide als nächsten Besucher erwarteten – beide mit dem gleichen Gedanken: es endlich hinter sich zu haben. Wahrscheinlich hatten sie bereits in den vergangenen Monaten, seitdem ihre Mutter den ärztlichen Befund erhalten hatte, genügend über dieses Thema gesprochen, so dass jetzt nichts anderes übrig blieb, als die Zeit mit Alltagsgesprächen, gemeinsamem Schweigen und einsamem Warten vergehen zu lassen – die Mutter wie eine Braut in Weiß gekleidet, die Tochter ohne Aufgeregtheit und Neugier mit dem Blick aus dem Fenster wie auf der Suche nach dem Bräutigam, der nicht hinter der letzten einsehbaren Wegeskurve endlich auftaucht, sondern unsichtbar das Versprechen einlöst, das er uns mit der Geburt gegeben hat.
Und obwohl sie meinten, schon genügend über „dieses Thema“ gesprochen zu haben, war beiden nicht klar, was sie eigentlich damit meinten. Erst wenn wir aufhören, uns vor vermeintlich unangenehmen Themen verstecken zu wollen, und anfangen, ihnen ins Auge zu sehen, werden wir feststellen, dass diesen Themen eine Menge ihrer Bedrohlichkeit und Macht über unser Verzagen schon zu Beginn genommen ist.
Sie hatten über den Tod als Daseinszustand gesprochen, der in unserem Sprachgebrauch dem Leben gegenüber gestellt ist, als eine Situation, die uns aus unserer gewohnten Umgebung und von den Menschen reißt, an die wir gewöhnt sind, und die wir zu lieben vorgeben.
Sie hatten über den Tod in dem Bewusstsein gesprochen, dass es eine unumkehrbare Veränderung unserer Existenz bedeutet, ohne zu bedenken oder gar zu wissen, ob diese Veränderung nicht wie so viele Veränderungen einer Verbesserung gleichzusetzen sei.
Sie hatten über den Tod als unabwendbare Gefahr gesprochen, ohne darüber nachzudenken, dass das Schrecken erregende Bild, welches uns von Kindheit an vorgezeichnet wird, nur von sehr weltlichen und äußerst irdischen Personen und Institutionen stammt, die wie wir auch nur Geld benötigen, um sich die Dinge kaufen und erhalten zu können, die eine innere Vorstellung begehrt.
Sie hatten kaum über das Sterben gesprochen, vielleicht weil das Sterben sie in seinem letzten Stadium von dem Moment an begleitete, in dem sie aufwachten, und sie erst dann wieder für einen kurzen Moment verließ, wenn der Körper und der Geist in der Erschöpfung und seinem äußeren Anzeichen des Schlafs sich Erholung verschafften, sich also etwas holten, was von ihnen oder aus ihnen abgeschöpft wurde – oder was an ihm abgeschafft und verbraucht, hinweggenommen und benutzt worden war, so wie es der natürliche Kreislauf uns vorschreibt.
Niemals steht etwas als plötzliche Schöpfung vor oder in uns, das dann nur noch benutzt zu werden braucht, als hätte es jemand absichtlich stehen gelassen oder vergessen, weil er es selbst nicht (mehr) gebrauchen kann – oder gar geschenkt, um uns eine Freude zu bereiten oder eine Aufgabe zu übertragen. Diese Geschichte lässt sich nur von Kindern glauben, die noch nicht gelernt haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Wir müssen die Schöpfung selbst vollziehen und selbst entscheiden, wofür wir die gewonnenen Kräfte einsetzen; uns dann Erholung verschaffen, wenn die Reserven zur Neige gehen und nicht erst, wenn sie völlig verbraucht sind, um rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, auch in der nächsten Stunde, am nächsten Tag und im nächsten Jahr nicht in Jerusalem, sondern im Hier und Jetzt mit dem weitermachen zu können, was unser Interesse oder unsere Überzeugung beschäftigt.
Und sie hatten kaum über das Leben gesprochen, was hauptsächlich durch eine Person fremdbestimmt war, so dass sie beide – Ehefrau und Tochter – auch gar nicht wussten, wovon sie hätten reden sollen.
Die junge Frau drehte den Kopf zur Seite, um sich absichtlich von den Gedanken an die Mutter und die letzten Tage ihres gemeinsamen Lebens abzuwenden und wieder zurück zu finden in die Gegenwart und den Genuss des Moments, den spielenden Kindern und den sich im Spiel verfolgenden Blaumeisen. Sie blickte abwechselnd direkt auf einzelne Krokusse und Schneeglöckchen, die als erste ihrer Art schon durch das vom Winter noch etwas schmutzige Grün der Rasenfläche gewachsen waren und ihre Farben wie Standarten in die Höhe hielten. Wieder hatte das Leben gewonnen, war jetzt an der Reihe, nutzte diesen Moment, der ihm zugesprochen wurde, und durchmaß die ihm zugedachte Zeit.
Sie ließ ihre Blicke durch den Park schweifen, der ihr zwar von früheren Spaziergängen nicht ganz fremd war, aber durch die Offenheit nach allen Seiten hin ihr auch nie ganz vertraut werden würde – wie ein Mensch, dachte sie, der seine Gewohnheiten wechselt oder besser noch gar keine hat, der nicht einzuschätzen ist und unberechenbar bleibt, weil er seinen Instinkten und momentanen Launen folgt, ohne auf das Rücksicht zu nehmen, was andere von ihm erwarten oder sogar fordern und sich somit herausnehmen, sein Leben zu bestimmen.
Sie hatte lange darauf warten müssen, so zu leben, dass sie niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist, wenn sie den beruflichen Teil des Lebens einmal außer Acht lässt. Dort ist es für sie selbstverständlich, dass sie bestimmten Personen Rechenschaft über ihre Arbeit ablegt und von anderen Rechenschaft erwartet und auch einfordert. Es gehört für sie zum Informationsaustausch, der den Zielen der Zusammenarbeit nur nützt. Diese Art von Rechenschaft sieht sie ein; es ist akzeptiert und wird nicht mehr hinterfragt.
Aber was sie außerhalb der Arbeitszeit, im anderen Teil ihres Lebens tut und denkt, geht niemanden etwas an. Sicherlich fragt der eine oder die andere nach, was sie gerade macht, ob sie nicht einen Mann kennen gelernt hat oder was die beschränkte Weltsicht der anderen ihnen noch so alles eingibt. Doch antwortet sie nur knapp und gibt den anderen zu verstehen, dass dies uninteressante Fragen seien, die besser kein zweites Mal gestellt werden sollten.
Wer zu oft anruft und zu penetrant nachfragt, wird immer kürzer abserviert oder gar nicht erst bedient. Der Anrufbeantworter ist ihr da eine große Hilfe. Denn sie kann zunächst das Klingeln abwarten und horchen, wer sich am anderen Ende der Leitung melden würde, und dann entscheiden, ob sie den Hörer abnimmt, um Fragen zu beantworten, oder ob sie den Hörer nicht berührt, um sich nicht weiter stören zu lassen. Bei der einen und anderen Bekannten hatte sich gezeigt, dass ein Gespräch dann doch nicht so dringend war, wie es am Anfang bezeichnet wurde; doch nicht so wichtig, als dass es nicht auch später besprochen werden konnte; doch nicht so interessant, als dass alles stehen und liegen gelassen werden musste, um sich dieser einen Sache zu widmen. Alles nur leeres Geschwätz und eitles Zeittotschlagen. Früher hatte sie das einmal mitgemacht und mit den anderen mitgelacht.
Aber immer häufiger überkam sie Langeweile, wenn sie mit dem Hörer am Ohr sich schweigend erzählen ließ, was der eine und die andere gesagt hatte, und was die eine und der andere daraufhin getan hatte und so weiter und so fort. Immer öfter hielt sie den Hörer vom Ohr weg und vernahm nur noch ein Piepsen, dessen Sinn nicht mehr zu fassen war. Es stellte sich regelmäßig heraus, dass es auch nicht wichtig war, was gerade gesagt wurde. Es wurde keine Antwort erwartet. Ohne Sinn und Verstand wurde drauf losgeredet, ob es sie nun interessierte oder nicht. Es ging nur darum, etwas wieder loszuwerden, was vorher mit den Augen und Ohren aufgenommen wurde (wie bei der Verdauung) – und manchmal hatte das Halbverdaute eine hellrötliche Färbung und wurde in einzelnen Brocken in die Sprechmuschel gespuckt. Manchmal quoll es auch als dunkles Braun in Form einer knetbaren Masse durch die Löcher der Hörmuschel und quetschte sich in die Vertiefungen ihrer Auricula. Doch in welcher Form es auch kam – es stank ihr. Und so hatte sie es in den vergangenen Monaten durch einsilbige Antworten und „vergessene“ Rückrufe geschafft, dass sich kaum noch jemand bei ihr meldete; es sei denn, es gab wirklich etwas Wichtiges zu besprechen oder eine Verabredung für das Kino zu treffen.
Sie selbst rief kaum noch irgendwo an. Der einzige Pflichtanruf, den sie hin und wieder tätigte, war bei ihrem Vater; und das auch nur, weil sie es ihrer Mutter versprochen und damit selbst ihr Gewissen belastet hatte. Nach allem, was vorgefallen war, gab es ansonsten keinen Grund mehr, den Kontakt zu ihrem Erzeuger aufrechtzuerhalten. Und abgesehen von ihrem Gewissen, was sie rein zu halten bemüht war, würde es hoffentlich auch nicht mehr lange dauern – vielleicht zwei Jahre, vielleicht vier, vielleicht auch nur noch ein paar Wochen, bis ihr Vater sterben und sie endgültig in Ruhe lassen würde.
Sie schaute in den Himmel und konnte so zur rechten Zeit beobachten, wie sich eine kleine Wolke zwischen ihr und der Sonne in Richtung Südwesten bewegte, so dass zu dem Zeitpunkt, als die junge Frau hochsah, der Rand der Sonne hinter dieser Wolke als Strahlenbündel wieder sichtbar wurde und ein paar Sekunden später der volle Schein dieser brennenden Kugel auf ihr Gesicht schien und es angenehm wärmte. Sie blieb stehen und schloss (das Gesicht zur Sonne gewendet) die Augen, spürte bewusster noch den leichten Wind, der sie umspielte, und vergaß für einen Augenblick oder ein bisschen länger, wo sie stand und wer sie war.
Es sind dies die Momente, in denen wir unbewusst loslassen von Plänen und Problemen, in denen es uns, auch wenn wir darin nicht geübt sind, trotzdem gelingt, uns außerhalb unseres Selbst zu stellen und ein paar Sekunden lang, vielleicht eine Minute, nichts zu wollen und nichts wollen zu müssen. So verharrte die junge Frau regungslos, beide Hände bewegungslos in den Taschen ihrer Jacke ruhend und die Füße in festem Stand leicht auseinander gestellt wie das Mädchen Pygmalions im wärmenden Licht und genoss im Stillen die ihr entgegengebrachte Verwöhnung.
So stand sie etwa zwei volle Minuten – für diese Tätigkeit und diesen Standort eine ungewöhnlich lange Zeit, die nur selten genutzt wird und sich nur immer wieder denen anbietet, die innezuhalten wissen – in dieser Position und öffnete erst wieder die Augen, als die nächste kleine Wolke zwischen sie und die Sonne zog und gleichzeitig die lauten Schritte zweier Läufer sie an jene Stelle im Park zurückholten.
Sie ließ zunächst die Pupillen sich wieder an die Helligkeit gewöhnen und setzte dann ihren Spaziergang fort, ging an den spielenden Kindern vorbei und entschied sich an der nächsten Gabelung des Hauptweges diesmal für die große Runde, denn die Zeit an diesem Samstag konnte sie ohne Verabredungen und Termine verstreichen lassen und brauchte keine Schließungszeiten von Geschäften und Supermärkten zu beachten, da sie am vergangenen Tage bereits alles Nötige eingekauft und auch schon ein paar unnötige Dinge erledigt hatte.
Erleichtert und beschwingt – fast fröhlich – schlenderte sie auf dem fest gewalzten Sand-KiesGemisch und blickte bewusst abwechselnd auf die linke Seite und dann auf die rechte, um keine aufgegangene Blüte unbeachtet zu lassen, hob ihren Blick zu den Zweigen der Bäume, in denen sich das Sonnenlicht brach und hier eine Kohlmeise sang, dort ein Buntspecht die Borke aufpickte und nach Larven suchte, und senkte ihn wieder – angezogen von den nächsten Farbtönen – oder schaute geradeaus.
Bei einem dieser Geradeausblicke sah sie in einiger Entfernung einen Fahrradfahrer recht langsam durch den Park fahren. Sie beobachtete ihn eine Zeit lang und überlegte, ob sie sich an diesem oder dem nächsten Tage auch auf das Fahrrad setzen sollte, um einmal wieder eine längere Strecke am Fluss entlang zu radeln.
Der junge Mann schien ebenfalls die Bewegung im Freien zu genießen, drehte hin und wieder um und fuhr ein paar Meter die Strecke zurück, die er gekommen war, fuhr freihändig, wenn er keine Fußgänger überholte oder Hunden auswich, die die Wegführung nicht so genau beachteten und oft unangekündigt im Laufen die Richtung änderten, und stieg auch manchmal ab, um an einem Bach dem plätschernden Wasser zuzuhören oder ein Entenpaar zu beobachten, das in unbesorgter Gemütlichkeit – er langsam hinter ihr her – seines Weges ging, als ob es sich ebenfalls bewusst wäre, dass der heutige Tag der Ruhe diene und dem Leben einmal nicht nachgehetzt werden müsse.
Nachdem er wieder auf das Rad gestiegen war, griff der junge Mann in seine rechte Jackentasche und schien etwas hervor zu holen. Vielleicht wirft er den Enten ein wenig Futter hin, dachte sie. Aber der junge Mann blickte kurz hinter sich, holte mit dem Arm weit aus und schleuderte einen Gegenstand, den sie nicht erkennen konnte, in hohem Bogen in die dichte Rhododendronpflanzung auf der anderen Seite. Dann stützte er wieder beide Hände auf die Lenkstange, legte den zweiten Gang ein und fuhr nun zügig aus dem Park.
Die junge Frau blickte ihm noch nach, ohne selbst einen bestimmten Grund dafür zu kennen. Vielleicht war es einfach Neugier oder Beobachtungslust, andere Menschen bei der Ausübung einer Tätigkeit – und sei sie noch so banal und uninteressant – zu beobachten; vielleicht war es auch einfach nur Trägheit oder gedankliches Abgelenktsein, was sie immer noch in seine Richtung blicken ließ, ohne dass sie ihn wirklich wahrnahm. Er verschwand bald aus ihrem Blickfeld, und sie setzte ihren Rundgang durch den Park und am See entlang fort, vorbei an der dichten Rhododendronpflanzung und vorbei auch an dem gemütlichen Entenpaar, das immer noch über den Rasen watschelte.