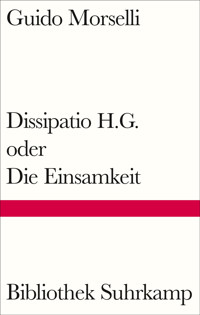
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 2. Juni um 2 Uhr morgens verschwindet die gesamte Menschheit, lautlos und ohne Spuren zu hinterlassen. Zurück bleiben die Sachen und die Tiere, die sich schon bald mit wachsender Furchtlosigkeit hervorwagen, um die Erde wieder in ihren Besitz zu nehmen. Übriggeblieben ist außerdem: ein einziger Mensch, ein Einzelgänger, der mit der Welt nicht zurechtkam und sich in ebendieser Nacht das Leben nehmen wollte. In einer paradoxen Umkehrung wird der verhinderte Selbstmörder nun zum einzigen Repräsentanten menschlichen Lebens, zur Menschheit schlechthin. Offen bleibt dabei die Frage, ob er, der einzig verschont Gebliebene, ein Auserwählter oder ein Verdammter ist.
Geschrieben kurz vor dem Freitod des Autors, ist Dissipatio ein visionäres Porträt unserer heutigen Zeit, ein philosophisches Vermächtnis und das Testament eines großen italienischen Solitärs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Guido Morselli
Dissipatio humani generis
oder Die Einsamkeit
Roman
Aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwend
Mit einem Nachwort von Michael Krüger
Suhrkamp Verlag
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Chronik der Angst
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Nachwort
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
I
Akustisch-visuelle Relikte leisten mir Gesellschaft – und sie sind das, was mir am unmittelbarsten von »ihnen« bleibt. Zwei rein verbale (aus Rundfunknachrichten, nehme ich an): Mißlungene Flugzeugentführung und geglückte Vergewaltigung eines Mädchens in einer Maschine der Olympic Airways. Und die andere auf englisch, vielleicht von der wenig seriösen Voice of Europe: A favorite Polish joke goes, we feign to work, the State feigns to pay us. Und zwei Bilder: eine Flasche mit einer Königskrone und der Aufschrift in Rot: Seagram's Canadian Whisky. Das kleine weiße Viereck des Tennisplatzes hinter dem Hotel Bellevue im Ausschnitt meines Fernglases. Dem spontanen Gedächtnis bietet sich nichts anderes an, und diese Erinnerungen treiben darin, beharrlich und willkürlich.
Haltlose Relikte und nunmehr schon Reliquien. Seit jener Nacht ist bereits ein halber Monat vergangen, ich könnte genausogut sagen: ein halbes Jahrhundert. Eine lange Panik am Anfang. Und dann ungläubiges Staunen, das sich aber gleich wieder legte, und schließlich von neuem Angst. Jetzt die Anpassung. Resignation? Ich würde eher sagen: Akzeptierung. Mit Intervallen von anmaßender Heiterkeit und wilder Erleichterung.
Ich komme aus dem Gebäude der Zeitung. Als junger Mann habe ich hier gearbeitet, und ich bin hierher zurückgegangen, durch das ganze Haus gelaufen, um eine Bestätigung zu erhalten. Die Bestätigung fand sich: Ich habe immer noch die absurde Bewegung der Linotypes vor Augen, deren Skelettarme nicht aufhören, sich – wer weiß, wie – zu heben und zu senken. Als »sie« verschwanden (um zwei Uhr früh), war das der Arbeitsstand: in der Druckerei die Setzer an den Linotypes, die Rotationsmaschinen noch nicht in Betrieb; oben die Redaktion, die die letzten Nachrichten durchging. Die Agenturmeldungen sind unbeendet in den Fernschreibern geblieben (und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, sie zu lesen, ich habe gesehen, daß sie abbrachen: Die Botschaften wurden am anderen Ende des Telex eingestellt; hier verlief alles ordnungsgemäß). In ihrer Vorzugsbox die IBM mit den noch brennenden roten Kontrollampen. Im übrigen sind die Räume des Zeitungsgebäudes erleuchtet; im Büro der Redaktionssekretärin – seit eh und je das Fräulein Manass – surrt immer noch ein kleiner Ventilator auf dem Tisch. Sie war dabei, etwas zu schreiben, der Füller liegt quer zum Blatt, als sei er ihr aus der Hand gefallen. Aber der Stuhl ist nicht umgestürzt. Ja, er ist nicht einmal vom Schreibtisch weggerückt. Wie hat das Fräulein Manass es angestellt zu verschwinden?
Meine, gebührend weltliche, Zeitung hat ihren Sitz (hatte ihn) gegenüber dem des lutherischen Bischofs. Zu meiner Zeit war Bischof der Doktor Burg, ein kleines Männchen, das ich nur vom Sehen kannte, das sich aber, wenn wir einander begegneten, stets die Mühe machte, mich als erster zu grüßen. Der Bischofssitz, ein Gebäude im österreichischen Spätbarock, ist heute wie ausgestorben. In einer Nische an der Ecke des Gebäudes sehe ich einen Klingelzug, unter dem in höflichen gotischen Lettern steht: »In Notfällen jederzeit läuten«. Ich ziehe am Griff, eine unsichtbare Klingel durchschneidet mit ihrem sonntäglichen Ton die schwüle Luft. Ich läute noch einmal. Der Bischof wird auf Pastoralvisite sein oder in Ferien; oder auch er ist verschwunden, samt seinen Akoluthen und seinen Gläubigen – wie die anderen, wie alle. Wie die Hüter der bestehenden Ordnung. Weiter vorn erkenne ich die Polizeistation an der Theaterstraße. Ich gehe hinein: Ich streife durch die Räume in den zwei Stockwerken, von der Wachstube bis zur Telefonzentrale. Kein Mensch. An der Ecke des Neuen Zolls ein aufgespannter Damenschirm umgekippt auf dem Boden und eine Handtasche. Ein Taxi steht am Gehsteig vor einer kleinen Villa. Ich hebe die Handtasche auf, ein Scheckheft ist darin, eine echte Remontoir-Uhr, aus der Zeit, sie steht auf zwei und trägt die eingravierte Widmung: »To Meggy Weiss Lo Surdo. Happy hours.« Die reizende Meggy kommt spät nach Haus, von einem Abend bei Freunden (oder dem Freund): Sie will gerade durchs Gartentor, als etwas passiert, was sie dazu zwingt, mit einemmal wieder wegzugehen, unter Zurücklassung der irdischen Güter, die sie in ihrer Handtasche mit sich führt.
Denselben dringenden, unaufschiebbaren, herrischen, aber unparteiischen Appell hat der einfache Taxifahrer vernommen. Auch er gehorcht, unter Zurücklassung dessen, was für ihn das Wertvollste ist: seines Autos.
Ich liebe Chrysopolis nicht, ja ich kann es nicht ausstehen. In dieser Stadt habe ich meinen Antityp entdeckt, die triumphale Durchsetzung all dessen, was ich ablehne; ich habe sie zum Mittelpunkt meiner Verabscheuung der Welt erwählt: ein caput mundi im negativen Sinn. Meine fuga saeculi war, schon damals, Flucht aus dieser präzisen Lokalisierung des »Jahrhunderts«. Und doch wirkt die Situation, mit der ich mich konfrontiert sehe, unglaubhaft und düster.
Chrysopolis ist leer. Ordentlich, ruhig, auf den Straßen, auf den Plätzen, auf den Quais wie im Zentrum, so wie es in jener Nacht um zwei Uhr gewesen sein muß – aber leer. Wie viele waren es? Vierhunderttausend, vierhundertzwanzigtausend. Wie auch immer, sie waren.
Ich bin auf der Suche nach ein paar tausend Verschwundenen hergekommen. Den Bewohnern meines Tals. Und hier finde ich den Mega-Exodus, die Desertation en masse. Ein (unvorstellbares) Ereignis hat auch hier die Leute im Schlaf überrascht: Die nächtliche Unterbrechung des kollektiven Lebens hat sich einfach verlängert, auf unbestimmte Zeit verlängert. Denn wenn ich sie mir auch weiterhin als geflohen vorstelle, in Wirklichkeit sind sie nicht geflohen wie die Menschen von Pompeji. Und sie wurden auch nicht zu Asche reduziert wie die von Hiroshima. Sie sind auf irgendeine andere Weise gegangen. Geraubt. Extrahiert, hinausgetrieben aus ihren Häusern und sonstigen Sitzen. Aus ihren Körpern – vielleicht.
Nein. Aus ihren Körpern, scheint es, nicht. Von Körpern findet sich unter dem leichten Juniregen keine Spur in Chrysopolis. Es bleibt, was zwar auch körperlich ist, aber nicht organisch. Der Alltagsabfall auf den Straßen, die alten Kinokarten, die leeren Zigarettenschachteln; es bleiben die Neonreklamen (und sie sind eingeschaltet), die Wasserstrahlen der Brunnen, die Autos, aufgereiht vor den Gebäuden, auf den Flächen des Parkplatzes. Die Goldstadt ist intakt. Die Entwichenen (oder die Kräfte, die sie zum Entweichen zwangen) haben nichts mitgenommen. Weder die Tischchen vor dem Café Odéon noch seine Jugendstilfassade weisen irgendwelche Spuren von Gewaltanwendung auf. Auch nicht die Fensterscheiben, hinter denen vor tausend Jahren Trotzki mit seiner Frau und Lenin saßen.
Es bleibt auch, was organisch und lebendig ist, aber nicht menschlich. Die Geometrie der Tulpen vor dem Hotel Esplanade und die Akazien, die sich unter der Last ihrer Blüten biegen. Der berühmte Jasmin, oder Gymnospermus, der sich von der mitten im Zentrum gelegenen Villa des Barons Aaron ergießt. Die Raben auf dem Giebel des Nationaltheaters, die Katzen, in Rudeln, auf den Stufen des Crédit Financier und der Diskontbank.
Die Katzen jagen sich zu Füßen der Finanzmonumente Mitteleuropas beziehungsweise des Kontinents. Sie paaren sich mit widerwärtigem Geschrei. Aber es gibt nicht nur die Katzen. Vor den Gittern der großartigen Bankunion – zu meiner Zeit behauptete jemand, sie seien aus Edelmetall – habe ich Vogelkot bemerkt und gedacht, es handle sich um Tauben. Es war ein Huhn. Es scharrte in einem Haufen nassen Laubs, und ich muß gestehen, daß sein Anblick einen Schock bei mir ausgelöst hat. Ein Huhn. Wenn die Pferde der Apokalypse über dieses Pflaster getrabt wären – es hätte mich nicht so getroffen.
Und jetzt der Rückweg. Ich trat mit erschrockener Wut aufs Gaspedal, ich, der kaum fahren kann. Auf vierzig Kilometern Ebene nicht mehr als ein Dutzend Autos, alle von der Straße abgekommen. Ich halte an der Stelle, wo ich auf dem Herweg einen Reisebus gesehen habe, der gegen eine Betonabstützung geprallt ist. Der Wagen ist völlig demoliert, Fenster und Sitze in Trümmern, aber es gibt kein Anzeichen dafür, daß seine Insassen Schaden erlitten hätten. Und mir kommt die absurde Idee: Es gab da drin überhaupt keinen Insassen mehr, nicht einmal den Fahrer, als der Wagen zerschellte. »Vorher« waren es die Autounfälle, die das Leben nahmen: In jenem Augenblick war es die Wegnahme des Lebens gewesen (sein Verschwinden, seine Auflösung), die den Unfall hervorgerufen hatte. Das Opfer ist der Autobus, und nur er. Weiter vorn, in einer Wiese, ein Lieferwagen der Post, mit den Rädern nach oben, und aus den Türen sind Säcke herausgefallen: »Eingeschriebene Wertsendungen«. Neben dem Fahrersitz ein Gewehr; ein Gendarm hat den Wagen begleitet. Auch er ist verschwunden, doch die über den Rasen verstreuten Wertsendungen laufen keinerlei Gefahr. Auf derselben Wiese steht aufrecht und fest eine elektrische Lokomotive, aus dem Geleise gesprungen, das parallel zur Straße verläuft. Der übrige Zug steht auf den Schienen. Mir ist eingefallen, daß, als ich ein Kind war, die Bauern in dieser Gegend die Eisenbahnwaggons »die grauen Kühe« nannten. Jetzt weiden die grauen Kühe friedlich, die Kilowatt wie die PS kehren in die Natur zurück. Ungezähmt.
Dann endet die Ebene, die Berge schließen sich um mich. Kurve auf Kurve fahre ich hinauf ins Reich der Eichen und der Buchen und der Kastanien mit ihren ausladenden Kronen, bis mich das hochaufragende Geschlecht empfängt, in dessen Wipfeln der Nebel hängt. Meine Familie, die einzige und die wahre dazu; immer wieder habe ich sie bei der Heimkehr begrüßt. Und für einen Augenblick erfüllt mich, wie bei jeder Heimkehr, eine Freude, die aus den Lungen und aus dem Blut kommt, ein organisches Gefühl. Die Heimat: die Häuser aus schwarzem Holz, mit ihren roten, weißumrandeten Fensterläden, und die Abendluft, die sich belebt und mit Duft erfüllt. Doch mein Tal, das ich hinauffahre, ist verlassen, in den Häusern brennt kein Licht. Ich kann auch das Licht am Auto ausmachen, ich werde niemandem begegnen, niemand wird mir ausweichen müssen. Ich werde kein Gesicht sehen, ich werde keine Stimme hören.
Und das erscheint mir ungerecht und gemein. In der Stadt war ich Zuschauer, hier muß ich leben.
Wohin sind sie gegangen? Warum sind sie gegangen?
In der Vergangenheit habe ich das Loblied dieser Bergbewohner gesungen: die nicht emigriert sind, wie die aus den Nachbartälern, und eine beharrliche Liebe zu ihrem Stück Heimat bewiesen, eine fast biologische Anhänglichkeit – in Zeiten, in denen das Gebirge noch kein Industrieunternehmen darstellte und auch der Schnee noch keinen wertvollen Rohstoff. Als sich die Goldmine des Fremdenverkehrs auftat, waren nicht sie es, die sie ausbeuteten, sondern die Bewohner der Ebene, die hier heraufkamen, um Hotels, Ferienhäuser und Eisenbahnen zu bauen und inzwischen auch noch Seilbahnen und Schilifte. Sie, die Einheimischen, halten sich am Rand und haben für die Gäste allenfalls ein ironisches Mitleid übrig, das sich im Winter gegenüber den Vergötterern des Slaloms noch verstärkt. Ich schrieb damals: Sie ziehen müde mit dem Vieh und mit ihren Körben auf dem Rücken unter den Lampen des Victoria und des Bellevue vorbei, an den Swimmingpools und Minigolfs entlang, und in ihren Augen liegen der gleiche Überdruß und die gleiche Resignation, die die Bewohner des noch heidnischen römischen Umlands im Jahrhundert Konstantins angesichts der Basiliken der neuen Religion empfanden.
Jetzt erscheint mir dieses Loblied höchst unverdient. Auch sie sind desertiert. Es will mir nicht gelingen, mir einen außernatürlichen Zwang vorzustellen. Auch sie sind, wie die Einwohner von Chrysopolis, einem Massenwahn erlegen, gegen den sie jedoch hätten immun sein können. Oder einem Befehl, dem sie sich jedoch hätten widersetzen müssen. Sie sind zu Komplizen geworden; es gab keine Macht, keine Obrigkeit, die sie hätte zwingen können.
Ich erlaube mir eine kümmerliche Hoffnung: daß meine »Hüter«, wenigstens die, sich sehen lassen. Frieda und Hans. Sie teilten zwischen mir und ihren Kühen und Ziegen eine wachsame Fürsorge, keine zärtliche, vielleicht aber liebevolle. Werde ich sie dort oben wiederfinden, wie sie, schmollend, unter der Tür auf mich warten? Schon seit Tagen habe ich sie nicht mehr gesehen. Gestern mußte ich die Stalltür aufmachen, um die halbverhungerten Tiere herauszulassen.
Widmad ist ohne Leben. Die Fahnen, in einer Reihe auf der Terrasse des Kursaals, flattern fröhlich: stumpfsinnigerweise nur für mich. Wie die Geranien, die die Fassade des kleinen Rathauses bedecken, und die Ampel, die an der Einmündung zum Marktplatz blinkt. Der nasse Asphalt spiegelt die Lichter, die Stuckfassaden der großen Hotels: nur für mich.
Ich stelle das Auto mitten auf der Straße ab; es wird niemandem im Wege sein. Das Schweigen des Motors läßt mich noch mehr allein, mich, der ich dieses Geräusch nie ausstehen konnte.
Ich mache mich auf den Weg nach Hause.
Fünfzig Minuten Anstieg, in einer Stille, die mich bis vor ein paar Tagen noch erregt hat, auf einem Pfad zwischen Lärchen und Tannen. Ich komme nur mühsam voran. Ich bin müde. Ich spitze die Ohren, spähe um mich. Ich habe Angst.
II
Ein Hund trottete hinter mir her, ein Spaniel, mit diesem moosigen Geruch, den die Luxushunde im Regen annehmen, und er schleifte traurig seine Leine nach. Wahrscheinlich ausgehungert wie das Vieh von Frieda und Hans; wenig später habe ich ihn wieder aus den Augen verloren. Die Seilbahnstation, das Hotel Zemmi. Ich lese, zum tausendstenmal, die roten, gelben, grünen Holzschildchen, die dort, wo sich die kleine Straße in verschiedene Wege gabelt, die einzelnen Wanderungen anzeigen. Ich nehme den steilsten, den meinen: den, der mir seit vier Jahren mein Privileg erschließt, außerhalb und oberhalb zu leben, allein zu leben. Aber jetzt habe ich Angst.
Im Abstand von Tagen denke ich über diese Angst nach.
Es war, zunächst, kein Nervenzusammenbruch, sondern ein reflektiertes Erschrecken, in das meine kritischen Fähigkeiten einflossen, einstimmten, jene, die sich normalerweise der Angst entgegenstellen. Oder mein – vergewaltigter – gesunder Menschenverstand. Eine von Vernunft getragene Angst, die mit schwarzer Luzidität die Situation rekapitulierte, der Situation angemessen war. Erst später ist die Panik gekommen.
Ich denke darüber nach, und ich rechtfertige mich. Das Unerklärliche ist nicht das Unbekannte und auch nicht das Geheimnisvolle, etwas, von dem wir angezogen werden (vielleicht weil es den Vorzug hat, in gebührendem Abstand von uns zu hausen). Es ist etwas anderes, das, sobald es eine gewisse Ausdehnung und Festigkeit annimmt, unsere vitalen Schemata sprengt. An das Wunderbare hätte ich mich gewöhnt. Auf das Absurde habe ich physiologisch reagiert; da ich es nicht ignorieren konnte, habe ich es, in seiner Wucht und Unmittelbarkeit, als Angriff empfunden und mich in die Erstarrung geflüchtet. Ich überließ mich einem Atavismus. Angesichts der Bedrohung verhält sich ein wehrloses Tier so: Es erstarrt.
Jenen Abend, die Nacht, den nächsten Tag verharrte ich in absoluter Untätigkeit. Keinerlei Fluchtversuch; das unterdrückte Trauma manifestierte sich in Lähmung. Eingeschlossen in meine vier Räume, Türen und Fenster verrammelt (in einem bestimmten Moment hatte ich den Einfall, mich zu verbarrikadieren), habe ich darauf gewartet, daß es mich erreiche und treffe. Mich erledige, da doch ich allein nicht ausgespart bleiben konnte. Auch ich war verurteilt; außerhalb dieser Mauern herrschte das Fluidum des Todes, und ich war darin eingetaucht wie unter einer Glocke auf dem Meeresgrund. Es würde hereindringen, durch Osmose, durch die Wände hindurch. Eine klare und bewußte, keine den Verstand ausschaltende Angst, die mich ganz bei mir selbst sein ließ. Von Zeit zu Zeit horchte ich mit angehaltenem Atem, ohne Symptome von Halluzination, völlig kühl, ob sich nicht das Rascheln von riesigen Tieren vernehmen ließe (den Sauriern der Urzeit, den Riesenechsen des Kreidezeitalters), die das Haus umlauerten. Ein paar Dinge versuchte ich dann doch, das psychische Absacken blockierte mich nicht körperlich: Am zweiten Tag setzte ich mich an die Schreibmaschine; ich dachte, die Anmerkungen für die Revision einer Arbeit von mir abzuschreiben, auf die der Verleger seit letztem Jahr wartet. (Diesem Buch sollte ich, auf eindeutig groteske Weise, am dritten Tag schließlich meine Befreiung aus dem Alptraum verdanken.) Ich setzte mich also am Nachmittag an die Maschine, doch ohne sie zu berühren. Das Klappern der Tasten hätte mich umgeworfen. Oder es war wie eine abergläubisch empfundene Pflicht, das Schweigen nicht zu brechen. Um mir einen Kaffee zu kochen, schlich ich mich auf Zehenspitzen in die Küche. Draußen, auf dem Vorplatz, trommelte lautstark der Regen, aber ich durfte kein Geräusch machen. Ich mußte, wie die anderen, tot sein. Meine Funktionen: normal. Ich aß mit Hunger, sogar gierig, während der Schrecken anhielt, denn es gab keine Intervalle, und ich erschauderte beim Essen, im Rhythmus meines Kauens. Ich schlief, und zwar, merkwürdig zu sagen, ohne Träume. Ich rauchte ein paar Pfeifen, ich trank Kognak in dem gewohnten Maß. Ich urinierte mehr als sonst; die Angst, das ist bekannt, schlägt sich auf den Ausscheidungsapparat. Auch wenn die Angst zur Notwendigkeit wird und dem Individuum in Fleisch und Blut übergeht, wie es bei mir der Fall war.
Es sind, vor der entscheidenden Krise, zwei Tage vergangen, nicht mehr und auch die nicht ganz. Was die Erfahrung angeht: ein Vorgeschmack von Ewigkeit.
Und doch, das Unerklärliche ist durch mein eigenes Tun eingeleitet worden. Zumindest fielen die Ereignisse (zu Beginn) mit einem ganz privaten, persönlichen Ereignis zusammen; eine nicht zufällige Koinzidenz, wage ich zu denken.
Die unglaubliche Nacht vom 1. auf den 2. Juni. In jener Nacht, das war beschlossen, würde ich mich umbringen.
Warum?
Weil das Negative das Positive überwog. In meiner Bilanz. Um siebzig Prozent. Ein banales, gewöhnliches Motiv? Da bin ich mir nicht sicher.
Was die Buchhaltergenauigkeit angeht, muß ich sagen, daß mein Seelenleben karg ist. Auch im Sinn von schlicht, von elementar. Es eignet sich zur Buchhaltung: Die unbewußten Frustrationen und das Pathos der Eingeweide, die dunklen Leiden, die den modernen Menschen ausmachen sollen, die, das muß ich gestehen, finde ich bei mir nicht. Ein Kollege pflegte mir »reduktionistische Kritik« vorzuwerfen. Ich habe immer wieder erklärt (»toutes choses sont déjà dites, mais comme personne n'écoute il faut toujours recommencer«), daß der – für die heutige Literatur so typische – innere Monolog, in dem zwischen haarfeinen Inspektionen des Ichs und Pseudo-Auseinandersetzungen mit dem Nicht-Ich die unbewußten Leiden und die Verkrampfungen der Eingeweide zum Ausdruck kommen, bestätigt, daß wir festgenagelt sind auf den Psychologismus des Sub-Fühlens und Sub-Denkens, der bereits vor hundert Jahren affektiert (und langweilig) war. Aber wenn sich irgend jemand mit meinem individuellen Fall beschäftigen würde, verfiele er bestimmt nicht auf den Psychologismus. Er müßte reduktionistisch vorgehen, zwangsläufig.
Ich hatte beschlossen, mich umzubringen, vor allem weil ich Opfer einer Mafia war. Und vor der Mafia gibt es kein Entrinnen, das wußte ich.
Es begann mit einer Krankheit. Einer körperlichen, nicht einer geistigen, einer echten, nicht einer eingebildeten; einer zur Chronifizierung neigenden. Einer jener Krankheiten jedoch, die einen am Leben lassen und die, wenn sie mit ein bißchen Menschlichkeit behandelt werden, auch ausheilen. In Wirklichkeit befand ich mich bereits auf dem Weg der Genesung. Der Arzt, in Chrysopolis, der mich hätte behandeln sollen, schickte mich jedoch zu einem Spezialisten und der Spezialist zu einem Radiologen, der einen Spezialisten Nr. 2 hinzuzog und dieser wieder einen Radiologen Nr. 2, der einige Tests verordnete (oh, nur 11, vom Wassermann bis zur BSG), in einer Klinik, ebenfalls in Chrysopolis. Nach dem letzten dieser Tests wurde mir zu einer Reihe von Laboruntersuchungen geraten, in deren Folge ein Spezialist (Nr. 3) einen entsprechenden Radiologen (Nr. 3) erforderlich machte. Und so ging es weiter, paarweise, nein, zu dreien (Spezialist, Radiologe, Klinik mit Test und Labor, kurzer Aufenthalt), in exponentieller Progression, bis vor wenigen Wochen: mit einem Gesamtaufwand – innerhalb von 2 Jahren und 8 Monaten – von 12 Spezialisten, 12 Radiologen, 33 Testzyklen und 27 Serien verschiedenster Laboruntersuchungen. Dinge, wie sie Millionen von Opfern bekannt sind, mit denen ich in die Fänge der »Früherkennungs«-Bande geraten war. Das Phänomen wird, da es Teil des Systems ist (im Sinn von Marcuse), von der Soziologie wohlwollend hingenommen beziehungsweise ignoriert oder jedenfalls nicht denunziert, aber es trägt die präzisen Merkmale der mafiosen Erpressung. Die Krankheit ist zu Beginn nicht ernst, aber offensichtlich kann sie es werden, also muß man sie »verfolgen«, muß häufig medizinische Aktivitäten entfalten, um »aus diagnostischer Sicht« festzustellen, ob eventuelle Degenerationen zu beobachten sind. Aber – fragt sich das (passive) Subjekt – wozu eigentlich, wenn doch die »eventuellen Degenerationen«, wo immer sie auftreten mögen, unheilbar sind und ungeheilt bleiben? Alle drei Monate zwingt ihr mich zur Erwartung des Urteils: »positiv oder negativ«. Wozu? Denn wenn »positiv«, heißt das dann nicht langsame und sichere Agonie, bei vollem Bewußtsein und ohne Abhilfe?
Das Ziel? Patet, es liegt vor Augen: nicht so sehr die Hunderte von Milliarden als die Macht. Die massenhafte Versklavung von Männern und Frauen durch eine Klasse. Oder einen Clan, einen Stand. Es geht mir jetzt nicht mehr darum zu dramatisieren; aber ich könnte mir vorstellen, daß die kapitalistische Ausbeutung (Eigentümer gegen Arbeiter) ein nettes Gesellschaftsspiel darstellt im qualitativen Vergleich mit dieser anderen Zwangsunterwerfung. Dieser unvermeidlichen: Um Flucht auszuschließen, schreckt man vor der schmierigsten und grausamsten aller Erpressungen nicht zurück.
So gründet diese Industrie auf einer eisernen Basis. Sie ist keinen Konjunkturstürzen unterworfen. Sie ist streng solidarisch nach innen. Sie erleidet keine Konkurrenz von außen. Keinerlei Krisen, für sie.
Für uns, für mich schon: in meinem Fall eine Krise, die ich Ekel nennen müßte. Der mich selbst einschloß. Es gab Morgenstunden, in denen ich beim Rasieren versuchte, mich nicht im Spiegel zu sehen.
Wenn einer vom Balkon springt oder sich unter den Zug wirft, dann ist das ein psychisch-motorischer Mechanismus, versteht sich – der allein jedoch nicht genügt. Es muß dafür einen »Auslöser« geben: sagte der alte Durkheim, der nicht ohne Scharfsinn war.
Betrachte ich meinen Fall historisch, so registriere ich im vergangenen Herbst, ein paar hundert Schritt von meinem Zufluchtsort (auf 1395 Metern ü. d. M.), das Auftauchen von Pfählen, Pflöcken, Höhenmessern. Ich bekam Fieber. Buchstäblich. Keuchende Erkundigungen, Beratungen mit den informierten Freunden in Chrysopolis. (Ich habe ihr den Namen Chrysopolis, Goldstadt, gegeben, aber sie ist vor allem auch das Operationszentrum des Landes: wo die Entscheidungen getroffen werden, insbesondere die schändlichen Entscheidungen.) Todesnachrichten. Eine infame »Euro-Autoroute«, Société anonyme, bekanntermaßen eingetragen unter den Namen zweier riesengroßer lokaler Unternehmer, plante die kontinentale Verkehrsader Le Havre–Athen. In ihrem alpinen Abschnitt würde die »Ader« das Gebiet von Widmad-Lewrosen »tangieren«. Vorgesehen waren: ein riesiger Tunnel, der im oberen Tal münden sollte, diverse »Kunstwerke«, darunter ein »kühnes Viadukt« aus Stahlbeton über den Gebirgsfluß Zemmi (meinen Zemmi!) sowie Zubringer und Auffahrten. Und ein Motel.
Um es mit Durkheim zu sagen, das war der Auslöser. Auch wenn er nicht unmittelbar wirkte. Es verging der Winter, der Frühling kam, der hier heroben spät beginnt und bezaubernd ist. Für mich, mit diesen rot-weißen Pflöcken vor der Nase, traurig. Mein Entschluß war gereift, zwar mit betulichem und ein bißchen komischem Zögern in der Wahl der Details, aber gewissenhaft und ruhig.
Weggehen also, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das erschien mir wesentlich. Wenn sich die Leute hinterher damit beschäftigten, sollten sie von meiner definitiven Unauffindbarkeit überzeugt sein. Besser: von einem geheimnisvollen Auslöschen, einer Auflösung im Nichts.
Der brave Hans, mein Nachbar und Wächter (oder Hüter), der Mann meiner Haushälterin Frieda, hatte mich, ohne es zu wollen, auf den Ort gebracht. Er kannte eine bestimmte Höhle, dort oben in den Ausläufern der Karessa, die er entdeckt hatte und die von Specologen (oder Speläologen; ich weiß nicht genau, wie sie sich nennen) in späteren Exkursionen erforscht worden war. Was den Zeitpunkt betrifft, den ich zwischen den 1. und den 2. Juni gelegt hatte, so gab es dafür einen besonderen Grund. Ich bin am 2. Juni mittags geboren; ich wollte vermeiden, vierzig Jahre alt zu werden. Der vierzigste Geburtstag ist die Stufe, die von der Reife zum Alter hinabführt; ich wollte mich als Neununddreißigjähriger davonmachen, und sei es auch nur für das Einwohnermeldeamt.
Kurz nach Mitternacht bin ich aufgebrochen, ohne das Abendessen angerührt zu haben; am Haus meiner »Hüter« wollte ich auf Zehenspitzen vorbeischleichen. Doch Hans stand da, unter der Tür. »Was machst du noch so spät?« Er kam aus dem Stall. Eine Ziege hatte sich losgerissen und die anderen Tiere gestört, die unruhig geworden waren. »Sie werden mir noch dabei helfen müssen, einen Verschlag für die Ziegen zu bauen. Ziegen und Kühe, das geht nicht zusammen.«





























