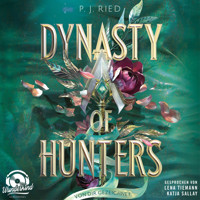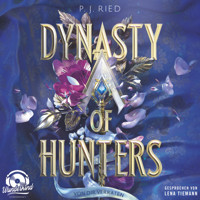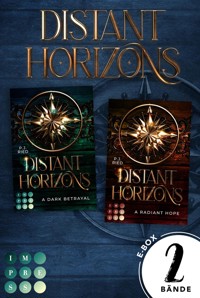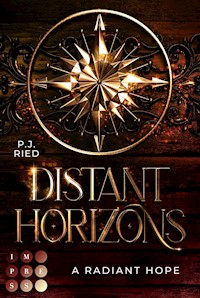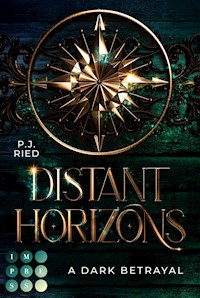
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Widerstreitende Gefühle zwischen den Fluten** Alizea ist sich sicher: Ihre seit Jahren tot geglaubte Mutter lebt! Irgendwo inmitten des Ozeans, der mittlerweile die ganze Erde bedeckt, muss sie sein. Um sie zu finden, ist Alizea jedes Mittel recht. Auch wenn sie dafür ein Schiff stehlen, eine Crew um sich sammeln und sich als Piratin in dieser rauen Welt beweisen muss. Doch während eines Überfalls wird sie schlagartig in ihre Vergangenheit katapultiert. Ausgerechnet Kian, der ihr Herz schon früher zum Stolpern gebracht hatte, ist jetzt ein berüchtigter Piratenjäger und wird von ihrer Crew gefangen genommen. Aber noch bevor sie sich zwischen ihm und ihrer Crew entscheiden muss, schließt Alizea einen Pakt mit einer Kapitänin im Austausch für Hinweise zu ihrer Mutter. Ein Blutgefallen, der sie alles kosten könnte ... Bist du bereit, den sicheren Boden unter deinen Füßen zu verlassen und dich auf eine gefährliche Reise voller Gefahren, Intrigen und großer Gefühle einzulassen? //Dies ist der erste Band der dystopischen Piraten-Fantasy-Buchserie »Distant Horizons«. Alle Romane der Piraten-Fantasy: -- Distant Horizons: A Dark Betrayal -- Distant Horizons: A Radiant Hope Diese Reihe ist abgeschlossen. //
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
P.J. Ried
Distant Horizons 1: A Dark Betrayal
**Widerstreitende Gefühle zwischen den Fluten**
Alizea ist sich sicher: Ihre seit Jahren tot geglaubte Mutter lebt! Irgendwo inmitten des Ozeans, der mittlerweile die ganze Erde bedeckt, muss sie sein. Um sie zu finden, ist Alizea jedes Mittel recht. Auch wenn sie dafür ein Schiff stehlen, eine Crew um sich sammeln und sich als Piratin in dieser rauen Welt beweisen muss. Doch während eines Überfalls wird sie schlagartig in ihre Vergangenheit katapultiert. Ausgerechnet Kian, der ihr Herz schon früher zum Stolpern gebracht hatte, ist jetzt ein berüchtigter Piratenjäger und wird von ihrer Crew gefangen genommen. Aber noch bevor sie sich zwischen ihm und ihrer Crew entscheiden muss, schließt Alizea einen Pakt mit einer Kapitänin im Austausch für Hinweise zu ihrer Mutter. Ein Blutgefallen, der sie alles kosten könnte …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
© privat
P.J. Ried wurde 1997 geboren und lebt als Autorin und freie Lektorin in Hannover. Durch ihr Studium der Literaturwissenschaft entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben neu. Seitdem verirrt sie sich regelmäßig in fantastische Welten, was dank ihres mangelnden Orientierungssinns zum Glück kein Problem darstellt. Wenn sie nicht gerade in Geschichten abtaucht, liebt sie es zu zocken oder Serien und Animes zu schauen. Außerdem träumt sie von einem Leben am Meer mit Sushi-All-you-can-eat-Restaurants und einer Katze.
Für KathrinDanke, dass du die beste Kapitänin bist, die man sich in der Buchwelt nur wünschen kann.
Kapitel 1
Möwen zum Frühstück
Die Morgensonne brennt unbarmherzig auf meinen Nacken herab, während ich eine Möwe dabei beobachte, wie sie einen Blaukiemer aus dem Wasser klaubt. Angestrengt flattert sie mit den Flügeln, um sich samt ihrer Beute wieder hoch in den Himmel aufzuschwingen. Wie ich ist sie frei und in diesem Moment erfüllt von dem Rausch des Triumphs einer erfolgreichen Jagd. Ein einfaches Leben, nur bestimmt von Hunger und dem Bedürfnis, ihn zu stillen. Vermutlich macht genau das ihre Art so widerspenstig. Ich glaube, wenn es hart auf hart käme, würde sie selbst uns Menschen überleben.
Neben mir ertönt ein dumpfes Schnappen, dann ein Sirren, bevor das grauweiße Gefieder von einem Pfeil durchbohrt wird. Der Vogel fällt ins Wasser, von wo aus er mit einem am Schaft befestigten Seil zurückgezogen wird, während der Fisch hektisch davonschwimmt.
Nur mit Mühe kann ich ein Schmunzeln unterdrücken. Zumindest würden die Möwen überleben, wenn Ari, die Navigatorin der Astarte, nicht die Nase voll davon hätte, »seit Tagen nur diesen zum Himmel stinkenden Fisch« zu essen, und obendrein schon länger planen würde, ihr Kopfkissen aufzupolstern.
»Nicht viel dran, aber besser als nichts«, knurrt sie und gesellt sich zu mir an die Reling, wobei sie das Tier am Seil hin- und herschwingen lässt. Ihr langer, dunkelblauer Rock flattert in einer leichten Brise, ebenso wie ihre weiße Leinenbluse mit den weiten Ärmeln, die sie mit einem Ledergürtel an der Taille festgeschnürt hat.
Mit einem leisen Schnaufen zieht sie den Pfeil aus der Brust des Vogels und steckt ihn wieder zurück in den Köcher, den sie mit einem Gurt schräg über ihre linke Schulter gebunden hat. »Aber alles ist besser …«
»… als diese immer gleiche Brühe.«
Wir grinsen uns an.
»Ist doch so«, bekräftigt sie.
»Ehrlich gesagt hätte ich auch nichts gegen ein wenig Abwechslung.«
Sie hebt die Brauen. »Du glaubst nicht wirklich, dass ich dir etwas abgebe, oder?«
»Du musst. Ich bin Captain dieses Schiffs«, erwidere ich.
»Tja. Dann muss ich wohl eine Meuterei anzetteln.«
Mit gespielter Tragik schüttele ich den Kopf. »Es würde mir schon reichen, wenn du das Schiff nur halb so gut auf Kurs halten würdest, wie du mit dem Bogen umgehen kannst.«
»Ach, komm. Ohne mich würdest du hoffnungslos im Kreis treiben.«
»Auch wieder wahr.«
Für eine Weile starren wir gemeinsam auf die glitzernde Wasseroberfläche, bis Ari irgendwann ihre Beute schultert, das lange, schwarze Haar in den Nacken wirft und sich wie immer wortlos auf den Weg in die Kombüse macht.
Ich schließe die Augen, spüre der Kühle der Gischt auf meiner sonnenerhitzten Haut nach. Fühle das Auf und Ab der Wellen, schmecke ihr Salz auf meinen Lippen und genieße das Gefühl von Freiheit, das sie mit sich bringen. Ich atme den Duft des Ozeans, höre den kaum wahrnehmbaren Wind, der mir mit leiser Stimme in die Ohren flüstert und die Glieder fremder Kapitänsketten in meinen Haaren zum Klirren bringt. Eins für jedes Schiff, das wir kapern. Eins für jedes ohne Antwort.
Denn seit ich vor drei Jahren die Sicherheit meiner Heimat verlassen, dieses Schiff gestohlen habe und Piratin geworden bin, bin ich mit meiner Crew auf der Suche. Tagein, tagaus halten wir Ausschau nach anderen Booten, Nahrung und Schätzen der Alten Welt, die sich zu irgendetwas Brauchbarem weiterverarbeiten lassen.
Doch da ist noch mehr. Ich suche noch mehr. Jemanden.
»Merger auf Backbord!«, hallt Cavens Ruf aus dem Krähennest über das Deck. Er hat die Rolle unseres Radars übernommen, nachdem wir es für wichtigere Reparaturen verkaufen mussten. Energisch deutet er nach links, als müsste er der Crew die Richtung weisen.
Nur widerwillig wende ich mich von dem Tanz von Sonne und Wellen ab, kneife die Augen zusammen und versuche am Horizont etwas zu erkennen. Von hier unten kann ich allerdings nicht mehr als einen winzigen schwarzen Punkt in der Ferne ausmachen. Zügig mache ich mich auf den Weg in den hinteren Teil des Schiffes und erklimme die Treppen zum Achterdeck. Dort angekommen, hebe ich die Hand, um meine Augen vor den Reflexionen der Solarplatten abzuschirmen, die auf dem Dach meiner Kajüte in der Sonne blitzen. Anschließend fische ich den Anhänger meiner Kapitänskette unter meinem Hemd hervor, um ihn in die dafür vorgesehene Mulde in der Mitte des Steuers zu drücken. Der steuerradförmige, silberne Doppelkreis mit den acht Streben dazwischen sowie einem blauen Lapislazulistein in der Mitte fügt sich nahtlos hinein und lässt sich mühelos drehen. Ein Klicken ertönt und die Lenkung wird freigegeben.
»Los geht’s, ihr Faulpelze! Segel einholen und Motoren anwerfen!«, befehle ich.
»Aye, aye!«, tönt es mir entgegen.
»Weil du gerade auch selbst so fleißig warst«, ruft Willow, eine der Bootsfrauen, bevor sie langsam ihre Beine, die sie von der Reling nach unten hat baumeln lassen, an Deck schwingt und sich ausgiebig streckt.
»Wie war das?«, frage ich. »Du willst heute Abend freiwillig das Deck schrubben? Cool, danke!«
»Nee, da hab ich schon was vor«, entgegnet sie, streckt mir die Zunge heraus und zwinkert mir mit einem schwarz umrandeten Auge zu. Anschließend stürmt sie die Treppe hinab, um unserer Mechanikerin Aimée das Kommando weiterzugeben, während sich die restliche Crew daranmacht, die an diesem windarmen Tag ohnehin fast nutzlosen Segel zu streichen.
Kurz darauf geht ein Ruckeln durch den Rumpf des Schiffes, dann ertönt ein Brummen. Ein Geräusch, das in meinen Ohren wie ein sanftes Schnurren klingt. Durch die Sohlen meiner Lederstiefel hindurch spüre ich die Vibrationen, als die Maschinerie sich in Gang setzt, merke, wie sie mein Innerstes zum Beben bringen. Fast zärtlich lege ich meine Finger um die Griffe des Steuerrads vor mir und bewege es behutsam nach links, genieße das kalte Metall in meiner Hand. Wie von selbst breitet sich ein Lächeln auf meinen Lippen aus, denn in diesen Momenten bin ich eins mit der Astarte. Unter meinen Händen gleitet mein Schiff dahin, als wäre es eigens für mich erbaut worden. Und als hätte es auch für mich nie etwas anderes gegeben als das Leben als Piratin.
»Meinst du, die haben was Gutes geladen?«, fragt Ari, die gemächlich die Stufen zum Achterdeck hinaufsteigt, um sich zu mir zu gesellen.
»Für was zwischen die Zähne wird’s wohl reichen«, erwidere ich. Einen Moment lang beobachte ich meine Crew dabei, wie sie sich mit geübten Handgriffen durch die Takelage bewegt, bevor ich meine Navigatorin anschaue. »Hast du Jonne überreden können, dir die Möwe in die Pfanne zu hauen?«
Ari zuckt mit den Schultern. »Er war echt schlecht drauf, also mal sehen. Ist doch aber nicht meine Schuld, wenn er alles anbrennen lässt. Man sollte meinen, ein Koch sollte kochen können.«
»Tja, für Profis bist du hier auf dem falschen Schiff, fürchte ich.«
Grinsend mustert sie mich. »Stimmt wohl.«
»Kann ich nur zurückgeben.«
Ari schneidet mir eine Grimasse, ehe sie nach dem Kupferfernrohr greift, das seitlich am Sockel des Steuerrads befestigt ist. »Gib mir einen Moment.« Blitzschnell zieht sie es aus, hält es an ihr linkes Auge. Ihre Stirn kräuselt sich nachdenklich, ehe sie einen Mundwinkel nach oben zieht. »Perfekt. Sie fahren in die gleiche Richtung wie wir. Also können wir sie von hinten überfallen.«
»Wenn sie uns nicht vorher bemerken.«
»Hm. Sieht eher aus wie ein Community-Merger. Nichts, wovor wir uns fürchten müssen.«
In meiner Magengegend breitet sich ein unruhiges Kribbeln aus – eine Mischung aus Aufregung und dem Anflug eines schlechten Gewissens. Auf den meisten Schiffen, die sich zu solch einer schwimmenden Kommune zusammengeschlossen haben, leben friedfertige Menschen, die sich selbst versorgen, jedoch kaum Kampferfahrung besitzen. Für sie ein Vorteil in einer Welt, die nur noch aus Wasser besteht – allerdings macht sie das zu einer allzu leichten Beute für uns, obwohl sie meist nicht mit großen Reichtümern gesegnet sind. Sie arbeiten hart für ihre Familien und das Wenige, das sie besitzen.
Aber letztlich versuchen wir alle bloß zu überleben. Und wenn das bedeutet, Unschuldige zu berauben, um die eigene Crew für ein paar Tage länger am Leben zu erhalten, ist es das wert. Denn hier draußen ist Wasser dicker als Blut.
»Blue, Evan!«, rufe ich über die Geräusche der Motoren und des peitschenden Wassers hinweg den beiden Bootsmännern zu. »Macht die Kanonen startklar!«
»Aye, aye!«
»Bist du dir sicher?«, fragt Ari, senkt das Fernrohr, sieht zurück zu mir und hebt eine Augenbraue.
»Ja«, antworte ich. »Ich will kein Risiko eingehen, solange wir nicht sicher wissen, dass sie unbewaffnet sind. Das passiert uns nicht noch mal.«
Kameradschaftlich schlägt sie mir gegen die Schulter. »Ach, komm schon. Snap hat sich doch ganz gut wieder zusammengeflickt.«
»Zusammengeflickt«, echoe ich und zeichne mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft. Ernster füge ich hinzu: »Ich will einfach nicht, dass noch mal jemand ein Bein verliert.«
»Du machst dir immer noch Vorwürfe deshalb, oder?«, raunt Ari.
»Natürlich mache ich das«, murmele ich, wobei ich das Steuerruder fester umklammere.
»Das war nicht deine Schuld. Du konntest es nicht wissen.«
Ich hebe den Blick, betrachte die Narbe auf ihrer Wange, ein unübersehbar weißer Strich auf ihrer hellbraunen Haut. Auch etwas, das ich mir nie verzeihen werde. »Es war meine Schuld. Ich habe die Situation maßlos unterschätzt. Und das wird mir kein zweites Mal passieren. Verstanden?«
Der Ausdruck in ihren blassgrünen Augen wird eine Nuance weicher, wie Nebel, der über dem Meer aufzieht. »Aye.«
»Gut.« Langsam lockere ich meinen Griff. »Was schätzt du, wie lange wir noch brauchen, bis wir sie eingeholt haben?«
»Sie haben keinen Rückenwind. Wenn sie uns nicht bemerken und ihre Motoren anschalten – sofern sie überhaupt welche haben –, würde ich sagen, nicht mehr als ein paar Minuten.« Sie zögert einen Moment, bevor sie sanft hinzufügt: »Ich hoffe, du findest diesmal, was du suchst, Al.«
Sofort legt sich das Gewicht meines Geheimnisses auf meine Brust wie Blei. Ich habe ihr nie erzählt, nach wem ich suche oder wo ich herkomme. Dabei würde ich das gerne. Ari war die Erste, die ich als Crew-Mitglied auf meinem Schiff aufgenommen habe. Und sie war die Erste, die ich hier draußen in mein Herz geschlossen habe. Doch dieses Wissen würde sowohl sie als auch mich in Gefahr bringen, weshalb ich wie immer nur schweige und hoffe, dass das Brennen in meinen Augen schnell vergeht.
»Schon gut, du musst es mir nicht sagen. Aber ich bin da, wenn du reden willst, ja?«
Ich nicke langsam. »Ich, ähm … Danke. Das bedeutet mir viel.« Mehr bringe ich nicht zustande.
Sie stößt mich sanft in die Seite, schiebt das Fernrohr zurück in die dafür vorgesehene Halterung und springt die Stufen hinab aufs Deck. »Ich seh zu, dass ich meine Rauchpfeile hole und den Faulpelzen unter Deck Beine mache. Und wehe, du fasst mein Fernrohr an.«
»Würde ich nie tun«, rufe ich ihr hinterher. Und das meine ich absolut ernst. Seit ich bei meinem ersten und letzten Versuch, es zu benutzen, beinahe meine Hand an Aris Säbel verloren habe, hüte ich mich davor.
Ich richte meinen Blick wieder auf den Merger vor uns, dem wir sekündlich näher kommen. Allmählich kann ich in dicken, roten Lettern den Namen Pasahi erkennen, der in regelmäßigen Abständen ringsum auf das Metall lackiert wurde. Es scheint sich um einen Zusammenschluss aus fünf großen Schiffen zu handeln. Ich kann nicht sagen, wo eins anfängt und das andere aufhört, so nahtlos sind ihre metallenen Rümpfe miteinander verschweißt worden. Sie müssen schon viele Jahre lang eine gemeinsame Insel bilden. Dutzende Segel hängen schlaff von ihren Masten herab, nur ab und zu bewegt von einer leichten Brise, die sie aus der falschen Richtung trifft. Der Wind wird ihnen heute nicht helfen können.
Fragt sich bloß, ob sie sich selbst helfen werden.
»Alles bereit, Captain«, ruft Evan mir zu, während er die langen, braunen Strähnen, die ihm wirr ins Gesicht fallen, mit einem Stoffband im Nacken zusammenfasst. Dabei blitzt eine Reihe von Ringen an seinen Fingern auf.
Blue hinter ihm nickt bekräftigend und fährt sich durch die dichten schwarzen Haare, die er mit etwas Wachs vorne hochgegelt hat.
»Gut. Danke.«
»Unter Deck ist auch alles vorbereitet«, informiert mich Ari, die in diesem Moment mit einem zweiten Köcher über der Schulter sowie drei weiteren Crew-Mitgliedern im Schlepptau wieder ins Freie tritt. »Aimée zieht das Tempo an. Drei Minuten, sagt sie, nicht mehr. Baccus habe ich aus seiner Koje geworfen«, unser Quartiermeister räuspert sich verlegen und fährt sich durch die zerzausten Haare, »und Jonne schnappt sich ein paar Küchenmesser und hält sich bereit, falls wir ihn brauchen.«
»Perfekt. Danke, Ari.« Ich wende den Kopf und brülle in Richtung des Hauptmastes hinauf: »Caven, kannst du noch was erkennen?«
»Nein! Alles friedlich!«
Baccus grinst schief und tätschelt liebevoll den Griff seines Säbels. »Dann wird das ja ein leichtes Spiel.«
Ein kurzes Raunen geht durch meine Mannschaft an Deck, bevor plötzlich neun Augenpaare auf mir ruhen. Hungrig, geradezu lauernd hängt meine Crew an meinen Lippen, wartet auf mein Kommando.
Meine Finger schließen sich fester um die Griffe des Steuerrads. Ich schlucke die mahnenden Worte herunter, die mir auf der Zunge liegen, denn meine Mannschaft braucht jetzt einen starken, zuversichtlichen Captain und keinen, der vergangenen Fehlern nachhängt. Stattdessen verkünde ich, wonach sich alle nach der langen, eintönigen Zeit auf See sehnen: »Bereit machen zum Entern!«
»Aye, aye!«
Schlagartig ändert sich die Stimmung an Deck erneut. Waren wir eben alle noch mit den Vorbereitungen beschäftigt, macht sich nun eine beinahe greifbare Euphorie unter uns breit. Die Langeweile der letzten Tage, in denen wir ohne ein bestimmtes Ziel auf dem Endlosen Ozean umhergetrieben sind, wird von einer Woge aus Adrenalin abgelöst, die mit jedem Herzschlag mehr von unseren müden Gliedern belebt. Ich fühle, wie sich mein Puls beschleunigt, wie er dem immer gleichen Rhythmus der Wellen unter meinen Füßen entflieht und jede Faser in mir wachkitzelt. Mit einem Mal sehe ich alles um mich herum schärfer: die erwartungsvollen Gesichter meiner Kameraden, das Salz in ihren Haaren, die Tropfen von Gischt und Schweiß auf ihren Stirnen. Das dutzendfach geflickte, metallene Deck der Astarte, die leicht hin- und herschwingende Takelage, das verheißungsvolle Blitzen der Kanonenrohre in der Sonne. Mein gesamter Körper scheint vor Spannung geradezu zu summen, die Luft vor lauter Erregung stillzustehen.
Es ist so weit. Unser Bug befindet sich fast auf Höhe des Mergers, sodass ich mir sicher bin, das Steuerrad loslassen zu können. Ich drehe es wieder zurück in die Neutralposition, damit die Ruderpinne gerade ist und unser Schiff kontrolliert vorbeifahren kann. Mehr brauche ich nicht zu tun, denn Aimée ist erfahren genug, um die Motoren rechtzeitig abzuschalten, sobald sie unser Ziel im Periskop sieht. Deshalb drehe ich den Anhänger erneut, nehme ihn aus der Mulde, wodurch die Steuerung blockiert wird, und lasse die Kette unter meinem weißen Leinenhemd verschwinden. Entschlossen taste ich nach dem Säbel, der an meinem Ledergürtel befestigt ist. Dabei überprüfe ich beiläufig, ob der Revolver, den ich sicherheitshalber bei mir trage, unter dem dunkelblauen Tuch verborgen ist, das ich um meine Hüfte gebunden habe.
Sechs Kugeln. Mehr bleibt mir im Notfall nicht, um meine Freunde zu beschützen. Aber nach unseren gemeinsamen Jahren auf See vertraue darauf, dass sie auf sich selbst aufpassen können.
»Captain! Ein paar Leute versammeln sich an Deck. Keine schweren Geschütze«, berichtet Caven, der inzwischen den Ausguck verlassen hat, um sich zu uns zu gesellen. Er verzieht das Gesicht, hüpft unkoordiniert auf einem Bein herum und lässt seinen Fuß kreisen. »Scheiße! Da oben schläft mir immer alles ein.«
»Alles klar«, antworte ich und wende mich an den Rest der Mannschaft. »Dann wisst ihr Bescheid: Keine Kanonen. Tötet niemanden, wenn es nicht sein muss. Nehmt nur, was wir selbst brauchen, und vielleicht etwas, das wir zu Gold machen können.«
»Aye!«
Zwei Atemzüge lang brennt die Sonne noch auf meinem Gesicht, ehe wir in den Schatten der gewaltigen Segel der miteinander verschmolzenen Schiffe eintauchen, die zusammen gut zwanzigmal so groß sind wie die Astarte. Unheilvoll ragen ihre Rümpfe vor uns auf, das Metall rostig von den Wellen, die jahrzehntelang daran geleckt haben. Aus der Ferne höre ich das Bellen von Hunden und das Blöken von Schafen und Rindern, dicht gefolgt von Hufgetrappel und Pfiffen, als würde jemand eilig die Herden zusammentreiben. Überall ragen Pfeiler mit behangenen Wäscheleinen in die Höhe und die Gerüche von Seife, geschnittenem Gras und Exkrementen übertünchen den Duft des Ozeans. Ich rümpfe die Nase. Anscheinend haben wir sie gerade beim Düngen ihrer Felder gestört.
»Bist du bereit, Ari?«, frage ich.
»Gib mir nur eine Minute.«
Hastig ergreift sie den netzförmigen Teil der Takelage, der als eine Art Strickleiter dient, und klettert daran den Hauptmast hinauf, bis sie den Ausguck erreicht. Dort setzt sie den zweiten Köcher ab, nimmt ihren Bogen vom Rücken und macht sich an den Pfeilen zu schaffen. Zwei schmale Rauchschwaden kringeln sich in die Höhe. Anschließend legt Ari zwei Pfeile mit runden Spitzen ein, an denen jeweils eine Lunte glüht. Aus der Distanz wirken die roten Punkte wie Blutstropfen am Himmel. Langsam spannt sie die Sehne, zielt … und schießt die Bomben geradewegs auf den Teil des Mergers, der uns am nächsten ist. Mit einem dumpfen Geräusch schlagen sie auf dem Deck auf, schlittern leicht über den Boden. Zwei Sekunden lang passiert nichts, bis ich ein leises Zischen vernehme und sich das gewaltige Schiff-Konstrukt rasend schnell mit hellem Rauch füllt. Husten dringt zu uns herüber, Flüche, Schreie, Schritte. Währenddessen feuert Ari weitere Pfeile ab, bis dort nichts mehr zu sehen ist außer einer großen Wolke, die von den Masten durchbrochen wird.
»Alle in Position!«, kommandiere ich. »Beeilt euch! Aber …«
»… lasst keinen zurück«, unterbrechen Blue und Evan mich im Chor.
Willow reckt einen Daumen nach oben und blinzelt mir zu. »Wissen wir, Captain.«
Gespielt streng runzele ich die Stirn, während Ari behände wieder an der Takelage herunterklettert. Mit leisem Lachen stellen meine Kameraden und ich uns in einer Reihe an der Reling auf, jeder vor einer darin eingelassenen, abgegriffenen Schaltfläche mit jeweils zwei Tasten. Meine Atmung beschleunigt sich, sobald ich meine Finger auf den oberen Knopf vor mir lege. Mit der freien Hand streiche ich über die drei Zöpfe an der linken Seite meines Kopfes, mit denen ich mir meine blonden Haare in einer Art Sidecut aus dem Gesicht halte. Die in sie eingeflochtenen Kettenglieder klimpern leise bei der Berührung.
Heute wird ein weiteres hinzukommen.
Ich hoffe nur, dass es nicht umsonst sein wird.
»Bereit?«, frage ich so leise, dass meine Stimme beinahe von der leichten Brise davongetragen wird, die in diesem Moment auffrischt.
Ein Pirat nach dem anderen nickt, die Kiefer aufeinandergepresst, die Augenbrauen zusammengezogen.
Ich spanne die Muskeln an, spüre dem Rauschen des Blutes in meinen Ohren nach, das mit Leichtigkeit den Ozean übertönt, nicht jedoch das Pochen meines Herzens. Für einen Augenblick steht die Zeit für mich still. Das sanfte Auf und Ab der Wellen stoppt, das Brummen des Motors verklingt und sogar der Wind scheint für einen Moment den Atem anzuhalten. Gänsehaut überzieht meinen Körper.
Ein Herzschlag.
Zwei.
Drei.
»Jetzt!«, schreie ich, drücke mit aller Kraft auf den Schalter und ziehe gleichzeitig meine Klinge. Ein Zischen ertönt, gefolgt von einem dumpfen Geräusch, mit dem unsere Enterhaken auf der anderen Seite aufschlagen. Schnell lasse ich den oberen Knopf los und drücke stattdessen auf den unteren. Ein befriedigendes Klirren hallt zu mir herüber, als sich die Haken unwiderruflich an der fremden Reling verkanten und die Astarte langsam, aber sicher an den Merger herangezogen wird. Die Sekunden dehnen sich aus, werden länger und länger, bis unser Boot endlich zum Stillstand kommt und nur noch wenige Zentimeter zwischen den Schiffsrümpfen liegen.
Dann preschen wir vorwärts. Mit einem lauten Brüllen überwinden wir den schmalen Spalt, die Säbel angriffsbereit erhoben. Uns gegenüber, in sicherem Abstand zur Reling, erahne ich in dem Dunst eine verschwommene Gruppe aus etwa zwanzig Leuten, die meisten von ihnen mit unsicherem Stand. In den Händen halten sie Waffen. Ich erkenne Schwerter und Messer durch den Nebel, aber auch lange Gegenstände, deren Silhouetten mich an Spaten, Spitzhacken, Sensen und Mistgabeln erinnern. Wahrscheinlich sind es bloß Bewohner, einfache Frauen und Männer, die ihre Heimat verteidigen wollen, keine kampferprobten Söldner.
Gemächlich trete ich ein paar Schritte vor, versuche meiner Stimme einen möglichst gleichmütigen, aber bestimmten Klang zu verleihen. »Ganz ruhig! Gebt uns, was wir verlangen, und ihr habt nichts zu befürchten.«
»Verzieht euch, Piratenpack!«, schreit einer von ihnen zu uns herüber. »Sonst könnt ihr euer Schiff mitsamt eurer Crew vom Meeresgrund kratzen!«
»Das will ich jetzt mal überhört haben«, erwidere ich. »Also, noch mal: Wir können das entweder auf die sanfte oder auf die harte Tour klären. Es liegt ganz bei euch.«
Ich höre, wie jemand demonstrativ laut auf den Boden spuckt. »Das halten wir von euch!«, brüllt eine Frau zornig.
Zustimmende Rufe werden hinter ihr laut, ebenso wie ein metallisches Klirren, als würden die Bewohner des Mergers ihre Waffen heben.
»Schön«, knurre ich. »Ihr habt es nicht anders gewollt.«
Für etwa drei Atemzüge stehen wir uns weiterhin reglos gegenüber, während sich beide Seiten darum bemühen, die vom Rauch verzerrte Situation einzuschätzen.
Dann stürzen wir aufeinander zu, treffen uns mitten auf der frisch gepflügten Erde eines Ackers. Erde, die in wenigen Augenblicken von Blut benetzt sein wird – fragt sich nur, von wessen. Doch bevor ich mir weiter darüber Gedanken machen kann, erscheint vor mir ein dicker Mann, der angriffslustig ein Messer schwingt. Ich mache einen Schritt auf ihn zu, schlage ihm gezielt mit dem Griff meines Säbels die Klinge aus der Hand und versetze ihm einen kräftigen Tritt in die Magengegend, sodass er sich krümmt und auf dem Feld zusammensinkt. Panisch reißt er die Hände empor, um seinen Kopf zu schützen, doch der erwartete Stoß bleibt aus. Denn im selben Moment höre ich ein leises Zischen rechts von mir. Instinktiv ducke ich mich und entgehe damit nur um Haaresbreite dem tödlichen Hieb einer Sense. Ich nehme sogar den Luftzug wahr, der kühl über meine Schläfe streicht. Hastig rolle ich mich ab, um Abstand zu gewinnen. Die Besitzerin des Werkzeugs kommt bedrohlich näher, während sie die beiden Haltegriffe fester umklammert.
Grimmig starrt sie mich an. »Ihr hättet lieber abhauen sollen.«
Ich erkenne ihre Stimme. Es ist die Spuckerin.
»Wenn du nicht mehr zu bieten hast als das bisschen Speichel, werden wir damit schon fertig«, entgegne ich.
Wir taxieren die Silhouette der jeweils anderen, versuchen abzuschätzen, wer von uns den ersten Schritt machen wird. Nervös beiße ich mir auf die Unterlippe. Ich kann es mir nicht leisten, zu viel Zeit auf eine einzige Gegnerin zu verschwenden. Nur – solange sie die Sense wie einen Schild vor sich hält und auf meinen Zug wartet, komme ich nicht an sie heran. Allerdings … Ihre Waffe ist tückisch und ihre Reichweite groß, allerdings ist sie auch langsam und bereitet ihr Nachteile im Nahkampf. Genau darin liegt meine Chance.
Ich mache einen abrupten Schritt nach vorn und reiße meine Klinge empor. Sofort schwingt sie das Werkzeug in Richtung meines Rumpfs, doch darauf bin ich vorbereitet. So schnell ich kann, springe ich zurück, sodass sie mich knapp verfehlt, nur um genauso schnell wieder nach vorn zu hechten und ihre nun ungeschützte Seite anzugreifen. Erschrocken keucht sie auf, als sie ihren Fehler erkennt – zu spät. Meine Klinge bohrt sich in ihr Fleisch, tief genug, um sie kampfunfähig zu machen, aber nicht genug, um sie ernsthaft zu verletzen. Ihr schriller Schrei gellt über den Merger. Sie verliert das Gleichgewicht, stürzt und noch im Fall trete ich ihr die Waffe aus der Hand. Ein hässliches Knacken ertönt.
»Scheiße!«, stöhnt sie.
Doch mir bleibt keine Zeit, mich weiter um sie zu kümmern. Denn schon stürmen drei Männer auf mich zu, bewaffnet mit einem Schwert, einer Spitzhacke und einer langen Metallstange, die ihr Besitzer wie einen Knüppel schwingt. Ich weiche ein Stück zurück, um mir eine bessere Position zu verschaffen, wobei ich mit jemandem zusammenstoße.
Verdammt! Ich bin umzingelt!, schießt es mir durch den Kopf.
»Captain!«
Ich riskiere einen schnellen Blick über die Schulter und Erleichterung durchflutet mich, als ich eine meiner Bootsfrauen erkenne. »Willow! Bist du okay?«
»Klar. So ein paar Farmer kriegen mich doch nicht einfach so klein.«
Ich schnaube, während ich mich unter der Spitzhacke hinwegducke und die Klinge pariere, die gleichzeitig auf mich niedersaust. Angestrengt kneife ich die Augen zusammen, um in den Überresten des Rauchs klarer sehen zu können. Natürlich haben wir schon gefährlichere Gegner besiegt und in weitaus brenzligeren Situationen gesteckt als jetzt, aber wenn wir nicht aufpassen, wird unser Glück sich schneller gegen uns wenden, als uns lieb ist. Wir müssen uns schleunigst etwas einfallen lassen, denn hinter den drei Männern kann ich erkennen, dass Verstärkung naht. Weitere Bewohner des Mergers hasten auf das Deck, umklammern provisorische Waffen und versuchen uns einzukreisen und einen Vorteil aus ihrer Überzahl zu ziehen.
Fieberhaft suche ich die Umgebung nach etwas Brauchbarem ab. Bis auf die äußere Reling scheinen die anderen Brüstungen, die sonst das gemeinsame Deck der Schiffe unterbrochen hätten, entfernt worden zu sein. Am anderen Ende befindet sich statt einzelner Kommandobrücken bloß ein einziges, gewaltiges Steuerdeck mit drei Etagen, zu dem vier breite Treppen hinaufführen. Und in der Mitte davon, mit sicherem Abstand hinter den Geländerstreben, steht eine Gestalt mit wehenden Haaren und einer Art Robe, den Blick auf das Durcheinander aus kämpfenden Leibern und Dampfschwaden unter sich gerichtet. Sie wirkt wie erstarrt, doch auf ihrer Brust entdecke ich etwas Glänzendes: eine Kette.
Der Captain des Mergers. Das ist unsere Chance. Wenn ich es schaffe, ihn in die Enge zu treiben, dann sollte der Rest ein Kinderspiel sein.
»Willow! Halt mir den Rücken frei!«, rufe ich über meine Schulter hinweg und stürze auf den Bauern mit dem Schwert zu. Ich verkante meine leicht gebogene Klinge mit der seinen und lasse sie näher an seinen Griff heranrutschen. Mit einem gezielten Schlenker meines Handgelenks schlage ich ihm die Waffe aus der Hand, drehe gleichzeitig den Ellenbogen nach außen und donnere ihn mit aller Kraft gegen seine Nase. Es knirscht und kurz darauf benetzt etwas Warmes den Stoff meines Hemds. Stöhnend sackt er zusammen, während ich mich bereits abwende und die geschaffene Lücke ausnutze. Ich springe über ihn hinweg und schaue hastig hinauf zum Steuerdeck. Der Captain steht noch immer dort, stützt sich auf das Geländer und ruft seinen Leuten etwas zu, woraufhin sich einige Bewohner des Mergers vor den Treppen postieren, um die Aufgänge zu blockieren.
»Verdammt!«, fluche ich.
Hektisch sehe ich mich um, überlege fieberhaft, wie ich auf anderem Weg an den Kapitän herankommen könnte – und bleibe mit dem Blick an einem der Masten hängen. Die Segel flattern träge in einer kaum wahrnehmbaren Brise, verschwommen durch den emporsteigenden Rauch, doch die Seile dazwischen sind vorbildlich gespannt. Wenn es mir gelingt, am Achtermast hinaufzuklettern und unterwegs eines der Seile abzuschneiden, um mich daran hinüberzuschwingen …
Der Gedanke ist leichtsinnig, geradezu töricht, aber ich muss es probieren.
So schnell ich kann, sprinte ich über den Acker, die Finger fest um den Griff meines Säbels geschlossen. Auf der feuchten, lockeren Erde, die in alle Richtungen davonfliegt, finden meine Füße kaum Halt. Solch einen Untergrund bin ich nicht gewohnt, sodass meine Muskeln bereits nach wenigen Schritten brennen, als hätte jemand flüssiges Feuer hineingegossen. Mein eigenes Keuchen hallt unerträglich laut in meinen Ohren wider, untermalt von dem Trommeln meines rasenden Herzens. Immer wieder rutsche ich aus, wobei ich zugleich versuche einen Bogen um die Farmer zu machen, die gegen meine Kameraden kämpfen.
Ich muss es schaffen.
Für meine Crew. Für mich. Für mein Ziel.
Endlich erreiche ich den Mast, auf den ich es abgesehen habe, hänge den Säbel in die Halterung an meinem Gürtel und löse die Stoffschärpe von meiner Hüfte, um sie um den Mast zu schlingen. Dann wickele ich die Enden um meine Handgelenke, hebe die Arme über den Kopf und beginne mich mithilfe meiner improvisierten Kletterhilfe hinaufzuziehen.
»Nicht so schnell!«, grunzt ein Mann mit tiefer Stimme unter mir. Gleichzeitig schließt sich eine Hand fest um meinen Knöchel, zerrt mich gewaltsam zurück in Richtung des Decks.
Ich trete um mich, bemühe mich verzweifelt meinen Fuß freizubekommen, während ich den Stoff zwischen meinen Händen so straff wie möglich um den Mast ziehe. Dennoch rutscht er unaufhaltsam nach unten, bringt mich Stück für Stück meinem Widersacher entgegen, dessen Finger sich immer enger um mein Fußgelenk schließen. Schmerz schießt mein Bein herauf, lässt mich für einen Augenblick wie betäubt zurück. Kurz überlege ich, den Revolver zu benutzen, doch ich weiß instinktiv: Dafür ist keine Zeit. Mir bleibt nur eine Wahl. Ich muss an das Seil über mir herankommen.
Trotz meiner inzwischen bebenden Muskeln zwinge ich mich dazu, mein freies Bein anzuwinkeln, drücke mich damit empor und strecke mich. Bloß ein paar Zentimeter mehr … ein paar Millimeter …
Mit einem wütenden Knurren reißt der Farmer an meinem Fuß. Im selben Moment gelingt es mir, die Faust um das Seil zu schließen. Geschafft! Die rauen Fäden schneiden in meine Haut, aber ich klammere mich trotzig daran fest und ziehe, ziehe …
Zack!
Der Stiefel rutscht mir vom Fuß. Sein schwerer Absatz knallt dem Mann mit voller Wucht auf die Stirn.
»Du verdammte …!«, brüllt er, doch ich halte nicht inne, um zu erfahren, als was er mich betiteln will.
Stattdessen klettere ich hektisch weiter hinauf, bis ich die Mitte erreicht habe und außerhalb seiner Reichweite bin. Dort sind die Taue des Kreuzmasts befestigt, der dem Kapitänsdeck am nächsten ist. Ich schlinge meine Beine eng um das Metall, verhake meine Füße miteinander und nutze meinen Säbel, um es zu kappen. Das lose Ende schiebe ich mir zwischen die Zähne, ehe ich meine Waffe wieder am Gürtel befestige.
Ich riskiere einen kurzen Blick nach unten, wo der Mann fluchend damit beginnt, die Verfolgung aufzunehmen, und seinen Leuten zuruft: »Schnell! Hierher! Sie will zum Captain!«
Scheiße!
Eilig mache ich mich daran, die letzten Meter bis zur Spitze zurückzulegen, während unter mir weitere Bewohner des Mergers den Mast und die Takelage hinaufklettern. Auch auf dem Steuerdeck kommt Leben in die Menschen, die bis eben noch die Treppen bewacht haben. Sie stürzen auf den Captain zu, der sich seinerseits nun umdreht, um in seine Kajüte zu flüchten.
Mühsam zwinge ich mich dazu, nicht nach meiner Crew Ausschau zu halten, und löse stattdessen die Schärpe von meinem rechten Arm. Erneut schlinge ich meine Beine um den Mast, greife mit beiden Händen nach dem losen Seil, ziehe es straff – Bitte lass es halten! – und schwinge mich an ihm hinüber aufs Steuerdeck, wobei ich nur knapp an den Segeln vorbeischramme. Grober Stoff schneidet in meine Haut, reißt Löcher in meine Kleidung, doch das ist egal, als ich wenige Meter hinter dem Captain lande, der erschrocken herumwirbelt. Völlig verdattert steht er vor mir, als begreife er nicht, wie ich zu ihm habe vordringen können. In seinem blassen, überraschend weichen Gesicht spiegelt sich erst Fassungslosigkeit, dann Angst.
Hinter mir donnern schwere Schritte die letzten Stufen hinauf, dröhnen in meinen Ohren. Der Captain hebt die zierlichen Hände, wie um sich zu ergeben, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen, denn seine Leute sind lediglich einen Wimpernschlag von mir entfernt. Noch im selben Atemzug überwinde ich die Distanz zwischen uns, drehe ihm einen Arm auf den Rücken und halte ihm meine Klinge an die Kehle.
»Halt!«, brülle ich aus Leibeskräften über den Merger, wobei ich den dürren Mann unsanft näher an das Geländer schiebe. »Ergebt euch oder ich töte euren Captain!«
Kapitel 2
Die Sterne und der Ozean
Einen Moment lang ist es still auf dem Schiff, so still, als hätte selbst der Ozean den Atem angehalten.
Die Menschen, die eben noch versucht haben ihren Captain vor mir zu erreichen, halten mitten in der Bewegung inne. Dutzende Farmer sehen zu mir auf, ihre Kleidung von Blut und Dreck verschmiert, die Gesichter glänzend vor Schweiß. Schrecken zeichnet sich in ihren Zügen ab. Angst, Verzweiflung, Benommenheit. Demütigung.
Dann geht eine Erschütterung über das Deck, als einer nach dem anderen die Waffen und Werkzeuge fallen lässt, dicht gefolgt von den Jubelschreien meiner Crew.
Unter dem Gejohle lasse ich meinen Blick prüfend über die Menge schweifen und gestatte es mir endlich, gezielt nach meinen Kameraden Ausschau zu halten. Sie alle sehen ein wenig mitgenommen aus, scheinen aber weitestgehend unverletzt zu sein. Ari reckt mir einen Daumen entgegen, während sie ihren Säbel in die Scheide zurückgleiten lässt. Ein leises Seufzen entfährt mir.
»Nur ein guter Captain sorgt sich so sehr um seine Mannschaft«, krächzt der Mann, wobei sein Adamsapfel gegen meinen Säbel drückt.
Hat er mir gerade ernsthaft ein Kompliment gemacht?
»Ein noch besserer Captain kämpft mit ihr«, entgegne ich kühl.
Ein Glucksen ertönt und kurz darauf geht ein leichtes Beben durch den Rumpf des Kapitäns.
Wieso lacht er jetzt? Nimmt er mich etwa nicht ernst? Dieser hagere Mann in seiner viel zu großen Leinenrobe und mit so weichen Händen, als hätte er noch nie in seinem Leben ein Schiff durch einen Sturm manövriert?
»Sag deinen Leuten, sie sollen meiner Crew alles geben, was sie verlangt!«, zische ich. »Sonst schlagen wir hier alles kurz und klein!«
»Aber wir können uns doch sicher anders einig…«
Ich verstärke meinen Griff, drücke die Klinge ein wenig fester in seine Haut. Ein einzelner Tropfen Blut benetzt das Metall. »Habe ich mich unklar ausgedrückt? Ihr hattet eure Chance. Und ihr habt sie verspielt.«
»N-nein«, presst er hervor, bevor er seinen Leuten mit dem freien Arm einen Wink gibt.
Entschlossen sehe ich zu Ari. Wir tauschen ein Nicken, woraufhin sie sich umdreht und dem Rest meines Teams Kommandos zuruft, die Farmer zu bewachen, Aufmüpfige zu fesseln und das Schiff nach Beute zu durchforsten. Über die unter Deck Gebliebenen mache ich mir allerdings keine Sorgen. Wahrscheinlich befinden sich fast alle Kampffähigen hier oben, während die anderen sich im Bauch des Schiffes versteckt halten. Und selbst diese werden sich wohl kaum trauen, etwas zu unternehmen, aus Furcht, dass es ihren Anführer den Kopf kosten könnte. Der Zusammenhalt auf diesem Merger scheint außerordentlich stark zu sein.
»Bitte … Ich bitte euch. Wir geben euch alles, was ihr wollt, aber bitte … tut meinen Leuten nichts«, sagt der Captain fast flehentlich.
»Keine Sorge«, antworte ich und lockere meinen Arm ein wenig, ohne ihm jedoch die Möglichkeit zur Flucht zu gewähren. »Ihr habt mein Wort. Wenn ihr keinen Widerstand leistet, wird niemandem etwas geschehen.«
»Danke.«
Ich schnaube, als ich die Erleichterung in seiner Stimme wahrnehme. »Du solltest einer Piratin nicht so leichtfertig vertrauen.«
»Wir sind alle Kinder der See und der Sonne. Kinder derselben Götter. Sie werden uns schützen und über euch richten, falls ihr euer Wort brechen solltet. Darauf vertraue ich.«
»Bete lieber, dass du richtig liegst«, murmele ich. »Andernfalls werden eure Götter euch auch nicht mehr retten können.« Zumindest, wenn du jemals das Pech hast, noch auf andere Piraten zu stoßen. »Bring mich in deine Kajüte«, fordere ich dann, ehe ich ihn vor mich her in Richtung der Treppe schiebe, die uns am nächsten ist.
»Aber warum? Darin ist nichts! Wir haben keine Schätze an Bord, kein Gold oder …«
»Bring mich einfach da rein!«, unterbreche ich ihn barscher als beabsichtigt. Allmählich beginnt die Anspannung in mir erneut zu wachsen. Wenn ich dieses Mal wieder nicht fündig werde …
Nur widerwillig setzt der Captain sich in Bewegung, wobei mich seine langen Haare im Gesicht kitzeln. Eine eigenartige Mischung aus Angstschweiß und Seife steigt mir in die Nase, während die Ärmel seiner eigentümlichen Robe zu schlackern beginnen. Auf einmal zittert er so sehr, dass ich mich frage, ob seine Beine ihn den Weg hinunter überhaupt tragen werden, doch das Kinn hält er stolz erhoben. Die Mitglieder seiner Crew, die halb auf dem Achterdeck, halb auf den Treppen stehen geblieben sind, werfen mir finstere Blicke zu, trauen sich allerdings nicht, mich anzugreifen oder etwas zu sagen. Vermutlich ist ihnen nur allzu bewusst, wie entsetzlich dünn der Hals ihres Kapitäns ist – und wie scharf meine Klinge.
Eine Etage unter dem Steuerdeck bleiben wir schließlich stehen. Hinter den schmuddeligen, braun-grünlichen Glasfenstern, die in eine Wand aus Metallstücken, Plastikfetzen und Mosaiken aus Perlen und Muschelschalen eingelassen sind, kann ich kaum etwas erkennen. Nervös friemelt der Mann mit der freien Hand an seiner Brust herum, um seine Kapitänskette hervorzuziehen – schwarzes Metall mit einer perlmuttfarbenen Mondsichel – und in eine Mulde unterhalb des Türknaufs zu drücken. Mit zittrigen Fingern dreht er den Anhänger darin herum, bis ein Klicken ertönt.
»Danke«, sage ich kühl, trete die Tür mit meinem noch verbliebenen Stiefel auf und schiebe ihn vor mir her in die Kajüte.
Es dauert einen Moment, bis ich mich an die Schummrigkeit, die in diesem Raum vorherrscht, gewöhnt habe und meinen Blick durch die schäbige Kajüte gleiten lasse. Neben einem Bett mit durchgelegener Matratze und löchrigen Leinenlaken sowie einem Nachttopf daneben entdecke ich einen rostigen Spind und eine Blechtonne, die zu einem Hocker umfunktioniert wurde. Von der Decke baumelt eine einzelne Öllaterne herab, die einen ranzigen Geruch verströmt. Darunter steht ein riesiger Tisch aus Zahnrädern, Schrauben, Kupferrohrteilen und allerlei anderem Schrott, auf dem ein Kompass, eine Metalltasse und ein zerschlissenes Pergament mit Abdrücken derselben liegen.
Sofort stürze ich darauf zu, bugsiere den Kapitän dabei unsanft vor mir her. Mit klopfendem Herzen starre ich auf die Karte.
Bitte, denke ich, bitte, bitte!
Doch ich spüre die Enttäuschung bereits in meine Eingeweide sickern, bevor ich die Zeichnung richtig betrachte. Denn sie sieht aus wie jede andere: leer.
Leer bis auf die üblichen vereinzelten Gebirgsspitzen der Alten Welt, die in einem schief gezeichneten Netz aus Breiten- und Längengraden aus dem Ozean ragen. Und ungefähr mittig eine Kritzelei von etwas, das vage an eine Kuppel erinnert.
Schmerzhaft krampft sich mein Herz zusammen.
Meine Suche war erfolglos.
Mal wieder.
***
Der Mond ist längst aufgegangen, bis wir das letzte Teil unserer frisch erbeuteten Fracht ordentlich verstaut haben. Nun stapeln sich in unserem Lagerraum Fässer voller Lebensmittel und Gewürze, Stoffballen für neue Kleidung und Segel, Kisten mit Metallteilen sowie ein paar Schmuckstücke, die wir zu Geld machen können. Inzwischen ist es schon ein paar Stunden her, seit wir der Pasahi den Rücken gekehrt und mit den Motoren auf Hochtouren davongefahren sind. Und das war unser Glück, denn kaum hatte ich den Kapitän freigegeben und war zurück an Bord der Astarte gesprungen, haben die Bewohner des Mergers begonnen zu rebellieren. Sie haben sogar versucht die Verfolgung aufzunehmen – auch wenn ich bezweifele, dass das im Sinne des Kapitäns geschah –, aber vergebens. Jetzt ist unsere über den Tag gespeicherte Solarenergie zwar verbraucht, doch von der schwimmenden Kommune ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Trotzdem haben wir darauf verzichtet, die Öllampen rund um die Reling herum anzuzünden, um niemanden auf uns aufmerksam zu machen. So wird das Deck zwar nicht von ihrem warmen, orangefarbenen Schein erhellt, aber der Mond leuchtet heute Nacht ohnehin hell genug.
Erschöpft lehne ich mich an den Hauptmast und genieße die klare Luft, die in meine Lungen strömt. Dabei spiele ich abwesend an dem neuen Metallglied in einem meiner Zöpfe, das ich von der Kette des Merger-Captains abgeschnitten habe, bevor wir zurück an Bord gegangen sind. Eine weitere Erinnerung an eine erfolglose Suche, eine weitere Schuld, die auf meinen Schultern lastet und die ich eines Tages begleichen muss, wenn ich endlich Erfolg gehabt habe. Wenn ich endlich meinen Hafen wiedergefunden habe, den ich verloren habe.
Wenn.
Mit einem leisen Seufzen schaue ich hinauf, betrachte den beinahe vollen Mond, der die wenigen Wolkenschlieren am Himmel silbrig zeichnet. An meine Ohren dringt das entfernte Lachen meiner Kameraden, die sich an Deck versammelt haben, um ihren Erfolg zu feiern. Es ist zum einen die Erleichterung, sie für einige Wochen mit frischem Essen versorgt zu wissen, zum anderen die Enttäuschung, die meine Glieder nun träge und schwer werden lässt.
»Cooler Style! Trägt man das jetzt so?«, fragt Ari und stellt sich vor mich, einen Arm hinter ihrem Rücken verborgen. Ihre Augen funkeln schelmisch.
Ich schaue hinunter auf meine Füße. Der rechte steckt nach wie vor in einem ausgetretenen Lederstiefel, den linken habe ich mit überkreuztem Bein darauf abgestellt, um die nackte Sohle vor der Kälte des Decks zu schützen. Sein Gegenstück habe ich in dem Tumult nicht mehr gefunden.
»Der letzte Schrei«, erwidere ich grinsend. »Hat dir das etwa niemand gesagt?«
»Sicher? Ich weiß ja nicht. Es wirkt etwas … kühl.«
Ich zucke die Achseln, lasse meinen Blick gespielt abschätzig über ihren Rock, die zerschlissene Bluse und die abgenutzte Armschiene wandern. Köcher und Bogen hat sie abgelegt. »Na ja … Dein Geschmack ist auch nicht gerade …«
Aris Arm schnellt nach vorn, ehe mich etwas Hartes im Gesicht trifft und polternd zu Boden fällt.
»Aua!«, protestiere ich und bücke mich, um es aufzuheben. Mein verlorener Stiefel.
»Mein Geschmack ist ausgezeichnet«, widerspricht Ari, wobei sie die Nase in die Höhe reckt. »Apropos ausgezeichneter Geschmack: Schau mal, was ich gefunden habe!« Sie hält mir ein türkisfarbenes Tuch unter die Nase, das mit Goldfäden durchwirkt ist. »Ich hab keine Ahnung, wie sie das machen oder woraus, aber es ist unfassbar weich. Diese Leute wissen definitiv, was sie tun.«
»Das ist also nur das, was wir wirklich brauchen?« Es fällt mir schwer, das Lachen in meiner Stimme zurückzuhalten.
»Ein bisschen was Schönes muss manchmal sein. Solltest du vielleicht auch mal probieren.«
Ich hebe eine Augenbraue, spüre das verräterische Zucken meiner Mundwinkel.
»Guck mich nicht so an! Sonst kannst du deinen Stiefel nächstes Mal allein holen!«
Schnell mache ich mich daran, den Schuh überzustreifen, damit sie mein Grinsen nicht sieht.
»Willst du nicht mit zu den anderen kommen?«, fragt Ari, als ich fertig bin, die Stimme plötzlich um einiges weicher. »Jonne und Baccus haben zur Feier des Tages Karamell-Kaffee mit Rum gemacht. Aimée und Snap sind auch an Deck gekommen.« Sie presst die Lippen aufeinander, scheint kurz mit sich zu ringen, bevor sie ergänzt: »Alle warten auf dich.«
In ihren Worten schwingt eine unausgesprochene Frage mit und einen Augenblick lang bin ich versucht ihr zu antworten. Meiner Freundin endlich mein Geheimnis anzuvertrauen, egal, wie gefährlich diese Information ist. Doch der Moment verstreicht und die darauffolgende Stille dröhnt in meinen Ohren, wiegt beinahe schwerer als mein Geheimnis.
Aber nur beinahe.
»Klar«, antworte ich deshalb bloß leichthin, auch wenn ich nicht verhindern kann, dass meine Stimme eher hohl als gelassen klingt.
Ari runzelt die Stirn, sagt allerdings nichts, während ich zusammen mit ihr in Richtung Bug schlendere. Lautes Gelächter schallt mir entgegen, vermischt sich mit dem Geräusch von Blechkrügen, die aneinandergestoßen werden. Meine Crew sitzt in einem lockeren Kreis an Deck, zwischen sich Töpfe und Pfannen mit Essen sowie eine Platte mit frisch erbeuteten Keksen, die gerade herumgereicht wird. Ohne mich zu fragen, drückt mir unser bereits angetrunkener Quartiermeister einen dampfenden Becher in die Hand und nimmt sich einen neuen von Jonnes Tablett. Zufrieden stelle ich fest, dass alle inzwischen leichte Verbände an den nötigen Stellen tragen. In den nächsten Tagen wird Baccus wahrscheinlich alle Hände voll zu tun haben, die Löcher in unser aller Kleidung zu stopfen und Blut und Dreck herauszuwaschen.
»Auf dich, Captain!«, ruft er jetzt lautstark in die Runde und alle stimmen mit ein. »So reiche Beute hatten wir schon lange nicht mehr.«
»Und auf deine krasse Nummer mit dem Seil!«, ruft Blix, unsere zweite Bootsfrau, wobei sie so energisch mit dem Kinn in meine Richtung ruckt, dass ihre schulterlangen Creolen schlackern.
»Ohne so eine grandiose Crew wie euch hätte ich das nie geschafft. Also auf euch!«, winke ich ab, wobei ich mich zu ihnen auf das Deck setze und meinen Arm ausstrecke, um den Krügen der anderen in unserer Mitte zu begegnen.
Kurz lasse ich meinen Blick über die Speisen gleiten – heute gibt es nach langer Zeit mal wieder frisches Gemüse und Obst sowie gebratenes Fleisch. Ein guter Tag für uns alle. Ich nehme einen großen Schluck von dem Gebräu, genieße den bittersüßen Geschmack in meinem Mund und das leichte Brennen in meiner Kehle, ehe ich einen Keks hinterherschiebe. Sofort fühle ich, wie mir wärmer wird, wie sich der Knoten in meiner Brust ein wenig löst, doch das liegt nicht am Alkohol.
»Wir sollten ein Gebet sprechen, bevor wir essen«, wirft Evan mit strenger Stimme ein, als unsere dritte Bootsfrau Joy sich gerade an den gerösteten Kartoffeln bedienen will.
Jonne verdreht die Augen. »Kann das nicht warten?«
»Nur weil wir Piraten sind, müssen wir noch lange nicht unsere Seelen verkommen lassen«, hält er dagegen.
»Ich glaube«, wirft Willow ein und schnappt sich ein Stück Fleisch, »dafür ist es ein bisschen zu spät, mein Lieber.«
Evan verzieht beleidigt das Gesicht und ich muss ein Lachen unterdrücken. Es ist schon paradox, dass ausgerechnet der erste Kanonier der Astarte streng gläubig ist – aber wenigstens ist so wenigstens eine Person an Bord, die sich um unser Seelenheil bemüht. In Anbetracht der vielen Kettenglieder in meinen Haaren ist das vielleicht gar nicht so verkehrt.
»Nimm’s nicht so schwer«, sagt Aimée. Sie klopft ihm auf die Schulter, während sie über seinen Kopf hinweg nach einer Feige greift. »Manche wollen eben einfach nicht gerettet werden.«
»Was man von dir nicht gerade behaupten kann, so laut, wie du um Hilfe gerufen hast, als wir dich gefunden haben«, stichelt Joy und wirft ihren langen, geflochtenen Zopf über die Schulter.
»Du warst damals auch nicht viel besser«, schießt Blix zurück. »›Bitte nehmt mich mit, ich halte es bei meinen Eltern nicht mehr aus!‹«
»Und du? Du hast doch …«
»Also, ich für meinen Teil bin froh, dass ihr alle hier gelandet seid«, unterbreche ich Willow, bevor das Wortgefecht wieder einmal ausartet.
Alle sehen mich an.
»Wie süß. Wird unser Captain etwa sentimental?«, fragt Baccus grinsend.
»Nö. Ich meine nur – sonst hätte ich ja nichts mehr zu tun.«
Empört zieht Caven die Luft ein. »Hey! Was soll das denn heißen?«
Ich zucke mit den Schultern, lächele und nippe an meinem Getränk.
»Genug jetzt!«, beschließt Jonne. »Esst endlich, sonst wird’s kalt!«
Ari gluckst. »Vielleicht schmeckt es kalt ja besser.«
»Du elende …!«
Wütend macht Jonne Anstalten, nach etwas zu greifen, doch Ari ist schneller. Blitzschnell schnappt sie zu und hält sich etwas vor die Brust, das verdächtig nach der gerupften und gebratenen Möwe von heute Morgen aussieht. »Vergiss es lieber gleich!«
»Auseinander, ihr beiden«, sagt Blue unvermittelt und wie immer werden beim Klang seiner tiefen und ruhigen Stimme alle schlagartig still. Seine Mundwinkel zucken amüsiert. »Das ist ja nicht zum Aushalten mit euch.«
»Dann soll sie nicht ständig meine Kochkünste …«
»Mir ist noch nie ein Koch untergekommen, der so schlecht kochen kann.«
Caven schnaubt und streckt seine langen Beine von sich. »Erstaunlich. Dafür, dass ihr euch immer nur streitet, habt ihr vorhin echt gut aufeinander aufgepasst.«
Jonnes Brust scheint vor Stolz ein wenig anzuschwellen. »Ich hatte mit Abstand die wenigsten Wunden, frag Snap!« Er schlägt unserem Schiffsarzt so hart auf den Rücken, dass dieser sich an seinem Kaffee verschluckt.
»Stimmt«, presst er hustend hervor und hält sich seinen rechten Arm dabei vor den Mund. Dabei blitzt die silberne Skeletthand, die er zum Schutz über seiner Operationshand trägt, hell im Mondlicht auf.
»Ist ja aber auch kein Wunder«, fährt Jonne fort. »Küchenmesser sind besser als jeder Säbel!«
»Oder es liegt einfach daran, dass er ein Schisser ist und jedem Angriff schon aus drei Metern Entfernung ausweicht«, flüstert Ari mir ins Ohr und ich kann ein Lachen nicht länger unterdrücken.
Eine Weile sitze ich bei meinen Kameraden, höre ihnen zu, wie sie mit ihren Kampferfolgen prahlen und sich gegenseitig aufziehen. Ihre Leichtigkeit gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, von Heimat und Abenteuer zugleich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich sie alle nacheinander gefunden habe, einsam auf dem Meer treibend, von Schiff zu Schiff wandernd oder auf der Flucht vor ihren Dämonen. Verlorene Seelen, die nach einem Zuhause und einer Chance gesucht haben, sich zu beweisen. Inzwischen sind sie wie eine Familie für mich, ein Hafen auf hoher See.
Ein Hafen wie der, den ich vor acht Jahren verloren habe.
»Ich werde mich aufs Ohr hauen«, verkünde ich schließlich, als mein Becher längst leer ist und das Getränk in meinem Bauch die Kälte der Nacht nicht länger im Zaum halten kann. »Evan, Blue, heute Nacht seid ihr dran mit der Wache. Ich übernehme dann morgen früh.«
»Aye, aye«, erwidert Blue, wobei er gewissenhaft seinen halb leer getrunkenen Krug beiseitestellt.
»Weckt mich, wenn was ist«, sage ich und stehe auf, bevor ich mir einen weiteren besorgten Blick von Ari einfange. Sie scheint zu merken, dass mit mir etwas nicht stimmt, aber sie respektiert meine Privatsphäre genug, um mich nicht zu bedrängen. Eine Sache, die ich an ihr sehr zu schätzen gelernt habe.
Ich habe es nicht eilig, während ich über das Deck zu meiner Kajüte schlendere und meinen Blick zum Wasser schweifen lasse. Das Meer liegt spiegelglatt da und nur der Mond zeichnet tanzende Schatten auf seine Oberfläche. Hier, fernab von meiner Crew, ist es mit einem Mal bedrückend ruhig. So ruhig, dass mir meine Gedanken mit einem Mal entsetzlich laut vorkommen.
Nach einem letzten tiefen Atemzug öffne ich die Tür zu meinem Zimmer und trete hindurch. Im Gegensatz zu dem Raum des Merger-Captains wirkt meiner geradezu heimelig mit der schmalen Pritsche an einer Wand und einem Regal voller Bücher und Schriftrollen an der gegenüberliegenden. Auch in meiner Kajüte steht ein Tisch, doch dieser besteht aus einem Bronzerahmen und einer Platte aus Holz, einem seltenen Luxusgut. Auf ihm befinden sich Dutzende Pergamentrollen, eine Schreibfeder mit Tintenfass, neben dem zahlreiche Flecken verteilt sind, sowie ein bronzener Sextant. Meine einzige Garnitur Ersatzkleidung liegt unordentlich zusammengefaltet auf einem der Stühle, die um den Tisch herumstehen – einer für jedes Mannschaftsmitglied. Denn wenn die Tage kürzer werden und das Wetter rauer, essen wir jeden Abend gemeinsam in diesem Raum, Seite an Seite.
Aber heute bleibt er dunkel, still und leer.
Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen habe, schlüpfe ich aus den Stiefeln und lasse sie achtlos neben meine Pritsche fallen. Mit einer geübten Bewegung hole ich die Kiste mit dem Funk-Equipment aus der Truhe neben meinem Bett. Ich entriegele sie mit meiner Kette, schiebe ein zerfleddertes Buch beiseite, um den Receiver, das Funkgerät und die Antenne herauszunehmen. Letztere stelle ich vor das linke Fenster und setze mich dann auf die rechte der beiden mit Decken ausgelegten Fensterbänke, von denen aus ich ungehindert hinaus auf das Meer schauen kann. Meine Muskeln ächzen von der Anstrengung des Tages und einige Schürfwunden brennen, aber ich habe Snap vorhin verscheucht, damit er sich stattdessen um die anderen kümmert. Außerdem bilde ich mir ein, mein schlechtes Gewissen zumindest ein klein wenig lindern zu können, wenn ich die Verletzungen und die Schmerzen aushalte.
Langsam schlinge ich die Arme um die Knie, lehne meine Schläfe gegen das kalte Glas, die Finger fest um das antike schwarze Gerät geschlossen. Draußen kann ich um den Mond herum die Sterne erkennen, die hell leuchtend am Firmament stehen. Manchmal stelle ich mir vor, dass auch sie den Ozean wehmütig betrachten, verzückt vom Tanz seiner Wellen, an dessen Schönheit sie sich nicht sattsehen können.
Als ich ein leises Tapsen höre, breitet sich ein leichtes Lächeln auf meinen Lippen aus. Weiche Pfoten betreten die provisorische Treppe aus ausrangierten Kisten, die ich gebaut habe, weil unsere Schiffskatze als einziges Exemplar auf dieser Welt nicht richtig springen kann. Kurz darauf schmiegt sich Pandora warm auf meinen Schoß und starrt mich auffordernd an, damit ich sie kraule.
Ich tue ihr den Gefallen, vergrabe meine Finger in ihrem flauschigen grauen Fell, während ich das Funkgerät einschalte. Wie von selbst drehe ich am Rad des Receivers, bis die mir so vertraute Frequenz von 249,13 Kilohertz auf dem Display erscheint, ehe ich mir das Mikrofon vors Gesicht halte und den Sprechknopf betätige. »Hey, bist du da? Hier spricht Little Doe. Kannst du mich hören? Bitte kommen.« Kurz lasse ich den Knopf los, schlucke schwer, warte vergeblich auf eine Antwort. Langsam drücke ich ihn erneut. »Ich … Ich wollte dich nur wissen lassen, dass es mir gut geht. Und ich hoffe, dir auch. Weißt du … Du fehlst mir ganz schön. Aber ich bin dran. Ich finde dich. Versprochen. Hab dich lieb.«
Die letzten Worte kommen hastig über meine Lippen, weil meine Stimme bricht. Eine Weile lang starre ich auf das schwarze Plastik in meiner Hand, bis es vor meinen Augen verschwimmt und ich das Gerät ausschalte, um die kostbare Batterie zu schonen. Was gäbe ich darum, endlich wieder ihre Stimme zu hören, wie damals, als sie mir heimlich von spannenden Entdeckungen erzählt hat, die sie im Labor gemacht hat. Mit einem leisen Seufzen lehne ich meinen Kopf erneut an das kühle Fensterglas, während Pandora auf meinem Schoß sanft zu schnurren beginnt, als wollte sie mir Trost spenden.
Und dann, still und heimlich, sehne ich mich nach meiner Mutter.
Ich sehne mich nach ihrer Umarmung, ihrem Lachen, ihrem Duft. Nach dem Gefühl ihrer Kleidung, wenn sie über meine Haut strich, das Kitzeln ihrer Haare auf meinen Wangen. Den Geschichten, die sie mir unter dem gleichen Sternenhimmel ins Ohr flüsterte, den ich jetzt auch betrachte, obwohl er damals noch ein anderer für mich war.