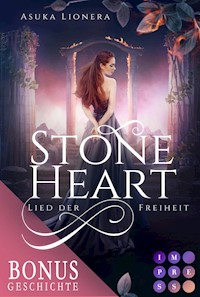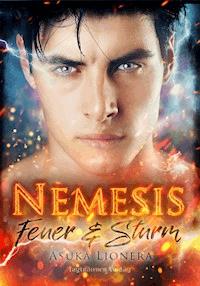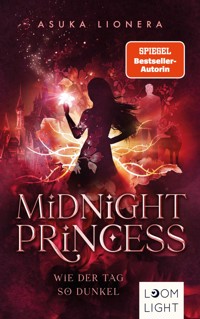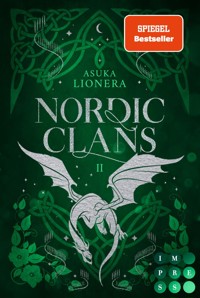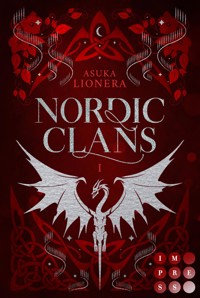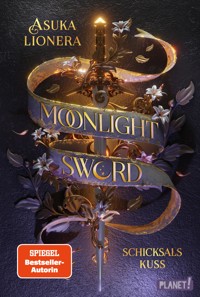12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mitreißend und überraschend von der ersten bis zur letzten Seite Augen, so golden wie die Sonne, markieren den Fluch der Götter. Nur eines kann den Bann brechen, der die Menschen jede Nacht in den Körper eines Tieres zwingt: die Liebe. Doch wem würdest du in einem Königreich voller Magie und Intrigen so vertrauen, dass du ihm dein Herz schenkst …? Diese E-Box enthält alle Bände der »Divinitas«-Trilogie (inklusive Bonusgeschichte) von Erfolgsautorin Asuka Lionera: Falkenmädchen (Divinitas Band 1) Sobald die Sonne aufgeht, verwandelt sich Miranda in einen Falken. Nur ihre Familie kennt dieses Geheimnis. Bis sie in ihrer Tiergestalt gefangen genommen wird und fortan zur Beizjagd des jungen Prinzen dienen soll. Wolfsprinz (Divinitas Band 2) Fye ist eine Halbelfe. Von den Elfen verachtet und von den Menschen gefürchtet, gibt es für sie keine Heimat – bis sie enttarnt und gefangen genommen wird. Ihr Herz muss eine Entscheidung treffen: Vertraut sie dem Prinzen mit den goldenen Augen oder dem strahlenden Ritter? Löwentochter (Divinitas Band 3) In Giselle wütet eine Löwin, die sie kaum im Zaum zu halten vermag. Einzig Ayrun, dem Gesandten der Waldelfen, gelingt es, vorsichtig zu der wunderschönen, unnahbaren Prinzessin durchzudringen. Doch ist er wirklich derjenige, für den ihr Herz schlägt? Leserstimmen zur Reihe: » Diese Story hat mich umgehauen!!« »Ich würde das Buch immer wieder lesen.« »Einfach nur wahnsinnig toll!« //Diese Reihe ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
www.impressbooks.deDie Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2020 Text © Asuka Lionera, 2015, 2016, 2017, 2020 Redaktion: Martina König Coverbild: shutterstock.com / © KHIUS / © evanztampubolon / © herryfaizal / © Roxana Bashyrova / © martinho Smart Covergestaltung der Einzelbände: Ria Raven Coverdesign Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60674-4www.carlsen.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Asuka Lionera
Falkenmädchen (Divinitas 1)
»Ich bin das Falkenmädchen.«Unter den Menschen gibt es jene, die den Fluch der Götter in sich tragen. Sie leben verborgen und ihre Augen sind golden wie die Sonne. Um den Bann zu brechen, der sie in den Körper eines Tieres zwingt, müssen sie ihren Gefährten finden – den einen Partner, mit dem ihr Herz für immer verbunden ist … Sobald die Sonne aufgeht, verwandelt sich Miranda in einen Falken. Nur ihre Familie kennt dieses Geheimnis. Doch als ihr Vater getötet wird, wenden sich die Menschen, denen sie vertrauen zu können glaubte, von ihr ab. Auf sich allein gestellt, wird sie als Falke gefangen genommen und soll fortan zur Beizjagd des jungen Prinzen dienen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Bonusgeschichte
Das könnte dir auch gefallen
© rini
Asuka Lionera wurde 1987 in einer thüringischen Kleinstadt geboren und begann als Jugendliche nicht nur Fan-Fiction zu ihren Lieblingsserien zu schreiben, sondern entwickelte auch kleine RPG-Spiele für den PC. Ihre Leidenschaft machte sie nach ein paar Umwegen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihren vierbeinigen Kindern in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
Kapitel 1
Miranda
Schon seit einer Weile kann ich meine Finger nicht mehr spüren, doch ich zwinge mich dazu weiterzumachen.
Aus den Augenwinkeln werfe ich einen Blick auf den Wäscheberg neben mir und seufze. Es kommt mir vor, als wolle er gar nicht abnehmen, egal, wie viele Kleidungsstücke ich säubere. Fast, als würde eine unsichtbare Macht immer wieder ein neues Stück obenauf legen.
Ich ziehe das Hemd, das ich gerade im Fluss auswasche, aus dem eiskalten Wasser und puste mir in die Hände, ehe ich sie fest aneinanderreibe, in der Hoffnung, sie dadurch wärmen zu können. Leider ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Meine Haut ist rot und rissig, die Finger sind steif vor Kälte.
Ich greife nach dem nächsten Wäschestück, tauche es mehrmals in das eisige Wasser und wringe es anschließend trocken, während ich verbissen versuche den Schmerz in meinen Händen zu verdrängen. Es ist, als würden tausend spitze Nadeln durch meine Haut stechen, bis jede noch so kleine Bewegung meiner Finger zur Qual wird.
Fahl scheint der Mond zwischen den Zweigen hindurch, direkt auf den Haufen schmutziger Wäsche, der mich zu verhöhnen scheint. Ich lasse den Kopf hängen, schließe die Augen und atme durch. Danach bewege ich ein paar Mal die Schultern vor und zurück, um die verkrampften Muskeln zu lockern. Ich knie schon Stunden auf den harten Ufersteinen, ohne mich großartig zu bewegen, sodass meine Füße mittlerweile gefühllos geworden sind.
Mit klammen Fingern streiche ich mir einige blonde Strähnen aus dem Gesicht und mache mich nach der kurzen Pause wieder an die Arbeit. Ich muss fertig werden, bevor die Sonne aufgeht, und ich habe noch ordentlich zu tun. Keine Zeit für Trödeleien!
Wie immer bin ich um diese Zeit allein, doch ich habe keine Angst. Niemand traut sich nachts in den Wald. Die Dorfbewohner fürchten sich vor den wilden Tieren, die hier lauern, von denen ich aber noch nie eines zu Gesicht bekommen habe.
Aber Tiere meiden für gewöhnlich meine Gegenwart. Sie spüren besser als Menschen mit einer untrüglichen Gewissheit, dass ich anders bin. Dass mit mir etwas nicht stimmt.
Und sie haben recht.
Über die Jahre bemerkten auch die Menschen mein Anderssein. Mondscheinmädchen und Nachtkind sind die netteren Worte, mit denen sie mich betiteln, wenn sie mich zu Gesicht bekommen. Ich kann es ihnen nicht verübeln, schließlich fürchten Menschen seit jeher alles, was anders ist als sie selbst.
Allein die Tatsache, dass mich noch niemand bei Tageslicht gesehen hat, reicht, um die Dorfbewohner misstrauisch werden zu lassen.
Ich gebe mir Mühe, freundlich zu sein, wenn ich des Nachts auf meinem Weg in den Wald anderen Menschen aus dem Dorf begegne. Meistens erhalte ich keine Antwort auf meinen Gruß und das Lächeln gefriert mir auf den Lippen, wenn sie das Zeichen gegen das Böse machen, während ich an ihnen vorbeilaufe. Ich gebe vor, das Getuschel nicht zu hören, wenn sie denken, ich sei weit genug entfernt, doch in Wahrheit schmerzt jedes gehässige Wort. Manchmal so sehr, dass ich am liebsten herumwirbeln und die Leute anschreien würde, dass es keinen Grund gibt, mich derart abwertend zu behandeln. Schließlich habe ich nie jemandem etwas getan. Dennoch beiße ich die Zähne zusammen und schlucke den Ärger und die Wut hinunter, so wie Vater es mich von klein auf gelehrt hat.
Es schmerzt mich, dass ich nur unfreundlich behandelt und gemieden werde. Dass ich keine Freunde habe. Dass ich immer allein bin.
Wütend schüttele ich den Kopf, um die aufkommende Schwermut zu vertreiben. Es hat keinen Sinn, in Selbstmitleid zu versinken, das weiß ich, aber es ist so schwierig, immer nur fröhlich zu sein.
Als Zweige hinter mir knacken, wirbele ich erschrocken herum und starre in den dunklen Wald. Eine massige, kohlschwarze Gestalt schält sich aus den Schatten und kommt direkt auf mich zu. Anstatt jedoch ängstlich zurückzuweichen, lächele ich meinem Vater zu.
Er nickt brummend, ehe er sich behäbig neben mir am Flussufer niederlässt. Aus goldenen Augen mustert er den Berg Dreckwäsche, doch ich zucke nur mit den Schultern. Wir beide wissen, dass ich diese mühevolle Aufgabe Mutter zu verdanken habe, aber ich beschwere mich nicht. Irgendetwas muss ich schließlich für unsere Familie tun und da es nicht viel gibt, was ich bei Nacht erledigen kann, kümmere ich mich eben um die Wäsche.
Ich liebe es, wenn Vater mich besucht und mir für ein paar Stunden Gesellschaft leistet. Er ist der Einzige in unserer Familie, der mich versteht.
Denn er ist so wie ich.
Ich lasse für einen Moment die Wäsche Wäsche sein, rutsche näher an ihn heran und kuschele mich in seinen warmen Pelz. Er riecht nach Wald und Erde. Ich liebe diesen Geruch. Vorsichtig legt er eine seiner großen Pranken um mich, immer darauf bedacht, mich nicht mit seinen Krallen zu verletzen.
»Schön, dass du da bist«, murmele ich, obwohl ich weiß, dass ein Gespräch unmöglich ist.
Vater gibt ein tiefes Brummen von sich, sodass meine Wange vibriert, mit der ich mich an seinen Pelz schmiege.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich meinen Vater je richtig umarmt habe, wenn er nicht in seiner tierischen Gestalt war. Wann ich Haut statt Fell unter den Fingern gespürt habe, wenn ich ihm nahe war.
In den dunklen Stunden der Nacht, in denen ich mit meinem Schicksal hadere, frage ich mich, womit gerade eine gute Seele wie mein Vater diesen Fluch verdient hat. Warum er ihn ausgerechnet an mich weitergegeben hat, schließlich habe ich noch elf weitere Geschwister. Aber keiner von ihnen ist wie wir. Sie sind normal, führen ein gewöhnliches Leben und werden nicht von den anderen Menschen verachtet und gemieden.
Doch ein Gutes hat der Fluch, den Vater und ich in uns tragen: Er schweißt uns zusammen. Keines meiner Geschwister hat ein solch gutes Verhältnis zu Vater wie ich, obwohl wir kaum Zeit miteinander verbringen können. Allein die Gewissheit, dass es jemanden gibt, der versteht, was ich durchmache, nimmt mir eine gewaltige Last von den Schultern. Ich wüsste nicht, was ich ohne Vaters Rückhalt tun sollte.
»Ich muss weitermachen«, sage ich und winde mich aus seiner Umarmung. Obwohl ich nichts lieber täte, als einfach hier mit ihm zu sitzen und auf den Fluss zu starren, weiß ich, dass ich fertig werden muss, sofern ich nicht Mutters Zorn riskieren will.
Vater brummt und erhebt sich. Sehnsüchtig sehe ich ihm nach, wie er in den Wald trottet und im Unterholz verschwindet. Schon nach wenigen Metern ist sein schwarzer Pelz nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden. Ich wünschte, ich könnte ihm nachgehen.
Mein Vater ist ein Bär. Nun ja, zumindest nachts. Durch einen uralten Fluch, der seit Menschengedenken auf unserer Familie lastet, ist mindestens einer je Generation dazu verdammt, sich nachts in ein Tier zu verwandeln.
Auf mir lastet zwar auch der Fluch, jedoch bin ich sogar anders in meiner Andersartigkeit. Denn ich bin der einzig bekannte Tagwandler. Sobald die Sonne aufgeht …
Ich schaue nach oben, um durch die Baumkronen den Stand des Mondes abzuschätzen. Ich muss mich sputen, damit die Wäsche rechtzeitig vor Sonnenaufgang fertig und zu Hause abgeliefert ist, ansonsten wird Mutter mir das Leben ein weiteres Mal zur Hölle machen.
Oft nennt sie mich faul und nutzlos, weil ich nicht wie die anderen auf dem Feld mithelfen oder die Kühe melken kann. Als ob ich mich freiwillig jeden verdammten Tag verwandeln würde! Ich gäbe alles dafür, normal zu sein und wie meine Schwestern lachend und mit bunten Bändern im Haar sorglos durchs Dorf laufen zu können. Immer begleitet von den anerkennenden Blicken der jungen Männer.
Doch ein solches Leben werde ich niemals führen können. Tagsüber bin ich unsichtbar und ich existiere nur bei Nacht.
Denn ich bin das Mondscheinmädchen.
***
Trotz halb erfrorener Finger und vom Knien gefühlloser Beine schaffe ich es rechtzeitig, die saubere Wäsche nach Hause zu bringen und schnell über die Wäscheleinen zu hängen, die vor unserer Hütte gespannt sind. Drinnen scheint noch alles ruhig zu sein und ich höre das laute Schnarchen meiner Mutter bis nach draußen. Auch meine Geschwister sind noch nicht auf den Beinen, denn aus dem Stall dringt das empörte Muhen unserer Milchkühe, die darauf warten, gemolken zu werden.
Über den Hügeln erkenne ich bereits den hellen Lichtstreifen, der einen weiteren Morgen ankündigt, daher mache ich mich sofort wieder auf den Weg in den Wald, nachdem ich das letzte Kleidungsstück aufgehängt habe.
Wie jeden Tag folge ich meinem geheimen Pfad zu einer kleinen Höhle in der Nähe des Flusses, wo ich auf meine Verwandlung warte. Hier lasse ich, genau wie Vater, meine Kleider zurück, um sie bei Nachtanbruch wieder anziehen zu können. Der Höhleneingang liegt versteckt hinter dichtem Gestrüpp, das ihn auch jetzt im Winter nahezu völlig verdeckt.
In der Vergangenheit wurden Vater und ich zwei Mal dabei beobachtet, wie wir uns verwandelten. Dass unsere Familie jedes Mal nahezu unverletzt vor den Dorfbewohnern und ihren Fackeln und Mistgabeln fliehen konnte, grenzt schon an ein Wunder.
Seit unserem dritten Umzug ist Mutters Laune am Boden. Eines Nachts hat sie sogar gedroht, sich von einer Klippe zu stürzen, wenn wir noch mal enttarnt werden, daher sind Vater und ich besonders vorsichtig; nicht nur wegen Mutters Drohung, sondern auch, weil wir meine elf Geschwister nicht schon wieder aus ihrer gewohnten Umgebung reißen wollen.
Ich krieche in die kleine Höhle, inhaliere den Geruch von Nässe, Moos und Erde, der für einen winzigen Moment meine Sorgen wegspült. Hier in unserem Versteck fühle ich mich sicherer und geborgener als in unserer Hütte. Zufrieden seufzend lehne ich mich gegen den kalten Stein und schaue nach draußen. Der Himmel ist bereits in ein helles Violett getaucht.
Es wird nicht mehr lange dauern.
Anfangs war die Verwandlung kaum auszuhalten. Schmerz ist kein Ausdruck dafür, wenn meine Knochen brechen und meine Muskeln zusammenschrumpfen, um sich der anderen Gestalt anzupassen, doch mit den Jahren ist es erträglicher geworden. Nicht weniger schmerzhaft, aber auszuhalten. Vielleicht ist es auch nur Gewohnheit.
Seit fast zwanzig Jahren werde ich bei jedem ersten Sonnenstrahl in diese Gestalt gezwungen. Ein anderes – normales – Leben ist für mich unvorstellbar. Nachts zu schlafen, wie es Menschen für gewöhnlich tun. An einem Tisch zu sitzen, um gemeinsam mit der Familie zu essen. Hübsch zurechtgemacht ins Dorf zu gehen, um zusammen mit den anderen um das prasselnde Feuer zu tanzen.
All das ist für mich undenkbar.
Und wenn ich mir Vater ansehe, wird es auch niemals anders sein. Er hat wenigstens das Glück, sich nur nachts zu verwandeln, was weniger Aufsehen erregt als mein Tagwandler-Dasein. Er hatte die Möglichkeit, sich eine Frau zu suchen und eine Familie zu gründen, auch wenn ich glaube, dass es zwischen meinen Eltern nie so was wie wahre Liebe gab oder je geben wird.
Ich verziehe bei dem Gedanken den Mund. Als ob ich Ahnung von Liebe hätte! Absoluter Quatsch! Ich habe noch nie einen Jungen umarmt oder gar geküsst. Wie sollte ich auch nachts jemanden kennenlernen? Am besten noch, während ich Mutters Aufgaben erledige, die mit jeder Nacht zuzunehmen scheinen.
Ich beiße die Zähne zusammen und starre in den Himmel, als könnte ich so die Sonne dazu bewegen, schneller aufzugehen. Ich muss mich ablenken, denn diese Gedanken tun mir nicht gut, schließlich kann ich nichts an meiner Situation ändern. Ich bin, wie ich bin, und damit muss ich leben.
Es hätte mich auch schlimmer treffen können. Als ich Vater einmal tagsüber besucht habe, hat er mir erzählt, dass sich eine Tante von ihm in einen Wurm verwandelt hätte. Das muss wirklich schrecklich gewesen sein. Gern hätte ich ihn mehr dazu gefragt, doch leider kann ich tagsüber nicht sprechen und er kann es nachts nicht.
Alles, was ich von einem Familienleben habe, ist Mutters verkniffenes Gesicht, das ich jeden Abend sehe, wenn sie monoton meine Aufgaben für die Nacht aufzählt, um dann wieder ins Bett zu verschwinden. Durch die geschlossenen Türen unserer Hütte höre ich das leise Schnarchen meiner Geschwister und beneide sie für alles, was ich nicht habe.
Endlich wird der Himmel heller und ich spüre das bekannte Kribbeln in meinem Körper, das die bevorstehende Verwandlung ankündigt. Gleich wird es sich in ein Zerren wandeln, meine Knochen werden sich verschieben und aus meiner Haut werden schwarze Federn sprießen. Jede einzelne spüre ich wie ein Schnitt ins Fleisch. Ich krümme mich, kralle die Hände in den kalten Stein, die sich jedoch im nächsten Augenblick in Flügel verwandeln.
Wenige Sekunden später erhebe ich mich mit einem spitzen Schrei in den Himmel, breite meine dunklen Schwingen aus und segle durch die frische Morgenluft.
Mondscheinmädchen nennen mich die Menschen, doch eigentlich ist das nicht richtig.
Denn ich bin das Falkenmädchen.
Kapitel 2
Miranda
Wie jeden Morgen brauche ich eine Weile, um mich an die geschärften Sinne zu gewöhnen, über die ich in meiner anderen Gestalt verfüge. Mit meinen goldenen Falkenaugen kann ich selbst aus zweihundert Meter Entfernung die Maus sehen, die gerade durch die Grashalme huscht.
Lautlos und schnell stoße ich mich auf meine Beute und schlage die spitzen Krallen tief in mein überraschtes Opfer, das ein letztes Quieken von sich gibt, ehe es sein unausweichliches Ende anerkennt und in meinen Fängen erschlafft. Mit meinem Frühstück lande ich auf einem Baum und lasse es mir schmecken.
Schon vor Jahren habe ich damit begonnen, meine Hauptmahlzeiten als Falke einzunehmen, um meine Familie nicht zusätzlich zu belasten. Nachts, als Mensch, esse ich so gut wie nie etwas und beinahe habe ich vergessen, wie richtiges Essen schmeckt. Mehr als Mäuse oder kleine Hasen kenne ich nicht mehr.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich mich als kleines Mädchen davor geekelt habe, etwas mit Fell zu essen, dessen Blut noch warm war, doch mittlerweile ist es für mich zur Normalität geworden. Zu einer Gewohnheit, die meinen Alltag bestimmt und die ich nicht ändern kann.
Dass ich die unverdaulichen Bestandteile meiner Mahlzeit, wie Fell und Knochen, wieder hochwürgen muss, finde ich immer noch eklig. Es ist widerlich, aber leider als Falke unvermeidbar.
Nachdem ich mich gestärkt habe, segele ich zu unserem Haus, das am Fuße einer hügeligen Landschaft steht. Mittlerweile wurden unsere Kühe nach draußen getrieben und suchen auf dem gefrorenen Boden nach Futter.
Ich lande in der großen Eiche, die direkt neben der vergleichsweise winzigen Hütte steht, in der unsere große Familie lebt, und lausche den alltäglichen Geräuschen, die zu mir heraufdringen. Ich höre meine kleinen Schwestern, die sich wegen einer Puppe streiten, und meine Mutter, wie sie meinem Vater Vorwürfe macht. Mal wieder.
Dann tritt sie aus der Hütte. Außer den langen blonden Haaren habe ich keinerlei Gemeinsamkeiten mit meiner Mutter. Sie ist groß und hager, um ihren Mund haben sich im Laufe der Jahre tiefe Falten gebildet, die ihr ein verkniffenes Aussehen verleihen. Nun ja, meistens ist sie auch verkniffen. Die vielen Schwangerschaften sind nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Von den sechzehn geborenen Kindern haben zwölf, mich eingeschlossen, überlebt. Meine jüngste Schwester ist im Herbst vier geworden.
Mutter stemmt die Hände in die ausladenden Hüften und lässt ihren Blick über den Hof und die Wäscheleinen schweifen, die ich in den Zwielichtstunden eilig bestückt habe. Missbilligend runzelt sie die Stirn. Manchmal verfluche ich es, dass ich selbst aus dieser Entfernung jede ihrer Gesichtsregungen sehen kann, denn ich weiß, dass sie mit etwas unzufrieden ist. So wie immer. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich kann es ihr nie recht machen. Trotzdem versuche ich es jeden Tag aufs Neue, weil ich nur ein Mal – ein einziges Mal! – ihr Lächeln sehen und ihr Lob hören will.
Doch das ist bisher nicht geschehen, in den ganzen zwanzig Jahren meines Lebens nicht. Ich bin anders und das lässt sie mich immer wieder spüren. Ich bin das ungeliebte Kind, mit dem sie nichts anfangen kann. Das mehr als einmal dafür gesorgt hat, dass die ganze Familie entwurzelt wurde.
Während meine älteren Brüder allesamt bereits verheiratet sind und teilweise schon selbst Familien gegründet haben, wird sie mich ewig erdulden müssen. Denn wer würde mich schon nehmen? Meine Schwestern kann sie wenigstens in vorteilhafte Ehen vermitteln. Stella, die ein Jahr jünger ist als ich, hat letztes Jahr den Schmied im Dorf geheiratet. Das ist eine höchst vorteilhafte Verbindung, auf die Mutter mächtig stolz ist. Ich habe die Hochzeit aus der Ferne verfolgt. Sie war wirklich schön und Stella wirkte glücklich, während mir das Herz schwer wurde. Nicht, weil ich meiner Schwester ihr Glück nicht gönne, sondern weil mir wieder vor Augen geführt wurde, was ich niemals würde haben können.
»Miranda!«, ruft meine Mutter. »Ich weiß, dass du da bist!«
Kurz überlege ich, ob ich zu ihr fliegen soll, lasse es aber. Die Gefahr, von einem der anderen Dorfbewohner entdeckt zu werden, ist zu groß. Also bleibe ich, wo ich bin, und lasse sie schimpfen.
Eigentlich sollten ihre Tiraden mittlerweile an mir abperlen wie Regen an meinem Gefieder, doch dem ist nicht so. Wie immer schneiden sich ihre Worte und ihr Schimpfen tief in mein Herz, das sich nach Anerkennung sehnt, und hinterlassen dort ihre Spuren, die ich niemals ganz verlieren werde. Nicht in diesem Leben. Nicht mit diesem Schicksal.
»Das nennst du saubere Wäsche? Ich sage dir eins, Fräulein, du wirst diese Wäsche heute Nacht noch mal waschen, und wehe, sie ist wieder so dreckig wie heute!«
Natürlich ist die Wäsche nicht sauber, aber wie soll das gehen in diesem schlammigen Fluss? Auch wenn ich meine Gestalt ändern kann, zaubern kann ich leider nicht. Schließlich stamme ich nicht aus dem Elfenvolk.
Mein Vater tritt aus der Hütte und legt Mutter von hinten beschwichtigend eine Hand auf die Schulter, die sie jedoch mit einer energischen Bewegung abschüttelt. »Ich bin sicher, das Mädchen hat sein Bestes getan. Du solltest nicht so streng mit ihr sein, Luise.«
Mutter gibt nur ein Schnauben von sich, ehe sie sich umdreht und mit dem Zeigefinger gegen Vaters Brust tippt. »Ich bin nicht streng! Sie muss endlich lernen, dass auch sie ihren Teil zu unserem täglichen Leben beitragen muss, und du darfst sie nicht jedes Mal in Schutz nehmen, nur weil sie ein Ungeheuer ist!«
Ich zucke zusammen. Sie hat zwar schon öfter auf diese Weise über mich gesprochen, aber es tut jedes Mal aufs Neue weh. Von der eigenen Mutter zu hören, dass ich in ihren Augen nichts weiter als ein Ungeheuer bin, ist etwas, woran ich mich nie gewöhnen werde, ganz gleich, wie viele endlose Jahre ich noch lebe.
»So wie ich, meinst du?«, fragt Vater betont ruhig, mustert sie jedoch aus zusammengekniffenen Augen.
Mutter wedelt genervt mit den Händen. »Wie auch immer. Sie muss damit aufhören, die Nächte zu vertrödeln und sich wer weiß wo rumzutreiben, und endlich damit anfangen, etwas für die Familie zu tun. Wir haben es schließlich nicht leichter mit euch beiden.« Mit diesen Worten dreht sie sich um und stapft über den Hof hinüber zum Stall.
Vater blickt ihr einen Moment kopfschüttelnd nach, dann geht er zu dem Baum, auf dem ich sitze, und lehnt sich mit dem Rücken gegen den breiten Stamm, ehe er sich auf den Boden niederlässt.
Ich spähe nach allen Seiten und als ich sicher bin, dass wir nicht beobachtet werden, flattere ich nach unten und lasse mich auf seiner Schulter nieder. Ohne ein Wort und ohne mich anzusehen, streicht er mir mit dem Zeigefinger über den gefiederten Kopf.
»Nimm es ihr nicht übel, Kleines. Sie kann uns eben nicht verstehen. Da sie selbst den Fluch nicht in sich trägt, weiß sie nicht, was wir durchmachen müssen.«
Als Antwort plustere ich das Gefieder auf. Ich habe mich schon oft gefragt, wie Vater es so lange mit einer Frau wie ihr aushält, die ständig nur meckert und schimpft. Ich hätte bereits vor Jahren die Flucht ergriffen.
Gern würde ich ihn danach fragen, aber das geht nicht. Also beschränke ich mich darauf, die wenige Zeit, die ich gemeinsam mit ihm habe, zu genießen, und bleibe einfach auf seiner Schulter sitzen, die Krallen in seinem zerschlissenen Hemd verhakt, damit ich nicht herunterfalle.
Sein sanftes Streicheln lässt mich schläfriger und schläfriger werden, bis ich mich dazu zwingen muss, die Augen offen zu halten. Da meine Nächte von nie versiegender Arbeit geprägt sind, schlafe ich tagsüber, nachdem ich etwas gegessen habe, doch heute kann ich bei meinem Vater sein und möchte keine Sekunde davon missen. Also halte ich mit aller Kraft die Augen offen, bis sie brennen.
Vater muss bemerkt haben, dass mir trotz der Anstrengungen mein Kopf immer wieder nach vorn gesackt ist. Er lächelt mir zu. »Schon in Ordnung, Kleines. Flieg und schlaf dich aus. Ich bin sicher, Mutter hat heute Nacht wieder etwas ganz Besonderes für dich zu tun.«
Bei der Art, wie er etwas ganz Besonderes betont, hätte ich ihm gern verschwörerisch zugelächelt. So stupse ich nur mit dem Schnabel gegen seine raue Wange und breite die Flügel aus, um wieder zurück in den Baum zu fliegen.
Vater steht auf, klopft sich den Schmutz von der Hose und hebt die Hand, ehe er ebenfalls Richtung Stall geht. Ich sehe ihm nach, bis er hinter dem Tor verschwunden ist, dann stecke ich meinen Kopf unter den rechten Flügel, um endlich zu schlafen.
***
Durch ein Geräusch, das ich nicht zuordnen kann, schrecke ich aus dem Schlaf hoch. Fast wäre ich vom Ast gefallen, kann aber im letzten Moment die Krallen fest in die morsche Rinde graben.
Verwirrt blinzele ich gegen die Helligkeit an. Die Sonne steht hoch am Himmel, allzu lange kann ich also nicht geschlafen haben. Ich fühle mich ausgezehrt und todmüde, trotzdem drehe ich neugierig den Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kam.
Über die Hügel, durch die ein schmaler Weg führt, rumpelt ein Karren, der von zwei schwerfälligen Ochsen gezogen wird. Nanu, heute ist doch gar nicht der Tag, an dem der fahrende Händler durchs Dorf fährt …
Normalerweise sind wir hier unter uns, so abgeschieden, wie dieser Ort liegt. Das ist einer der Gründe, warum Mutter dieses Dorf als neues Zuhause für uns ausgesucht hat – wenige Durchreisende und noch weniger, die dumme Fragen stellen oder uns zu genau beobachten könnten. Natürlich fällt es früher oder später trotzdem auf, wenn eine junge Tochter der Familie nie bei Tag zu sehen ist und der Familienvater nachts spurlos verschwindet, aber bisher sind wir vor allzu neugierigen Nachforschungen verschont geblieben.
Es dauert nicht lange, bis auch meine Eltern den Händlerkarren hören und aus dem Stall kommen. Mutter putzt sich die Hände an ihrer schmuddeligen Schürze ab und läuft zum Wegesrand, wo sie eine Hand über die Augen hält und gegen die Sonne blinzelt. Vater bleibt einen Meter hinter ihr stehen und strafft die Schultern.
»Den Göttern zum Gruß, gute Leute«, grüßt der Händler auf dem Kutschbock und greift sich mit zwei Fingern an den Hut. Meine Eltern nicken ihm zu und erwidern die Begrüßung.
Ich werfe einen Blick auf den Karren und lege den Kopf schief. Er ist leer. Was macht der Mann hier, wenn er nichts verkaufen will? Niemand kommt in dieses Dorf, wenn nicht um Handel zu treiben …
»Wo finde ich den Dorfvorstand?«, fragt er und Mutter weist ihm den Weg. »Habt Dank, Frau. Ich habe etwas Wichtiges zu verkünden. Kommt mit eurer Familie in zwei Stunden auf den Dorfplatz.« Er lässt die Peitsche knallen und die beiden Ochsen setzen gemächlich ihren Weg hinunter ins Dorf fort.
Mutter eilt ins Haus, streift noch beim Gehen die dreckige Schürze ab und lässt sie achtlos zu Boden fallen. Klar, sie muss sie ja auch nicht sauber waschen … Fast hätte ich einen empörten Schrei ausgestoßen, doch ich halte in letzter Sekunde inne.
»Kinder, zieht eure besten Kleider an! In einer Stunde will ich euch alle fertig draußen auf dem Hof sehen!«, höre ich ihren gedämpften Kommandoton aus der Hütte. »Und wehe, ihr vergesst wieder, den Dreck unter euren Fingernägeln wegzuschrubben!«
Kopfschüttelnd folgt Vater ihr ins Haus, nicht ohne mir einen entschuldigenden Blick zuzuwerfen.
Mein schnell schlagendes Falkenherz zieht sich schmerzvoll zusammen. Wie gern wäre ich jetzt auch da drinnen und würde mir mein schönstes Festtagskleid anziehen und das hüftlange blonde Haar kunstvoll hochstecken! Stattdessen hocke ich versteckt auf dem Baum und kann nichts weiter tun, als mein kohlschwarzes Gefieder aufzuplustern.
Durch mein scharfes Gehör kann ich jedes einzelne Wort aus der Hütte verstehen, als würde der Sprecher direkt neben mir sitzen. Meine Schwestern streiten sich um eine Haarspange, während meine Brüder sich nur widerwillig Hände und Füße waschen und sich in zu enge Hemden zwängen, die ihnen vor zwei oder drei Jahren richtig gepasst haben.
Obwohl die Stimmung alles andere als gelöst ist, sehne ich mich danach, ein Teil davon zu sein. Ich will mit meinen Schwestern um die schönste Haarspange rangeln und meinen Brüdern dabei helfen, die obersten Hemdknöpfe zu schließen.
Alle sind pünktlich fertig und gemeinsam macht sich meine Familie auf den Weg ins Dorf. Ich fehle natürlich, aber bis auf meinen Vater scheint das niemanden zu stören. Ich glaube sogar, dass einige meiner Geschwister gar nicht mehr wissen, dass es mich gibt. Dass ich lebe und nahezu jeden Handel eingehen würde, um ein Teil dieser Familie sein zu dürfen, die mich hasst oder vergessen hat. Niemand fragt: »Wo ist Miranda?«, sondern alle lächeln und laufen gut gelaunt hinab ins Dorf.
Als ich sicher bin, dass sich niemand von ihnen umdrehen wird, breite ich die Schwingen aus und fliege ihnen nach.
***
Ich lande auf einem Dach direkt am Dorfplatz und versuche mich zwischen den versammelten Raben zu verbergen, die jedoch schnell von mir abrücken. Als hätte jemand einen Stein zwischen sie geworfen, stieben die Vögel auseinander, ehe ich mich ihnen nähern kann.
Zum Glück schaut niemand zum Dach empor. Dicht an dicht drängen sich die Menschen auf dem Dorfplatz, sind blind und taub für alles, was außerhalb davon geschieht, und reden lautstark miteinander. Die Frage, weshalb alle Dorfbewohner hier zusammenkommen sollten, ist die häufigste, die ich im Stimmengewirr aufschnappe.
Ein paar Tauben hüpfen näher zu mir und versuchen mit den Schnäbeln nach mir zu hacken. Wie ich diese Mistviecher hasse … Ich gebe ein lautes Krächzen von mir und breite die schwarzen Schwingen aus, um sie zu vertreiben.
Vater sieht nach oben und lächelt, als er mich auf dem Dachfirst sitzen sieht, wendet sich dann aber schnell wieder Mutter zu, damit sie nicht ebenfalls auf mich aufmerksam wird. Ich bin sicher, dass sie nicht erfreut wäre, das Ungeheuer, das dummerweise ihre Tochter ist, hier zu sehen. Natürlich würde niemand den schwarzen Falken auf dem Dach sofort mit dem Mondscheinmädchen in Verbindung bringen, aber laut Mutter könnte jeder uns enttarnen und dann müssten wir wieder fliehen.
Gerade als die Laune der Menge zu kippen droht, weil sich jeder in Rage redet und keiner Antworten auf die in der Luft schwebenden Fragen hat, erklimmt der Dorfvorstand, ein dicklicher kleiner Mann mit Glatze, den Rand des Brunnens, um wenigstens halbwegs von allen gesehen zu werden. Mit erhobenen Händen bittet er um Ruhe, doch das Gemurmel um ihn herum erstirbt nur langsam. Zu aufgeregt sind die Menschen ob dieser Situation, die sie aus ihrem tristen Alltag reißt. Nahezu alles in diesem verschlafenen Dorf ist eine Sensation, wodurch die Menschen immer ein wenig empfindlich reagieren, wenn sich ein mögliches aufsehenerregendes Ereignis als nichts als Schall und Rauch entpuppt.
»Meine guten Leute, bitte, hört mir zu!« Das eher dünne Stimmchen des Dorfvorstands dringt nicht bis zu den letzten Reihen und ich höre, wie die Leute weiter hinten lautstark ihre Vordermänner fragen, was gerade gesagt wurde, wodurch erneut Unruhe entsteht. »Die Götter haben unser Dorf gesegnet!«
Augenblicklich herrscht eine solche Ruhe, dass man sogar eine meiner Federn auf den Boden fallen hören könnte. Sobald die Götter zur Sprache gebracht werden, sind die Menschen Feuer und Flamme. Ich habe mich schon immer gefragt, warum das so ist. Wo sind denn diese Götter, wenn die Ernte wieder einmal ausfällt? Wo sind sie, wenn erneut, wie fast jedes Jahr, ein Fieber oder eine Seuche grassiert?
Die Götter … Pah! Diese selbstverliebten, rücksichtslosen … Idioten haben mir mein Schicksal erst eingebrockt! Wären sie nicht gewesen, müssten mein Vater und ich uns nicht täglich in diese unnatürliche Gestalt zwängen … Wir müssten keine Ungeheuer sein. Ich verabscheue sie aus tiefstem Herzen.
»Der König …« Der Dorfvorsteher räuspert sich, weil seine Stimme sich vor Aufregung fast überschlägt. »Der König hat seine engsten Vertrauten und besten Jäger ausgesandt, die bald in unserem beschaulichen Dorf eintreffen und sogar die Nacht hier verbringen werden!«
Jubel heischend blickt er sich um, doch die Dorfbewohner starren ihn nur mit offenen Mündern an. Es scheint, als würden sie ihm kein einziges Wort glauben, und die in der Luft liegende Spannung ist sogar bis zu mir aufs Dach spürbar.
»Sie kommen hierher? Zu uns?«, fragt eine ältere Frau, als müsse sie sichergehen, dass sie sich nicht verhört hat. »In unser kleines Dorf am Rande des Königreichs? In unser Dorf mitten im Nirgendwo?«
»So ist es, gute Leute! Und das schon morgen! Wir haben noch viel vorzubereiten. Ist das nicht wundervoll? Die königliche Familie hat uns nicht vergessen und ihre engsten Vertrauten beehren uns mit ihrer Anwesenheit!«
Einen Moment ist es wieder ganz still, als wage keiner zu atmen. Dann bricht die Menge in Jubel aus. Ich zucke wegen des plötzlichen Lärms zusammen.
Der Mann, den ich für einen fahrenden Händler gehalten habe, tritt neben den Dorfvorsteher und nickt bekräftigend. Was hat der denn mit dieser Verkündung zu tun? Ich hüpfe näher an den Rand des Daches und schaue mir den Mann genauer an. Jetzt fällt mir der Bogen auf, den er um seine Schulter gehängt hat, und es fühlt sich an, als würde mich eine eiskalte Hand packen und zudrücken. Das ist kein Händler: Dieser Mann ist ein Jäger, wahrscheinlich einer der Treiber, denn ich bezweifele, dass er sich mit seiner massigen Statur lautlos an seine Beute heranschleichen könnte.
Des Königs Gefolge will hier jagen! Es geht ihnen nicht darum, diesem winzigen Dorf, dessen Namen sie vermutlich nicht einmal kennen, einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. Wenn sie tatsächlich bis zu uns reisen, muss es sich um eine besondere Beute handeln.
Das Blut rauscht mir eiskalt durch die Adern, als ich hektisch versuche Vater in der Menge auszumachen. Seine Miene wirkt angespannt und er ist der Einzige, der nicht in den Jubel der Menge einfällt. Offenbar ist er zum gleichen Schluss gekommen wie ich.
»Ich habe erst vor Kurzem einen riesigen schwarzen Bären gesehen! Ganz in der Nähe des Flusses!«, berichtet einer der Bauern.
Vaters Gesichtsfarbe wird aschfahl. Andere Leute stimmen dem Bauern zu und berichten von ihren Begegnungen mit dem schwarzen Tier. Bei jeder Erwähnung zieht Vater immer weiter den Kopf zwischen die Schultern, doch er scheint die Worte der anderen nicht ausblenden zu können.
Bären sind ungewöhnlich in diesem Teil des Landes und es ist unvermeidlich, hin und wieder einem Menschen zu begegnen – selbst bei Nacht. Vermutlich hätten sich die Bauern nicht an dem schwarzen Bären gestört, der nie eine Gefahr für jemanden darstellte. Doch nun, da die königliche Jagdgesellschaft auf dem Weg hierher ist, erinnern sie sich wieder an das außergewöhnliche Tier.
Anstatt Vater zu stützen oder ihm gut zuzureden, reiht sich Mutter mitsamt meinen Geschwistern in die Jubelnden ein. Sie feiern die Königsfamilie, die seit Beginn der Aufzeichnungen noch nie einen Fuß in dieses schäbige Dorf gesetzt hat, und sind im Freudentaumel, ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, warum die Königsfamilie unser Dorf besucht. Mutter wird nur die Vorteile sehen, die sie daraus schlagen kann. Wer weiß, vielleicht fällt der Blick eines der Königsdiener auf eine meiner unverheirateten Schwestern.
Jetzt erklimmt der Jäger den Brunnenrand und schubst unseren Dorfvorstand beinahe unsanft hinunter. Der alte Mann kann sich gerade noch fangen, ehe er auf den Pflastersteinen aufschlägt, doch das scheint niemanden zu kümmern. Alle starren wie gebannt auf den Jäger, der das Wort ergreift.
»Ihr guten Leute, es ist wahr! Schon morgen bei Tagesanbruch wird das Gefolge des Königs euer Dorf mit seiner Anwesenheit beehren!« Erneut bricht Jubel los, einzelne Hüte fliegen hoch in die Luft. »Sie haben mich vorgeschickt, um euch diese frohe Kunde zu überbringen. Und ja, die findigen Jäger des Königs haben von eurem schwarzen Bären gehört und reden von kaum etwas anderem mehr als von der bevorstehenden Jagd! Wir werden euch von dieser Bestie erlösen. Ihr müsst keine Angst mehr um eure Kinder haben! Bisher ist ihnen noch kein wildes Tier entkommen. Sie werden dafür sorgen, dass ihr alle wieder in Ruhe und in Frieden leben könnt!«
Vater wird angerempelt und stürzt fast. Gelähmt vor Panik steht er inmitten der tosenden Menge, ohne jemanden, der ihm Halt gibt. Einsam und verlassen. Wie gern würde ich ihn in die Arme schließen und ihm sagen, dass alles gut wird, doch das ist unmöglich. Er muss sofort hier weg, für mehrere Tage tief im Wald verschwinden und sich verstecken. Warum hilft ihm keiner aus unserer Familie? Sie müssen doch bemerken, dass der schwarze Bär, der als neuer Bettvorleger des Königs enden soll, der eigene Mann oder Vater ist, doch keiner von ihnen scheint einen Gedanken daran zu verschwenden.
»Ihr guten Leute«, versucht sich der Jäger wieder Gehör zu verschaffen. »Ich bitte euch, geht in den nächsten Tagen nicht in den Wald. Ich werde noch heute damit beginnen, Bärenfallen aufzustellen. Es wäre schrecklich, würde einer von euch braven Bürgern in solch eine Falle hineintreten.« Zustimmendes Gemurmel ertönt. »Da euer Gasthaus zu klein für die Jagdgesellschaft und die mitreisenden Höflinge ist, möchte ich euch bitten, sie für einige Zeit bei euch aufzunehmen. Würde es euch nicht gefallen, einen Adligen unter euren Dächern willkommen zu heißen?«
Bei seinen Worten dreht sich mir der Magen um und beinahe würge ich das Gewölle von der Maus heute Morgen wieder hoch. Die Menge jauchzt vor Freude. Fassungslos sperre ich den Schnabel auf. Bei einigen war ich mir bereits sicher, aber dass sie alle so dumm sind wie ein Stück der Äcker, die sie bebauen, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Merken sie nicht, dass das Gefolge des Königs nur möglichst kostenlos untergebracht werden soll und sie dafür nicht einmal ein Danke erhalten werden? Sie werden sich ausnehmen lassen, ihre eisernen Reserven an die Männer des Königs verfüttern, um dann im tiefsten Winter wieder bei meiner Familie Getreide zu schnorren. Es wäre nicht das erste Mal, dass Vaters Gutgläubigkeit anderen gegenüber ausgenutzt wird. Meistens gibt er sich freundlich, um von all den Merkwürdigkeiten abzulenken, die es in unserer Familie gibt.
Aber was denke ich da? Das ist unwichtig! Viel wichtiger ist, was mit Vater geschieht. Ich suche die Menge nach ihm ab, was bei all den Menschen, die freudig die Arme in die Luft recken, gar nicht so einfach ist. Schließlich streift mich Vaters gehetzter Blick, bevor er sich allein einen Weg durch die frohlockende Menge bahnt. Mehr brauche ich nicht zu sehen, um zu wissen, wohin er gehen wird, und lasse mich vom Wind fern des Dorfplatzes tragen. Ich bin erleichtert, als die freudigen Stimmen leiser und leiser werden und ich nicht mehr inmitten dieses Irrsinns sein muss.
Kapitel 3
Miranda
Ich warte vor der Höhle, in der ich mich jeden Morgen verwandele. Nach dieser Ansprache wird Vater nicht direkt nach Hause gehen und sicherlich erst einmal Zeit zum Nachdenken brauchen. Und die wird er nur hier finden, in unserem Versteck.
Ich werde nicht enttäuscht: Etwa eine halbe Stunde nach mir bahnt Vater sich keuchend einen Weg durchs Gestrüpp, das den Weg zur Höhle verdeckt. Es wird Abend und der Himmel ist bereits in ein helles Orange getaucht.
Schwer atmend kriecht er hinein und lehnt sich gegen die kühle Höhlenwand. Ich löse meine Krallen vom Ast, auf dem ich gewartet habe, segle hinab und durch das Gestrüpp hindurch, um auf seiner Schulter zu landen, von wo aus ich sein Gesicht mit schief gelegtem Kopf mustere. Er kommt mir vor, als sei er in der kurzen Zeit um Jahrzehnte gealtert, als ich ihm sanft mit dem Schnabel über den Dreitagebart fahre. Er lächelt und mir wird das Herz schwer, als ich sehe, dass es nur aufgesetzt ist. Vater lächelt nie so. Auch wenn mein Tag endlos und meine Nacht durch Mutters Aufgaben noch viel schlimmer waren, konnte ich mich immer auf Vaters aufmunternde Worte und die schönen, wenn auch kurzen Momente mit ihm verlassen.
Nicht auszudenken, was aus mir werden würde, wenn ihm wirklich etwas zustoßen sollte! Er muss sich nur für ein paar Tage verstecken, bis die königlichen Jäger die Lust verlieren, einem Hirngespinst hinterherzujagen. Dann ist alles überstanden und es wird wieder so sein wie zuvor. Mehr braucht es nicht. Sie müssen nur glauben, dass der schwarze Bär ein Mythos ist, dann werden sie wieder abziehen und meinen Vater in Ruhe lassen.
Nachdem er wieder zu Atem gekommen ist, legt Vater ein Bündel auf seinen Schoß. Bisher habe ich dem hastig gepackten Sack keine Beachtung geschenkt. Sicherlich sind es ein paar Kleidungsstücke zum Wechseln und Verpflegung für die nächsten Tage, doch nichts von alldem holt Vater daraus hervor. Der Gegenstand, der nun auf seinem Schoß liegt, ist groß, eckig, braun und alt.
Ein Buch? Seit wann besitzen wir ein Buch? Wir sind arme Bauern, niemand von uns kann lesen und schreiben, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Wir brauchen keine Bücher.
Ich tänzele unruhig von einem Bein aufs andere.
Mit einem Finger krault Vater mich unterm Schnabel, während er mit der anderen Hand das schwere Buch aufschlägt. Es ist alt, zerfleddert, einige Seiten liegen lose darin und das Pergament ist an Rändern und Ecken vergilbt.
Fast ehrfürchtig streicht er über die Zeilen, als er darin liest. Für mich ist es nur eine Aneinanderreihung von Schriftzeichen, die keinerlei Sinn ergeben.
»Weißt du, was das ist, mein Mädchen?«, fragt er. Seine Stimme klingt kratzig, als hätte er tagelang nicht gesprochen. Oder sehr lange geschrien. Ich tippe auf Letzteres. Mutter wird ihn nicht ohne Weiteres gehen gelassen haben … Sofern sie mit den anderen überhaupt schon vom Marktplatz zurück ist. Andererseits würde es mich nicht wundern, wenn sie noch immer mit den anderen Trotteln über die bevorstehende Ankunft des Königs jubelt und dabei völlig vergessen hat, dass der schwarze Bär ihr eigener Ehemann ist.
Mein Blick fällt wieder auf das Buch. Ich schüttele meinen Falkenkopf und Vater fährt fort: »Dieses Buch ist ein großer Schatz, Miranda. Es ist sehr, sehr wichtig für uns. In ihm steht alles über die anderen, die so waren wie wir, und darüber, was wir tun können, um unseren Fluch zu brechen.«
Augenblicklich ruckt mein Kopf in die Höhe. Man kann den Fluch brechen? Sofort bin ich Feuer und Flamme und kann gar nicht erwarten, dass Vater noch mehr darüber erzählt. Es ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass wir nicht bis an unser Lebensende damit gestraft sind, uns in Tiere zu verwandeln. Eine dumme, kleine Hoffnung nistet sich in meinem Herzen ein, dass ich irgendwann und irgendwie diesem Vogelkörper entkommen und eine ganz normale Frau sein kann.
»Jeder unserer Vorfahren, der ebenfalls den Fluch in sich trug, ist in diesem Buch verewigt.« Er blättert vorsichtig durch die Seiten, bis er fast in der Mitte des Buches angekommen ist. Mit jeder umgeblätterten Seite werde ich unruhiger. Ja, ganz toll, dass da viel über Leute drinsteht, die schon lange tot sind. Wie geht das denn nun mit dem Brechen des Fluches?
In der Mitte des Buches hält Vater endlich mit dem Blättern inne. Ich halte den Kopf schräg und betrachte das Blatt vor ihm. Es ist neuer als die anderen, fast noch weiß und nicht so vergilbt. Eine Menge Buchstaben stehen in krakeliger Schrift darauf. Am Rand sind zwei Zeichnungen. Sofort erkenne ich Vater auf der oberen, darunter ist das Bild eines Bären. Ich schaue auf die gegenüberliegende Seite und sehe das Bild eines jungen Mädchens – das muss ich sein – und darunter das eines Vogels, der mit ausgebreiteten Schwingen hoch am Himmel segelt.
»Ich habe das Buch viele Male gelesen, besonders nachdem du geboren wurdest und dich am Tage gewandelt hast. Bei keinem unserer Vorfahren ist das passiert.« Beinahe liebevoll streicht er mit dem Finger über die Zeichnung von mir.
Ich bin anders, das weiß ich schon seit meinem fünften Geburtstag, als ich mich zum ersten Mal in einen Falken verwandelt habe. Schreiend, krächzend und vor Panik zitternd lag ich in meinem Bett. Beinahe hätte Mutter mich mit einer Pfanne erschlagen, weil sie dachte, ich wäre gefährlich und würde ihre Kinder angreifen. Nur Vater hat erkannt, wer in dem kohlschwarzen Federkleid steckte.
Er gibt ein glucksendes Lachen von sich und tippt mir mit dem Zeigefinger auf den Kopf. »Ich sehe schon, ich hätte dir nicht erzählen dürfen, dass der Fluch gebrochen werden kann. Mach dir keine Hoffnungen, Kleines.«
Ich gebe ein frustriertes Krächzen von mir und schlage ein paar Mal mit den Flügeln. Keine Hoffnungen machen? Ich habe schon seit meinem fünften Lebensjahr keine Hoffnung mehr auf ein normales Leben. Ich kenne es nicht anders, aber jedes Mal, wenn ich die glücklichen Gesichter meiner Schwestern sehe, wenn sie abends hinunter ins Dorf zum Tanzen gehen, ist es, als würde die Welt über mir zusammenbrechen. Wenn es nur eine winzig kleine Hoffnung gäbe, um mein Schicksal zu ändern, würde ich sie sofort ergreifen, egal, was es mich kostete.
Nun von Vater zu hören, dass es eine Möglichkeit gibt, den Fluch zu brechen, lässt die winzige Hoffnung, die ich für so viele Jahre in meinem Herzen weggesperrt habe, wieder ausbrechen. Leise und zart flattert sie in meiner Brust wie die Flügel eines Schmetterlings, aber auch ebenso zerbrechlich.
Ich hänge an Vaters Lippen, bete stumm darum, dass er weitersprechen und diese Hoffnung in mir zu etwas Größerem verwandeln möge.
»Hier drin steht zwar, wie man die Verwandlung aufhalten kann, aber ich selbst habe es nicht geschafft, obwohl ich schon sehr lange auf dieser Welt bin.«
Er schaut vom Buch auf und fixiert einen Punkt an der gegenüberliegenden Felswand, als würde nur er sehen, was dort ist.
»Deine Mutter ist nicht meine erste Frau und ihr seid nicht meine ersten Kinder.«
Dieser Satz trifft mich unvorbereitet und ich brauche eine Weile, um ihn zu verarbeiten. Hat er noch eine heimliche Familie im Nachbardorf?
»Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin schon viele Menschenleben auf dieser Erde. Irgendwann habe ich den Überblick über meine Zeit hier verloren, aber ich schätze, ich bin um die hundertfünfzig Jahre alt. Irgendwann habe ich einfach aufgehört zu zählen.«
Moment, was? Ich hüpfe von seiner Schulter und lande auf seinen angewinkelten Knien. Mit meinen scharfen Falkenaugen mustere ich sein Gesicht. Ja, er sieht etwas mitgenommen aus und die Bartstoppeln sind auch nicht schmeichelhaft, aber hundertfünfzig Jahre? Ich kann nicht eine einzige Falte erkennen, ganz anders als in Mutters Gesicht, das mit tiefen Furchen durchzogen ist.
»Genau wie du habe ich mich in der Nacht meines fünften Geburtstages zum ersten Mal verwandelt. Meine Tante trug den Fluch ebenfalls in sich.«
Er blättert einige Seiten nach vorn und deutet auf eine vergilbte Seite. Die Bilder zeigen eine hochgewachsene Frau mit langen Haaren, darunter ist eine Maus zu sehen. Sofort dreht sich mir der Magen um. Ich fresse Mäuse in meiner Falkengestalt. Habe ich etwa meine Großtante verspeist?
»Sie starb kurz nach meinem fünfzigsten Lebensjahr.«
Puh, das ist zum Glück schon etwas her.
»Dieses Buch wird in unserer Blutlinie an diejenigen weitergereicht, die so sind wie wir. Unser ganzes Wissen steht darin geschrieben. Ich gebe es nun an dich weiter, mein Kind. Von all meinen Nachkommen bist du die Einzige, die so ist wie ich. Einerseits bin ich erleichtert, dass nicht noch mehr meiner Kinder mit diesem Fluch geschlagen sind, andererseits ist es schön, jemanden zu haben, der genauso ist wie ich selbst, auch wenn es mir für das, was du durchmachen musst, leidtut. Aber du weißt, dass ich immer für dich da sein und dich beschützen werde, mein Mädchen.«
Wie gern würde ich ihm sagen, dass ich genauso empfinde wie er, aber kein Wort kann meinen Schnabel verlassen, also stupse ich ihn mit selbigem am Knie an. Er blättert unterdessen zurück an den Anfang des Buches, immer darauf bedacht, die geschundenen und vom Alter gezeichneten Seiten nicht noch weiter zu zerstören.
»Hier steht es.« Er deutet mit dem Finger auf einen Absatz. »Hier wird erklärt, wie man den Fluch brechen kann.«
Ich warte darauf, dass er weiterspricht, weil ich in den aneinandergereihten Buchstaben keinerlei Sinn erkennen kann, doch er schaut nur mit gerunzelter Stirn auf das Buch hinab. Ich will, dass er den Mund öffnet und mir erklärt, was ich tun muss, um endlich normal sein zu können. Die Sekunden wandeln sich in Minuten, ohne dass ein einziges Wort über seine Lippen kommt.
Als ich es nicht mehr aushalte, klopfe ich mit dem Schnabel an den braunen Bucheinband. Vater blinzelt mehrmals und schaut mich an, als hätte er vollkommen vergessen, dass ich auch hier bin. Eine tiefe Traurigkeit liegt in seinem Blick, als hätte er sich an etwas erinnert, was nur für ihn bestimmt war und das er niemals wiedererlangen kann.
Mit einem entschuldigenden Lächeln streicht er mir über den Kopf und ich schließe genüsslich die Augen. »Ich habe diese Zeilen so oft gelesen und doch verstehe ich nach all den Jahren immer noch nicht ihren Sinn«, sagt er und schaut wieder ins Buch. »Hier steht, dass der Fluch gebrochen wird, wenn das Kind des Mondes seinen Gefährten findet.« Vater zuckt mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll.«
Mein Mut sinkt bei seinen Worten. Wenn das alles ist, was in diesem alten Fetzen steht, wurde die kleine Hoffnung, die sich in meinem Herzen festgesetzt hat, mit einem Mal zerstört. Selbst Vater hat in all seiner Zeit nicht herausgefunden, was das bedeuten soll, also brauche ich nicht zu hoffen, je die Mittagssonne als Mensch auf der Haut zu spüren.
Traurig lasse ich die Flügel hängen. Ich weiß, dass es müßig ist, die Frage, womit ich dieses Schicksal verdient habe, immer wieder zu stellen und mich damit zu grämen, aber ich kann nichts dagegen tun. Diese Ungerechtigkeit und die ohnmächtige Wut über mein Dasein nehmen mir beinahe die Luft zum Atmen.
Es ist dunkel geworden. Vater streckt sich und ich hüpfe von seinen Knien. Das traurige Lächeln, das er mir zuwirft, lässt mich für einen Moment meinen eigenen Schmerz vergessen. Ich bin nicht allein. Er ist wie ich. Er versteht mich und steht zu mir. Vielleicht ist mein Leben doch nicht so schlimm. Solange ich ihn habe, kann ich es ertragen, egal, wie lange es dauern mag.
Vater tritt aus der Höhle und dreht sich noch einmal zu mir um. »Ich sehe dich morgen früh, mein Mädchen. Sag deiner Mutter, dass es mir gut geht und ich wieder nach Hause komme, sobald die Jäger weg sind.« Er schiebt die Sträucher aus dem Weg und geht in den Wald hinein.
Schon nach wenigen Metern wird er von der zwielichtigen Dunkelheit verschluckt und ich spüre das Zerren an meinen Knochen und Muskeln, das die bevorstehende Verwandlung ankündigt. Nach einigen schmerzvollen Sekunden, die sich wie eine kleine Ewigkeit anfühlen, bin ich wieder ein Mensch und schlüpfe in meine Kleidung, die in der Höhle liegt. Meine Bewegungen sind steif, da sich meine Muskeln und Knochen noch nicht gänzlich meinem menschlichen Körper angepasst haben, und Schweiß steht mir vor Anstrengung auf der Stirn. Doch wie jeden Morgen ertrage ich mein Los, ohne zu klagen.
Nur meine Gedanken kann ich nicht abstellen, ebenso wenig wie meine Gefühle. Wo ich normalerweise in meinem Innersten über die Ungerechtigkeit meines Lebens schreie, wird die stumme Wut nun von der Sorge um Vater überlagert.
Nachdem ich mir die blonden Haare zu einem Zopf geflochten habe, mache ich mich auf den Weg zurück zur Hütte. Bei jedem Schritt denke ich an Vater und bete sogar zu den Göttern, die ich so sehr verabscheue, dass sie ihn beschützen mögen.
***
Fröstelnd ziehe ich meinen löchrigen Umhang enger um die Schultern. Es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen der erste Schnee in diesem Jahr fällt. Ich muss unbedingt daran denken, Feuerholz zu sammeln, damit wir es einige Tage und Nächte in der Höhle aushalten können, bis die königliche Jagdgesellschaft die Lust an der Bärenhatz verliert.
Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, in der Höhle Feuer zu machen – einerseits wegen des Rauches, andererseits könnten die Jäger dadurch auf unser Versteck aufmerksam werden –, aber ich will nicht riskieren, dass Vater oder ich uns in der Kälte den Tod holen. Vielleicht haben wir Glück und der Schnee lässt noch etwas länger auf sich warten.
Noch bevor ich einen Fuß auf unseren Hof setze, höre ich Mutters Gekeife aus der Hütte und verdrehe seufzend die Augen. Worüber regt sie sich denn jetzt schon wieder auf? Ich verharre einen Moment, weil meine Füße sich weigern, näher an die Hütte zu treten, aus Angst, dass dann Mutters Wut auf mich übergreift – wie meistens.
Knarrend öffnet sich die Tür der Hütte und meine Schwester Beatrix rennt mit tränenüberströmtem Gesicht auf mich zu. Beinahe wäre sie in mich hineingelaufen, weil sie zu sehr damit beschäftigt ist, hektisch über ihre Augen zu wischen. Sie stolpert und ich strecke schnell den Arm nach ihr aus, ehe sie tatsächlich fällt.
»Was ist los?«, frage ich und umfasse ihre Schultern.
Beatrix ist zwei Jahre jünger als ich, sieht mir jedoch überhaupt nicht ähnlich. Niemand würde uns für Schwestern halten. Während ich die blonden Haare unserer Mutter geerbt habe, hat Beatrix glattes braunes Haar wie Vater, aber die hochgewachsene Statur unserer Mutter. So zierlich, wie ich bin, reiche ich ihr gerade einmal bis zum Kinn.
Rote Flecken ziehen sich über ihre Wangen, die Nase und bis hinunter zum Hals. Ihr Körper wird von Schluchzern geschüttelt. Ich merke, dass ich so keinen zusammenhängenden Satz aus ihr herausbekomme, und führe sie zurück ins Haus. Nichts ist so schlimm, dass ich sie dafür hier draußen erfrieren lassen werde. Ich bin einiges gewohnt, aber meine Geschwister sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Wie ich Mutter kenne, wird sie mich genügend Aufgaben »an frischer Luft« verrichten lassen, weshalb ich mich zunächst aufwärmen sollte.
Beatrix stolpert eher neben mir her, als dass sie geht, und lässt sich nur widerwillig zurück durch die Tür führen. Drinnen wartet Mutter mit verschränkten Armen und streitlustig gerecktem Kinn auf uns. Aus zusammengekniffenen Augen beobachtet sie, wie ich Beatrix auf einen Stuhl nah am Feuer setze und ihr über den Rücken streiche, ehe ich meinen Umhang über die Lehne eines anderen Stuhls hänge und mich anschließend Mutter zuwende.
»Bist du auch endlich mal da.« Keine Frage, sondern ein Vorwurf, wie immer. Ich nicke nur als Antwort. »Ich dachte schon, du drückst dich vor deinen täglichen Pflichten, weil du dich für etwas Besseres hältst.«
Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht zu einer passenden Erwiderung anzusetzen. Es ist mir schleierhaft, wie sie darauf kommt, dass ich mich für etwas Besseres halten würde. Spürt sie denn nicht, wie ich darunter leide, anders zu sein, und dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als eine ganz normale junge Frau zu sein?
»Und du!« Nun richtet sich ihr Zorn auf Beatrix, die zusammenzuckt und den Blick ängstlich zu Boden richtet. »Du hörst endlich auf zu flennen! Das ist nicht der Untergang der Welt.«
Meine Schwester bricht in noch herzzerreißenderes Schluchzen aus und ich widerstehe nur knapp dem Drang, zu ihr zu gehen und sie in die Arme zu schließen. Etwas, das eigentlich eine liebende Mutter tun sollte, doch darauf kann ich bei der unseren wohl lange warten.
Mutter rauft sich das Haar, das mittlerweile mit etlichen grauen Strähnen durchzogen ist. »Ich sagte, hör auf damit! Was sollen sie denn denken, wenn du ihnen mit verquollenen Augen gegenübertrittst? Und sieh zu, dass du dich ein bisschen zurechtmachst! Sie werden bald da sein.«
»Wer wird da sein?«, frage ich verwirrt und Mutter scheint mich erst jetzt wieder wahrzunehmen.
»Das Gefolge des Königs natürlich. Ein paar von ihnen werden bei uns in der Scheune schlafen«, erklärt sie, wobei sie siegesgewiss den Kopf hebt.
Ein ungutes Gefühl beschleicht mich, als ich zwischen den beiden Frauen hin und her blicke. »Was hat das mit Beatrix zu tun?«
Das Schluchzen meiner Schwester ist mittlerweile ohrenbetäubend. Mit zwei Schritten ist Mutter bei ihr, packt sie und verpasst ihr eine schallende Ohrfeige. Völlig aufgelöst hält Beatrix sich die Wange, verstummt aber.
»Ab nach draußen! Wasch dich am Brunnen und wage es ja nicht, mir so unordentlich wieder unter die Augen zu treten!«
Es dauert einen Moment, dann setzt Beatrix einen Fuß vor den anderen und verlässt die Hütte. Nun bin ich mit Mutter allein und das einzige Geräusch im Raum ist das Knistern des Kamins.
»Vater geht es gut«, sage ich nach einer Weile, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll.
Ich warte auf die Aufzählung meiner nächtlichen Aufgaben, doch Mutter starrt mich nur an, als würde sie mich zum ersten Mal sehen. Ich winde mich innerlich unter ihrem Blick, der eine Spur zu lange auf meinen Hüften, den Brüsten, den langen Haaren und meinem Gesicht verweilt. Genau diesen Blick hat sie, wenn sie auf dem Markt eine neue Kuh kaufen will, aber einen Makel sucht, um den Preis zu drücken. Ich zwinge mich, nicht zu Boden zu schauen, spüre jedoch, wie sich die kleinen Härchen in meinem Nacken aufstellen.
»Dein Vater ist ein Narr«, sagt sie und ich habe keine Ahnung, was sie meint. »Lässt mich hier allein mit allen Kindern und der ganzen Arbeit. So einen verantwortungslosen Ehemann habe ich nicht verdient.«
»Aber er muss sich doch verstecken. Der König ist hinter ihm her!«, versuche ich Vater zu verteidigen. »Er kann doch –«
»Falsch«, fällt Mutter mir ins Wort. »Der König jagt einen Bären, nicht meinen Mann.«
Ich blinzele verwirrt. »Aber das ist doch ein und dasselbe! Soll er hier nachts vor der Hütte sitzen und darauf warten, dass sie mit Pfeilen auf ihn schießen?« Ich merke, wie ich mich in Rage rede, und weiß genau, dass das nicht gut für mich ist, dennoch sprudeln die Worte weiter aus mir hervor. »Er versucht sein Leben zu retten und ist nicht auf einem vergnüglichen Ausflug! Der König will Vaters Kopf an seiner Wand haben. Da kann er doch nicht einfach hierbleiben!«
Mutter wedelt abwertend mit der Hand, als könne sie damit meine Erklärung wegwischen. »Der König will den Kopf des Bären.«
»Vater ist der Bär!« Am liebsten würde ich sie an den Schultern packen und schütteln. Versteht sie nicht, dass es keinen Unterschied zwischen ihrem Mann und dem schwarzen Bären gibt? Sie hat seine Verwandlung doch oft genug mit eigenen Augen gesehen.
»Dann soll er sich im Wald herumtreiben, von mir aus! Aber du«, sie zeigt mit dem Zeigefinger auf mich und ich weiche sofort einen Schritt zurück, »wirst heute Nacht hierbleiben. Ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich.«
Ein eiskalter Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Lauf!, schreit mein Körper und die Muskeln in meinen Beinen zittern bereits vor Anspannung. Ich möchte nichts lieber tun, als diesem Instinkt Folge zu leisten.
»Du wirst deine Mutter stolz machen, nicht wahr? Du lässt sie nicht im Stich, wie es dein Vater getan hat.«
Ihre Stimme ist lieblich, fast säuselnd. Ein Tonfall, den ich noch nie bei ihr gehört habe, nicht einmal, wenn sie mit ihren jüngeren Kindern spricht.
Es klingt falsch.
Und trotzdem … habe ich mich so lange danach gesehnt, sie auf diese Weise mit mir reden zu hören. Nicht abwertend und gemein, sondern liebevoll. Sie bittet mich darum, sie stolz zu machen. Sie braucht mich.
»Was … soll ich tun?«, frage ich, obwohl ein Teil in mir schreit, ich solle sofort aus dieser Hütte fliehen, die nicht mehr mein Zuhause ist, und mich im Wald verkriechen. Doch der Umstand, dass sie freundlich mit mir redet und mich braucht, mich bei sich haben will, bringt diesen Teil zum Schweigen.
»Zuerst gehst du nach draußen zu deiner Schwester und dann macht ihr euch gegenseitig zurecht. Flechtet euch die Haare, danach dürft ihr euch an meinen Schminktiegeln bedienen. Ihr zwei seid so blass und unscheinbar wie der Mond.«
Im ersten Moment glaube ich mich verhört zu haben. Noch nie, nicht einmal zu den Hochzeiten meiner älteren Geschwister, durften wir an Mutters heilige Schminke. Ich sowieso nicht, aber die anderen haben es mir erzählt. Ihre Schminke hütet sie wie einen heiligen Schatz, daher lässt mich die Aussicht, dass sie sie freiwillig mit uns teilen will, auf der Hut sein.
»Und dann?«, frage ich vorsichtig.
»Dann werdet ihr beiden dem Gefolge des Königs eure Aufwartung machen. Und wer weiß, vielleicht fallt ihr ja jemandem ins Auge. Schließlich seid ihr nicht unansehnlich. Vor allem du nicht.«
Mutter tritt vor mich. Als sie die Hand hebt, ziehe ich aus Reflex den Kopf zwischen die Schultern, doch der Schmerz eines erwarteten Schlages bleibt aus. Vorsichtig öffne ich die zusammengekniffenen Augen einen Spaltbreit, spähe hindurch und sehe, dass Mutter sich eine Strähne meines Haares, die sich aus dem Zopf gelöst hat, um den Zeigefinger wickelt.
»Wenigstens du hast mein wunderschönes Haar geerbt«, murmelt sie verträumt und schaut auf die blonde Strähne, die ihren Finger umschließt wie gesponnenes Gold. »Nun müssen wir nur etwas daraus machen.«
Mit diesen Worten öffnet sie die Tür und schiebt mich nach draußen in die Nacht, wo ich für einen Moment mit zitternden Knien stehen bleibe, ehe ich mich auf die Suche nach meiner Schwester Beatrix mache.
***
Im Grunde muss ich nur den Schluchzern nachgehen, die die Stille der Nacht zerreißen. Immer noch weinend lehnt Beatrix am Brunnen, der in der Mitte unseres Hofes steht, und starrt in die Nacht hinaus, während sich ihre Schultern ruckartig heben und senken.
Sie erschrickt, als ich zu ihr trete, und wischt sich schnell über die tränennassen Wangen. Sicherlich hat sie Mutter erwartet und damit gerechnet, wieder ausgeschimpft zu werden, weil sie noch nicht fertig ist. Als sie mich erkennt, huscht die Andeutung eines Lächelns über ihre Lippen und sie hört zumindest für den Moment auf zu weinen.