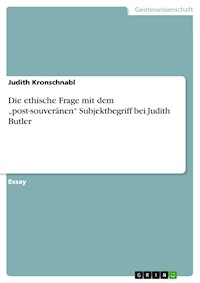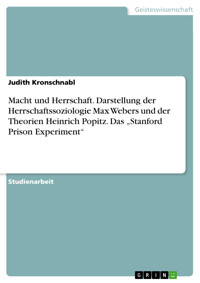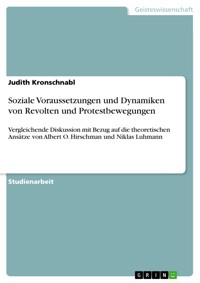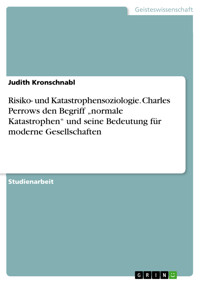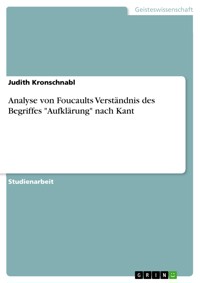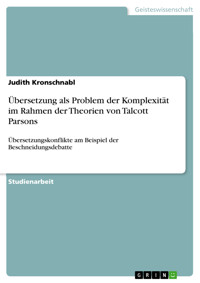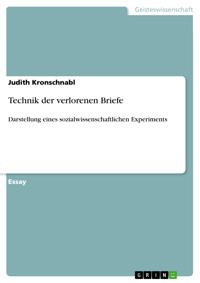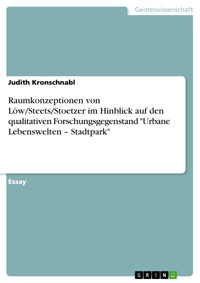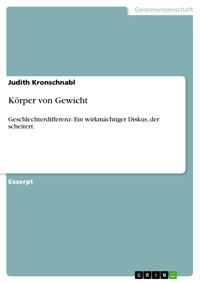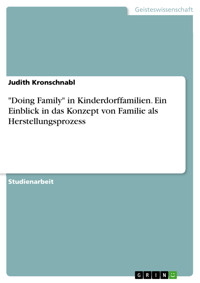
"Doing Family" in Kinderdorffamilien. Ein Einblick in das Konzept von Familie als Herstellungsprozess E-Book
Judith Kronschnabl
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Geschlechterstudien / Gender Studies, Note: 1,4, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Soziologie), Veranstaltung: Neue Familienforschung, Sprache: Deutsch, Abstract: „Mama, Papa, Papa, Kind“, „Drei Eltern, eine Tochter“, „Zwei Mamas und kein Papa“ – dass das Bild der nuklearen Kernfamilie und der dazugehörigen „Vater, Mutter, Kind“-Konstellation seit einiger Zeit überholt ist, wird an diesen aussagekräftigen Überschriften aus Zeitungen wie dem Tagesspiegel, Spiegel oder Süddeutsche Zeitung unmissverständlich deutlich. Heute sind, vor allem aufgrund der aufkommenden Debatte über sogenannte LGBT-Familien, viele verschiedene Familienmodelle denkbar, die die engen Grenzen des Kernfamilienmodells überschreiten und auf immer mehr Akzeptanz und Anerkennung innerhalb unserer Gesellschaft stoßen. Damit zeigt sich allerdings auch die Notwendigkeit eines neuen Konzepts von Familie. Was macht Familie aus wenn genetische oder verwandtschaftliche Beziehungen immer mehr zugunsten sozialer Elternschaft und sozialen Beziehungen weichen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Eine Familie hat man nicht einfach – man muss sie tun
2.1 Doing Family – Das Konzept
2.2 Familie als Herstellungsleistung – Dimensionen von Doing Family
3 „Ich habe zwei Familien“ – Das Konzept Kinderdorf
3.1 Entstehung und Konzept
3.2 Durchführung und Struktur des Kinderdorfalltags
4 ‚Doing Family‘ in Kinderdorffamilien
4.1 Familie in Kinderdörfern
4.2 Grenzen der Herstellungsleistung
5 Schlussbemerkungen
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
„Mama, Papa, Papa, Kind“, „Drei Eltern, eine Tochter“, „Zwei Mamas und kein Papa“ – dass das Bild der nuklearen Kernfamilie und der dazugehörigen „Vater, Mutter, Kind“-Konstellation seit einiger Zeit überholt ist, wird an diesen aussagekräftigen Überschriften aus Zeitungen wie dem Tagesspiegel, Spiegel oder Süddeutsche Zeitung unmissverständlich deutlich. Heute sind, vor allem aufgrund der aufkommenden Debatte über sogenannte LGBT-Familien, viele verschiedene Familienmodelle denkbar, die die engen Grenzen des Kernfamilienmodells überschreiten und auf immer mehr Akzeptanz und Anerkennung innerhalb unserer Gesellschaft stoßen. Damit zeigt sich allerdings auch die Notwendigkeit eines neuen Konzepts von Familie. Was macht Familie aus wenn genetische oder verwandtschaftliche Beziehungen immer mehr zugunsten sozialer Elternschaft und sozialen Beziehungen weichen?
Mit der Idee des „Doing Family“ wird ein Verständnis von Familie nachgezeichnet, welches sich eben nicht mehr auf verwandtschaftliche Voraussetzungen stützt, sondern Familie – ähnlich wie Geschlecht oder Generation – als Prozess begreift, der nie vollständig abgeschlossen sein kann. „Familie als Herstellungsleistung“ lautet also die Idee, die dieser Theorie zufolge jeder, und damit auch der vermeintlichen „Normalfamilie“ zugrunde liegt.
Da Herstellungsleistungen aber immer dann besonders sichtbar werden, wenn sie gerade jenseits dieses „Normalbereichs“ zu verorten sind, befasst sich diese Arbeit im Folgenden mit solchen Familien, die in hohem Maße auf ihre aktive Herstellung angewiesen sind und sich auch nach außen aktiv als solche präsentieren müssen um tatsächlich als Familie erkannt zu werden. Die Rede ist von sogenannten Kinderdorffamilien. Anders als bei Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen, adoptierten oder mit Hilfe von Samenspenden oder Leihmüttern gezeugten Kindern, handelt es sich bei diesen Familien gleichzeitig um Institutionen, die durch die Anstellung sogenannter Kinderdorf-Mütter und –Väter versuchen, familiäre Räume der Geborgenheit für diejenigen Kinder zu schaffen, die zum Teil schlimmes erleben mussten und deren leibliche Eltern nicht oder nicht mehr in der Lage sind sich um sie zu kümmern. „Mama mit Vertrag“ lautet also die Devise auf die sich dieses Familienkonzept stützt. Wie im Rahmen des Doing Family Konzepts Familie in diesen Fällen hergestellt wird und ob bei Kinderdorffamilien von einem soziologischen Standpunkt aus betrachtet, tatsächlich von Familie gesprochen werden kann, soll im Folgenden herausgearbeitet werden.
Dazu werde ich zunächst die Theorie des „Doing Family“ vorstellen und auf ihre Verbindungen zu „Doing Gender“ hinweisen. Hier soll deutlich gemacht werden, wie sich Familie als Herstellungsleistung begreifen lässt und welchen Einfluss dieses Konzept auf die Familienforschung genießt. Nach Erarbeitung der theoretischen Rahmung wird es darum gehen das Prinzip der Kinderdörfer vorzustellen um einen Einblick in Ablauf und Konzeption dieser Einrichtungen sowie den Lebensalltag der Teilnehmenden zu bekommen und deren Selbstwahrnehmung mit in den Blick zu nehmen. Im letzten großen Teil der Arbeit werde ich dann die Theorie des prozessualen Familienbegriffs mit dem empirischen Gegenstand der Kinderdorffamilien verknüpfen und zu einem soziologisch fundierten Ergebnis darüber gelangen, wie Familie dort hergestellt wird und wie sich diese Herstellungsleistung gegebenenfalls von anderen Familien unterscheiden lässt. Abschließend werde ich die Beantwortung der in der Einleitung formulierten Forschungsfrage schlussfolgernd zusammenfassen.